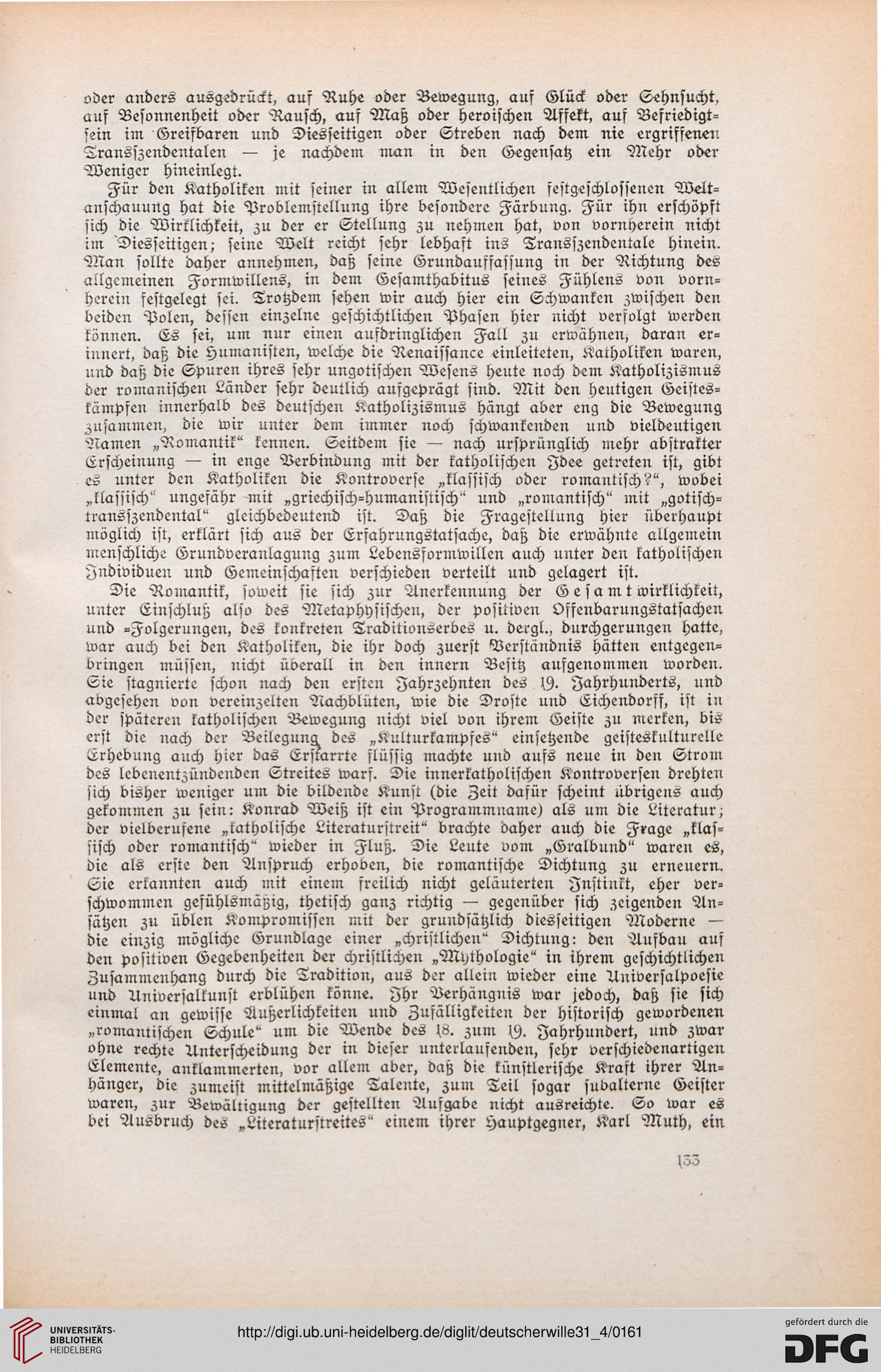oder anders ausgsdrückt, auf Ruhe oder Bewegung, auf Glück oder Sehnsucht,
auf Besonnenheit oder Rausch, auf Maß oder heroischen Affekt, auf Befriedigt-
sein im Greifbaren und Diesseitigen oder Streben nach dem nie ergriffenen
Transszendentalen — je nachdem nian in den Gegensatz ein Mehr oder
Wenigcr hineinlegt.
Für dcn Katholiken mit seiner in allem Wesentlichen festgeschlossenen Welt-
anschauung hat die Problemstellnng ihre besondere Färbung. Für ihn erschöpft
sich die Wirklichkeit, zu der er Stellung zu nehmen hat, von vornherein nicht
im 'Diesseitigen; seine Welt reicht sehr lebhaft ins Transszendentale hinein.
^Nan sollte daher annehmen, daß seine Grundauffassung in der Richtung des
allgcmeinen Formwillens, in dem Gesamthabitus seines Fühlens von vorn-
herein festgelegt sei. Trotzdem sehen wir auch hier ein Schwankcn zwischen den
beiden Polen, dcssen einzelne geschichtlichen Phasen hier nicht versolgt werden
tönnen. Ls sei, um nur einen aufdringlichen Fa!l zn erwähnen, daran er°
iirnert, daß die Humanisten, welche die Renaissance einleiteten, Katholiken waren,
nnd daß die Spuren ihres sehr ungotischen Wesens heute noch dem Katholizismus
der romanischen Länder sehr deutlich aufgeprägt sind. Mit den heutigen Geistes-
kämpfen innerhalb des deutschen Katholizismus hängt aber eng die Bewegung
znsammen, die wir unter dem immer noch schwankenden und vieldeutigen
Namen „Romantik" kennen. Seitdem sie — nach ursprünglich mehr abstrakter
Erscheinung — in enge Verbinbung mit der katholischen Idee getreten ist, gibt
es unter den Katholiken die Kontroverse „klassisch oder romantisch?", wobei
„klassisch" ungefähr mit „griechisch-humanistisch" und „romantisch" mit „gotisch-
transszendental" gleichbedeutend ist. Daß die Fragestellung hier nberhaupt
möglich ist, erklärt sich aus der Erfahrungstatsache, daß die erwähnte allgemein
menschliche Grundveranlagung zum Lebensformwillen auch unter den katholischen
Individuen nnd Gemeinschasten verschieden verteilt und gelagert ist.
Die Romantik, soweit sie sich zur Anerkennung der G e s a m t wirklichkeit,
unter Einschluß also des Metaphysischen, der positiven Offenbarungstatsachen
und -Folgerungen, des konkreten Traditionserbes u. dergl., dnrchgerungen hatte,
war auch bei den Katholiken, die ihr doch zuerst Perständnis hätten entgegeir-
bringen müssen, nicht überall in den innern Besitz anfgenommen worden.
Sie stagnierte schon nach den ersten Iahrzehnten des l9- Iahrhunderts, und
abgesehen von vereinzelten Nachblüten, wie die Droste und Lichcndorff, ist in
der späteren katholischen Bewegung nicht viel von ihrem Geiste zu merken, bis
erst die nach der Beileguna dcs „Kulturkampfes" einsetzende geisteskulturelle
Erhebung anch hier das Erffarrte flüssig machte und aufs neue in den Strom
des lebenentzündendcn Streites warf. Die innerkatholischen Kontroversen drehten
sich bisher weniger um die bildende Kunst (die Zeit dafür scheint übrigens auch
gekommen zu sein: Konrad Weiß ist ein Programmname) als um die Literatur;
der vielberufene „katholische Literaturstreit" brachte daher auch die Frage „klas-
sisch oder romantisch" wieder in Fluß. Die Leute vom „Gralbund" waren es,
die als erste den Anspruch erhoben, die romantische Dichtung zu erneuern.
Sie erkanntcn auch mit einem freilich nicht geläuterten Instinrt, eher ver-
schwommen gefühlsmäßig, thetisch ganz richtig — gegcnüber sich zeigenden An-
sätzcn zu üblen Kompromisscn mit der grundsätzlich diesseitigen Moderne —
die cinzig mögliche Grundlage ciner „christlichen" Dichtung: den Aufbau auf
den positiven Gegebenheiten der christlichen „Mythologie" in ihrem geschichtlichen
Zusammenhang durch die Tradition, aus der allein wieder eine Aniversalpoesie
und Univcrsalkunst erblühen könne. Ihr Berhängnis war jedoch, daß sie sich
einma! an gewisse Außerlichkeiten und Zufälligkeiten der historisch gewordenen
„romantischen Schule" um die Wende des (8. zum (9. Iahrhundert, und zwar
ohne rechte Unterscheidung der in dieser unterlaufenden, sehr verschiedenartigen
Elemente, anklammerten, vor allem aber, daß die künstlerische Kraft ihrer An-
hänger, die zumeist mittelmäßige Talente, zum Teil sogar suvalterne Geister
waren, zur Bewälligung der gestellten Aufgabe nicht ausreichte. So war es
bei Ausbruch des „Literaturstreites" einem ihrer Hauptgegner, Karl Muth, ein
auf Besonnenheit oder Rausch, auf Maß oder heroischen Affekt, auf Befriedigt-
sein im Greifbaren und Diesseitigen oder Streben nach dem nie ergriffenen
Transszendentalen — je nachdem nian in den Gegensatz ein Mehr oder
Wenigcr hineinlegt.
Für dcn Katholiken mit seiner in allem Wesentlichen festgeschlossenen Welt-
anschauung hat die Problemstellnng ihre besondere Färbung. Für ihn erschöpft
sich die Wirklichkeit, zu der er Stellung zu nehmen hat, von vornherein nicht
im 'Diesseitigen; seine Welt reicht sehr lebhaft ins Transszendentale hinein.
^Nan sollte daher annehmen, daß seine Grundauffassung in der Richtung des
allgcmeinen Formwillens, in dem Gesamthabitus seines Fühlens von vorn-
herein festgelegt sei. Trotzdem sehen wir auch hier ein Schwankcn zwischen den
beiden Polen, dcssen einzelne geschichtlichen Phasen hier nicht versolgt werden
tönnen. Ls sei, um nur einen aufdringlichen Fa!l zn erwähnen, daran er°
iirnert, daß die Humanisten, welche die Renaissance einleiteten, Katholiken waren,
nnd daß die Spuren ihres sehr ungotischen Wesens heute noch dem Katholizismus
der romanischen Länder sehr deutlich aufgeprägt sind. Mit den heutigen Geistes-
kämpfen innerhalb des deutschen Katholizismus hängt aber eng die Bewegung
znsammen, die wir unter dem immer noch schwankenden und vieldeutigen
Namen „Romantik" kennen. Seitdem sie — nach ursprünglich mehr abstrakter
Erscheinung — in enge Verbinbung mit der katholischen Idee getreten ist, gibt
es unter den Katholiken die Kontroverse „klassisch oder romantisch?", wobei
„klassisch" ungefähr mit „griechisch-humanistisch" und „romantisch" mit „gotisch-
transszendental" gleichbedeutend ist. Daß die Fragestellung hier nberhaupt
möglich ist, erklärt sich aus der Erfahrungstatsache, daß die erwähnte allgemein
menschliche Grundveranlagung zum Lebensformwillen auch unter den katholischen
Individuen nnd Gemeinschasten verschieden verteilt und gelagert ist.
Die Romantik, soweit sie sich zur Anerkennung der G e s a m t wirklichkeit,
unter Einschluß also des Metaphysischen, der positiven Offenbarungstatsachen
und -Folgerungen, des konkreten Traditionserbes u. dergl., dnrchgerungen hatte,
war auch bei den Katholiken, die ihr doch zuerst Perständnis hätten entgegeir-
bringen müssen, nicht überall in den innern Besitz anfgenommen worden.
Sie stagnierte schon nach den ersten Iahrzehnten des l9- Iahrhunderts, und
abgesehen von vereinzelten Nachblüten, wie die Droste und Lichcndorff, ist in
der späteren katholischen Bewegung nicht viel von ihrem Geiste zu merken, bis
erst die nach der Beileguna dcs „Kulturkampfes" einsetzende geisteskulturelle
Erhebung anch hier das Erffarrte flüssig machte und aufs neue in den Strom
des lebenentzündendcn Streites warf. Die innerkatholischen Kontroversen drehten
sich bisher weniger um die bildende Kunst (die Zeit dafür scheint übrigens auch
gekommen zu sein: Konrad Weiß ist ein Programmname) als um die Literatur;
der vielberufene „katholische Literaturstreit" brachte daher auch die Frage „klas-
sisch oder romantisch" wieder in Fluß. Die Leute vom „Gralbund" waren es,
die als erste den Anspruch erhoben, die romantische Dichtung zu erneuern.
Sie erkanntcn auch mit einem freilich nicht geläuterten Instinrt, eher ver-
schwommen gefühlsmäßig, thetisch ganz richtig — gegcnüber sich zeigenden An-
sätzcn zu üblen Kompromisscn mit der grundsätzlich diesseitigen Moderne —
die cinzig mögliche Grundlage ciner „christlichen" Dichtung: den Aufbau auf
den positiven Gegebenheiten der christlichen „Mythologie" in ihrem geschichtlichen
Zusammenhang durch die Tradition, aus der allein wieder eine Aniversalpoesie
und Univcrsalkunst erblühen könne. Ihr Berhängnis war jedoch, daß sie sich
einma! an gewisse Außerlichkeiten und Zufälligkeiten der historisch gewordenen
„romantischen Schule" um die Wende des (8. zum (9. Iahrhundert, und zwar
ohne rechte Unterscheidung der in dieser unterlaufenden, sehr verschiedenartigen
Elemente, anklammerten, vor allem aber, daß die künstlerische Kraft ihrer An-
hänger, die zumeist mittelmäßige Talente, zum Teil sogar suvalterne Geister
waren, zur Bewälligung der gestellten Aufgabe nicht ausreichte. So war es
bei Ausbruch des „Literaturstreites" einem ihrer Hauptgegner, Karl Muth, ein