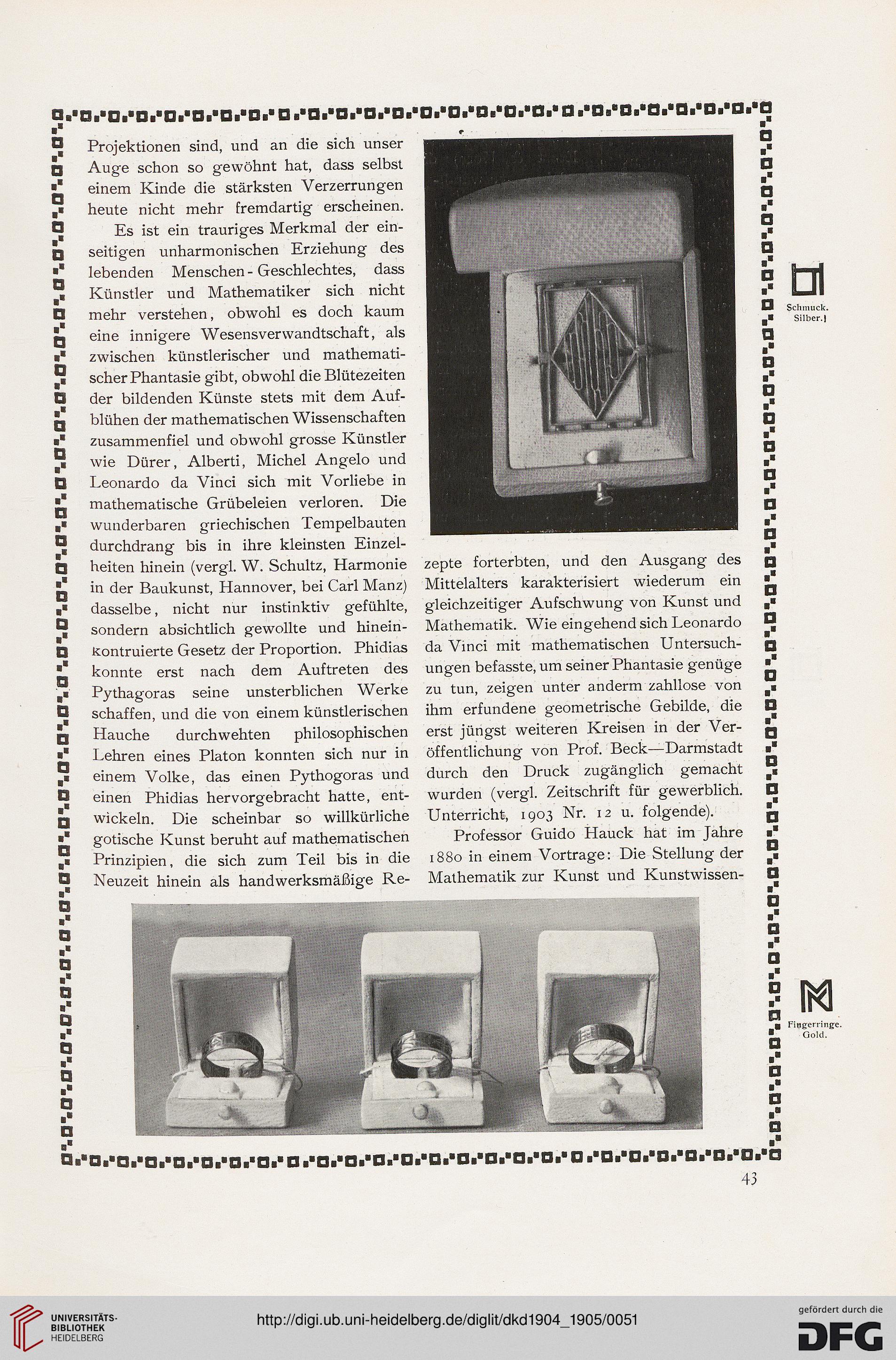a.
i-
D
«"
a
D
D
a
«•
a
■«
o
■>
a
a
.»
D
■»
D
■«
a
a
■»
a
.«
D
O
«■
D
.«
D
««
a
■»
a
D
■«
□
■«
D
«■
a
.«
D
««
D
.«
O
a
«•
D
.»
Q
a
o
□
a,
Projektionen sind, und an die sich unser
Auge schon so gewöhnt hat, dass selbst
einem Kinde die stärksten Verzerrungen
heute nicht mehr fremdartig erscheinen.
Es ist ein trauriges Merkmal der ein-
seitigen unharmonischen Erziehung des
lebenden Menschen - Geschlechtes, dass
Künstler und Mathematiker sich nicht
mehr verstehen, obwohl es doch kaum
eine innigere Wesensverwandtschaft, als
zwischen künstlerischer und mathemati-
scher Phantasie gibt, obwohl die Blütezeiten
der bildenden Künste stets mit dem Auf-
blühen der mathematischen Wissenschaften
zusammenfiel und obwohl grosse Künstler
wie Dürer, Alberti, Michel Angelo und
Leonardo da Vinci sich mit Vorliebe in
mathematische Grübeleien verloren. Die
wunderbaren griechischen Tempelbauten
durchdrang bis in ihre kleinsten Einzel-
heiten hinein (vergl. W. Schultz, Harmonie
in der Baukunst, Hannover, bei Carl Manz)
dasselbe, nicht nur instinktiv gefühlte,
sondern absichtlich gewollte und hinein-
Kontruierte Gesetz der Proportion. Phidias
konnte erst nach dem Auftreten des
Pythagoras seine unsterblichen Werke
schaffen, und die von einem künstlerischen
Hauche durchwehten philosophischen
Lehren eines Piaton konnten sich nur in
einem Volke, das einen Pythogoras und
einen Phidias hervorgebracht hatte, ent-
wickeln. Die scheinbar so willkürliche
gotische Kunst beruht auf mathematischen
Prinzipien, die sich zum Teil bis in die
Neuzeit hinein als handwerksmäßige Re-
zepte forterbten, und den Ausgang des
Mittelalters karakterisiert wiederum ein
gleichzeitiger Aufschwung von Kunst und
Mathematik. Wie eingehend sich Leonardo
da Vinci mit mathematischen Untersuch-
ungen befasste, um seiner Phantasie genüge
zu tun, zeigen unter anderm zahllose von
ihm erfundene geometrische Gebilde, die
erst jüngst weiteren Kreisen in der Ver-
öffentlichung von Prof. Beck—Darmstadt
durch den Druck zugänglich gemacht
wurden (vergl. Zeitschrift für gewerblich.
Unterricht, 1903 Nr. 12 u. folgende).
Professor Guido Hauck hat im Jahre
1880 in einem Vortrage: Die Stellung der
Mathematik zur Kunst und Kunstwissen-
■
D
□
□
■
Ül
D Schmuck.
,» Silber.l
D
a
o
a
.»
a
a
a
D
a
o
«•
a
«■
a
a
a
a
■«
D
a
«•
D
a
_■
■
a
■ Fingerringe.
* Gold.
□
a
a
■■
□
i-
D
«"
a
D
D
a
«•
a
■«
o
■>
a
a
.»
D
■»
D
■«
a
a
■»
a
.«
D
O
«■
D
.«
D
««
a
■»
a
D
■«
□
■«
D
«■
a
.«
D
««
D
.«
O
a
«•
D
.»
Q
a
o
□
a,
Projektionen sind, und an die sich unser
Auge schon so gewöhnt hat, dass selbst
einem Kinde die stärksten Verzerrungen
heute nicht mehr fremdartig erscheinen.
Es ist ein trauriges Merkmal der ein-
seitigen unharmonischen Erziehung des
lebenden Menschen - Geschlechtes, dass
Künstler und Mathematiker sich nicht
mehr verstehen, obwohl es doch kaum
eine innigere Wesensverwandtschaft, als
zwischen künstlerischer und mathemati-
scher Phantasie gibt, obwohl die Blütezeiten
der bildenden Künste stets mit dem Auf-
blühen der mathematischen Wissenschaften
zusammenfiel und obwohl grosse Künstler
wie Dürer, Alberti, Michel Angelo und
Leonardo da Vinci sich mit Vorliebe in
mathematische Grübeleien verloren. Die
wunderbaren griechischen Tempelbauten
durchdrang bis in ihre kleinsten Einzel-
heiten hinein (vergl. W. Schultz, Harmonie
in der Baukunst, Hannover, bei Carl Manz)
dasselbe, nicht nur instinktiv gefühlte,
sondern absichtlich gewollte und hinein-
Kontruierte Gesetz der Proportion. Phidias
konnte erst nach dem Auftreten des
Pythagoras seine unsterblichen Werke
schaffen, und die von einem künstlerischen
Hauche durchwehten philosophischen
Lehren eines Piaton konnten sich nur in
einem Volke, das einen Pythogoras und
einen Phidias hervorgebracht hatte, ent-
wickeln. Die scheinbar so willkürliche
gotische Kunst beruht auf mathematischen
Prinzipien, die sich zum Teil bis in die
Neuzeit hinein als handwerksmäßige Re-
zepte forterbten, und den Ausgang des
Mittelalters karakterisiert wiederum ein
gleichzeitiger Aufschwung von Kunst und
Mathematik. Wie eingehend sich Leonardo
da Vinci mit mathematischen Untersuch-
ungen befasste, um seiner Phantasie genüge
zu tun, zeigen unter anderm zahllose von
ihm erfundene geometrische Gebilde, die
erst jüngst weiteren Kreisen in der Ver-
öffentlichung von Prof. Beck—Darmstadt
durch den Druck zugänglich gemacht
wurden (vergl. Zeitschrift für gewerblich.
Unterricht, 1903 Nr. 12 u. folgende).
Professor Guido Hauck hat im Jahre
1880 in einem Vortrage: Die Stellung der
Mathematik zur Kunst und Kunstwissen-
■
D
□
□
■
Ül
D Schmuck.
,» Silber.l
D
a
o
a
.»
a
a
a
D
a
o
«•
a
«■
a
a
a
a
■«
D
a
«•
D
a
_■
■
a
■ Fingerringe.
* Gold.
□
a
a
■■
□