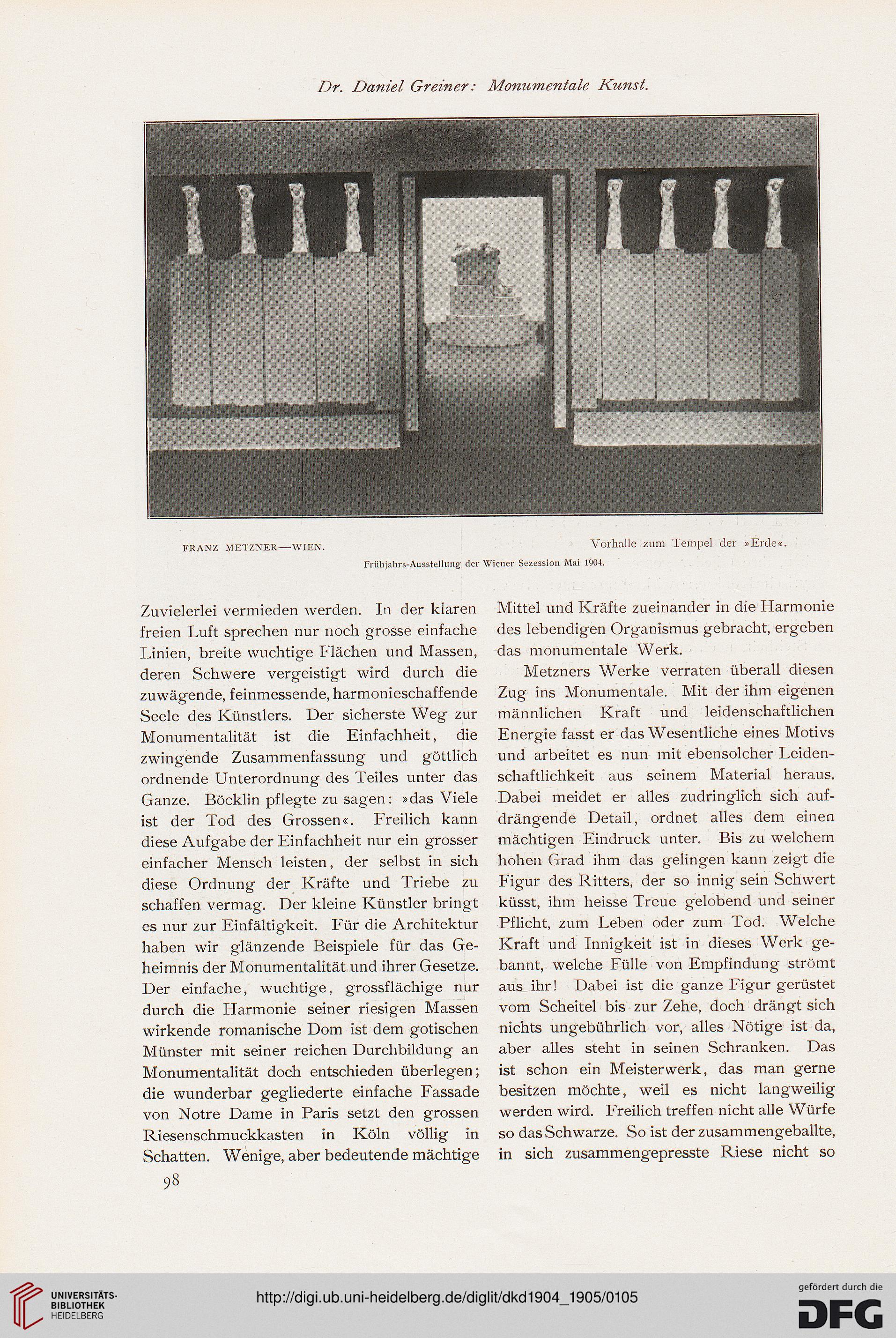Dr. Daniel Greiner: Momimentale Kunst.
kränz metzner—Wien. Vorhalle zum Tempel der »Erde
Frübjahrs-Ausstellung der Wiener Sezession Mai 1904.
Zuvielerlei vermieden werden. In der klaren
freien Luft sprechen nur noch grosse einfache
Linien, breite wuchtige Flächen und Massen,
deren Schwere vergeistigt wird durch die
zuwägende, feinmessende, harmonieschaffende
Seele des Künstlers. Der sicherste Weg zur
Monumentalität ist die Einfachheit, die
zwingende Zusammenfassung und göttlich
ordnende Unterordnung des Teiles unter das
Ganze. Böcklin pflegte zu sagen: »das Viele
ist der Tod des Grossen«. Freilich kann
diese Aufgabe der Einfachheit nur ein grosser
einfacher Mensch leisten, der selbst in sich
diese Ordnung der Kräfte und Triebe zu
schaffen vermag. Der kleine Künstler bringt
es nur zur Einfältigkeit. Für die Architektur
haben wir glänzende Beispiele für das Ge-
heimnis der Monumentalität und ihrer Gesetze.
Der einfache, wuchtige, grossflächige nur
durch die Harmonie seiner riesigen Massen
wirkende romanische Dom ist dem gotischen
Münster mit seiner reichen Durchbildung an
Monumentalität doch entschieden überlegen;
die wunderbar gegliederte einfache Fassade
von Notre Dame in Paris setzt den grossen
Riesenschmuckkasten in Köln völlig in
Schatten. Wenige, aber bedeutende mächtige
98
Mittel und Kräfte zueinander in die Harmonie
des lebendigen Organismus gebracht, ergeben
das monumentale Werk.
Metzners Werke verraten überall diesen
Zug ins Monumentale. Mit der ihm eigenen
männlichen Kraft und leidenschaftlichen
Energie fasst er das Wesentliche eines Motivs
und arbeitet es nun mit ebensolcher Leiden-
schaftlichkeit aus seinem Material heraus.
Dabei meidet er alles zudringlich sich auf-
drängende Detail, ordnet alles dem einen
mächtigen Eindruck unter. Bis zu welchem
hohen Grad ihm das gelingen kann zeigt die
Figur des Ritters, der so innig sein Schwert
küsst, ihm heisse Treue gelobend und seiner
Pflicht, zum Leben oder zum Tod. Welche
Kraft und Innigkeit ist in dieses Werk ge-
bannt, welche Fülle von Empfindung strömt
aus ihr! Dabei ist die ganze Figur gerüstet
vom Scheitel bis zur Zehe, doch drängt sich
nichts ungebührlich vor, alles Nötige ist da,
aber alles steht in seinen Schranken. Das
ist schon ein Meisterwerk, das man gerne
besitzen möchte, weil es nicht langweilig
werden wird. Freilich treffen nicht alle Würfe
so das Schwarze. So ist der zusammengeballte,
in sich zusammengepresste Riese nicht so
kränz metzner—Wien. Vorhalle zum Tempel der »Erde
Frübjahrs-Ausstellung der Wiener Sezession Mai 1904.
Zuvielerlei vermieden werden. In der klaren
freien Luft sprechen nur noch grosse einfache
Linien, breite wuchtige Flächen und Massen,
deren Schwere vergeistigt wird durch die
zuwägende, feinmessende, harmonieschaffende
Seele des Künstlers. Der sicherste Weg zur
Monumentalität ist die Einfachheit, die
zwingende Zusammenfassung und göttlich
ordnende Unterordnung des Teiles unter das
Ganze. Böcklin pflegte zu sagen: »das Viele
ist der Tod des Grossen«. Freilich kann
diese Aufgabe der Einfachheit nur ein grosser
einfacher Mensch leisten, der selbst in sich
diese Ordnung der Kräfte und Triebe zu
schaffen vermag. Der kleine Künstler bringt
es nur zur Einfältigkeit. Für die Architektur
haben wir glänzende Beispiele für das Ge-
heimnis der Monumentalität und ihrer Gesetze.
Der einfache, wuchtige, grossflächige nur
durch die Harmonie seiner riesigen Massen
wirkende romanische Dom ist dem gotischen
Münster mit seiner reichen Durchbildung an
Monumentalität doch entschieden überlegen;
die wunderbar gegliederte einfache Fassade
von Notre Dame in Paris setzt den grossen
Riesenschmuckkasten in Köln völlig in
Schatten. Wenige, aber bedeutende mächtige
98
Mittel und Kräfte zueinander in die Harmonie
des lebendigen Organismus gebracht, ergeben
das monumentale Werk.
Metzners Werke verraten überall diesen
Zug ins Monumentale. Mit der ihm eigenen
männlichen Kraft und leidenschaftlichen
Energie fasst er das Wesentliche eines Motivs
und arbeitet es nun mit ebensolcher Leiden-
schaftlichkeit aus seinem Material heraus.
Dabei meidet er alles zudringlich sich auf-
drängende Detail, ordnet alles dem einen
mächtigen Eindruck unter. Bis zu welchem
hohen Grad ihm das gelingen kann zeigt die
Figur des Ritters, der so innig sein Schwert
küsst, ihm heisse Treue gelobend und seiner
Pflicht, zum Leben oder zum Tod. Welche
Kraft und Innigkeit ist in dieses Werk ge-
bannt, welche Fülle von Empfindung strömt
aus ihr! Dabei ist die ganze Figur gerüstet
vom Scheitel bis zur Zehe, doch drängt sich
nichts ungebührlich vor, alles Nötige ist da,
aber alles steht in seinen Schranken. Das
ist schon ein Meisterwerk, das man gerne
besitzen möchte, weil es nicht langweilig
werden wird. Freilich treffen nicht alle Würfe
so das Schwarze. So ist der zusammengeballte,
in sich zusammengepresste Riese nicht so