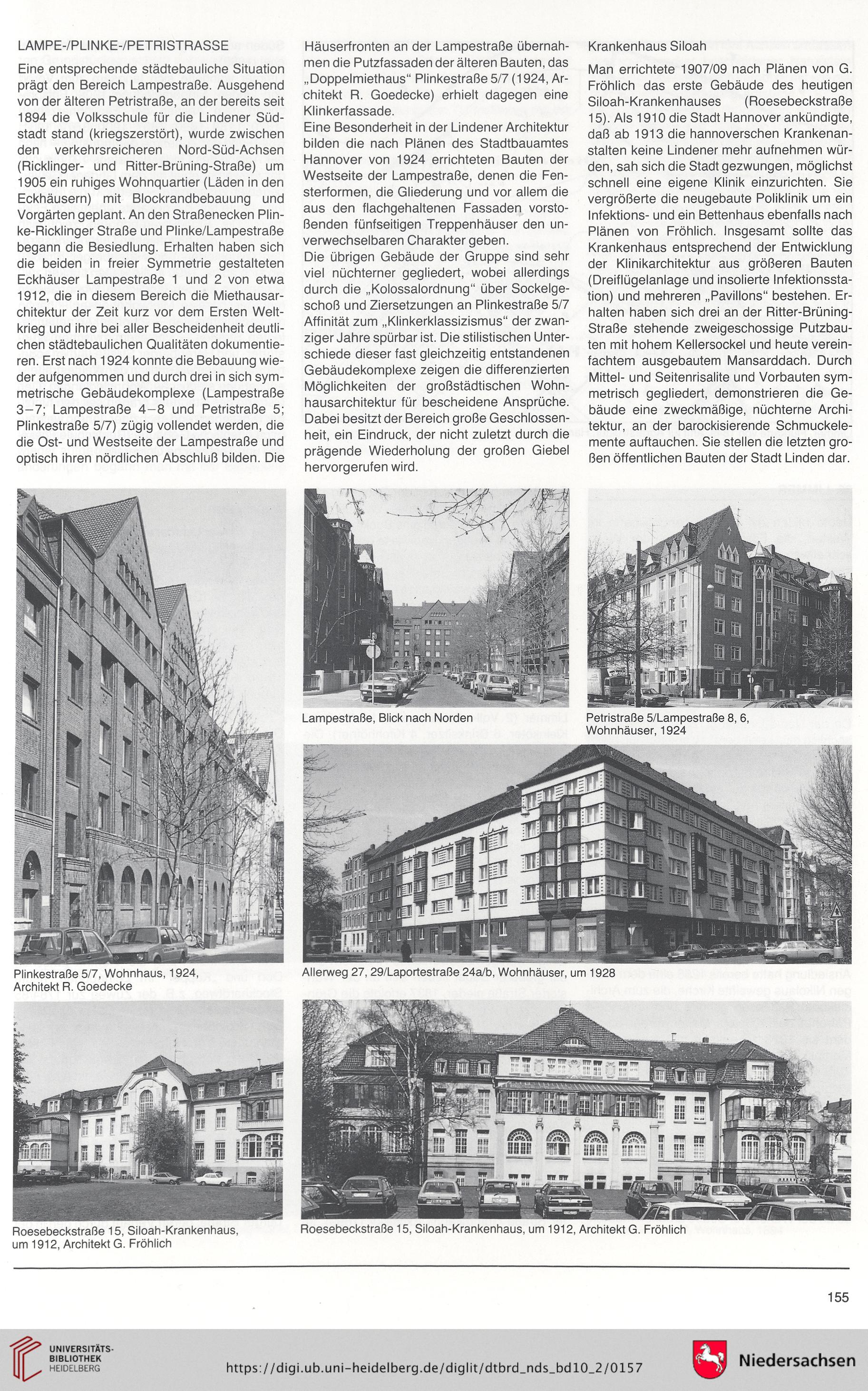LAMPE-/PLINKE-/PETRISTRASSE
Eine entsprechende städtebauliche Situation
prägt den Bereich Lampestraße. Ausgehend
von der älteren Petristraße, an der bereits seit
1894 die Volksschule für die Lindener Süd-
stadt stand (kriegszerstört), wurde zwischen
den verkehrsreicheren Nord-Süd-Achsen
(Ricklinger- und Ritter-Brüning-Straße) um
1905 ein ruhiges Wohnquartier (Läden in den
Eckhäusern) mit Blockrandbebauung und
Vorgärten geplant. An den Straßenecken Plin-
ke-Ricklinger Straße und Plinke/Lampestraße
begann die Besiedlung. Erhalten haben sich
die beiden in freier Symmetrie gestalteten
Eckhäuser Lampestraße 1 und 2 von etwa
1912, die in diesem Bereich die Miethausar-
chitektur der Zeit kurz vor dem Ersten Welt-
krieg und ihre bei aller Bescheidenheit deutli-
chen städtebaulichen Qualitäten dokumentie-
ren. Erst nach 1924 konnte die Bebauung wie-
der aufgenommen und durch drei in sich sym-
metrische Gebäudekomplexe (Lampestraße
3-7; Lampestraße 4-8 und Petristraße 5;
Plinkestraße 5/7) zügig vollendet werden, die
die Ost- und Westseite der Lampestraße und
optisch ihren nördlichen Abschluß bilden. Die
Plinkestraße 5/7, Wohnhaus, 1924,
Architekt R. Goedecke
Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus,
um 1912, Architekt G. Fröhlich
Häuserfronten an der Lampestraße übernah-
men die Putzfassaden der älteren Bauten, das
„Doppelmiethaus“ Plinkestraße 5/7 (1924, Ar-
chitekt R. Goedecke) erhielt dagegen eine
Klinkerfassade.
Eine Besonderheit in der Lindener Architektur
bilden die nach Plänen des Stadtbauamtes
Hannover von 1924 errichteten Bauten der
Westseite der Lampestraße, denen die Fen-
sterformen, die Gliederung und vor allem die
aus den flachgehaltenen Fassaden vorsto-
ßenden fünfseitigen Treppenhäuser den un-
verwechselbaren Charakter geben.
Die übrigen Gebäude der Gruppe sind sehr
viel nüchterner gegliedert, wobei allerdings
durch die „Kolossalordnung“ über Sockelge-
schoß und Ziersetzungen an Plinkestraße 5/7
Affinität zum „Klinkerklassizismus“ der zwan-
ziger Jahre spürbar ist. Die stilistischen Unter-
schiede dieser fast gleichzeitig entstandenen
Gebäudekomplexe zeigen die differenzierten
Möglichkeiten der großstädtischen Wohn-
hausarchitektur für bescheidene Ansprüche.
Dabei besitzt der Bereich große Geschlossen-
heit, ein Eindruck, der nicht zuletzt durch die
prägende Wiederholung der großen Giebel
hervorgerufen wird.
Krankenhaus Siloah
Man errichtete 1907/09 nach Plänen von G.
Fröhlich das erste Gebäude des heutigen
Siloah-Krankenhauses (Roesebeckstraße
15). Als 1910 die Stadt Hannover ankündigte,
daß ab 1913 die hannoverschen Krankenan-
stalten keine Lindener mehr aufnehmen wür-
den, sah sich die Stadt gezwungen, möglichst
schnell eine eigene Klinik einzurichten. Sie
vergrößerte die neugebaute Poliklinik um ein
Infektions- und ein Bettenhaus ebenfalls nach
Plänen von Fröhlich. Insgesamt sollte das
Krankenhaus entsprechend der Entwicklung
der Klinikarchitektur aus größeren Bauten
(Dreiflügelanlage und insolierte Infektionssta-
tion) und mehreren „Pavillons“ bestehen. Er-
halten haben sich drei an der Ritter-Brüning-
Straße stehende zweigeschossige Putzbau-
ten mit hohem Kellersockel und heute verein-
fachtem ausgebautem Mansarddach. Durch
Mittel- und Seitenrisalite und Vorbauten sym-
metrisch gegliedert, demonstrieren die Ge-
bäude eine zweckmäßige, nüchterne Archi-
tektur, an der barockisierende Schmuckele-
mente auftauchen. Sie stellen die letzten gro-
ßen öffentlichen Bauten der Stadt Linden dar.
Lampestraße, Blick nach Norden
Petristraße 5/Lampestraße 8, 6,
Wohnhäuser, 1924
Allerweg 27, 29/Laportestraße 24a/b, Wohnhäuser, um 1928
Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus, um 1912, Architekt G. Fröhlich
155
Eine entsprechende städtebauliche Situation
prägt den Bereich Lampestraße. Ausgehend
von der älteren Petristraße, an der bereits seit
1894 die Volksschule für die Lindener Süd-
stadt stand (kriegszerstört), wurde zwischen
den verkehrsreicheren Nord-Süd-Achsen
(Ricklinger- und Ritter-Brüning-Straße) um
1905 ein ruhiges Wohnquartier (Läden in den
Eckhäusern) mit Blockrandbebauung und
Vorgärten geplant. An den Straßenecken Plin-
ke-Ricklinger Straße und Plinke/Lampestraße
begann die Besiedlung. Erhalten haben sich
die beiden in freier Symmetrie gestalteten
Eckhäuser Lampestraße 1 und 2 von etwa
1912, die in diesem Bereich die Miethausar-
chitektur der Zeit kurz vor dem Ersten Welt-
krieg und ihre bei aller Bescheidenheit deutli-
chen städtebaulichen Qualitäten dokumentie-
ren. Erst nach 1924 konnte die Bebauung wie-
der aufgenommen und durch drei in sich sym-
metrische Gebäudekomplexe (Lampestraße
3-7; Lampestraße 4-8 und Petristraße 5;
Plinkestraße 5/7) zügig vollendet werden, die
die Ost- und Westseite der Lampestraße und
optisch ihren nördlichen Abschluß bilden. Die
Plinkestraße 5/7, Wohnhaus, 1924,
Architekt R. Goedecke
Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus,
um 1912, Architekt G. Fröhlich
Häuserfronten an der Lampestraße übernah-
men die Putzfassaden der älteren Bauten, das
„Doppelmiethaus“ Plinkestraße 5/7 (1924, Ar-
chitekt R. Goedecke) erhielt dagegen eine
Klinkerfassade.
Eine Besonderheit in der Lindener Architektur
bilden die nach Plänen des Stadtbauamtes
Hannover von 1924 errichteten Bauten der
Westseite der Lampestraße, denen die Fen-
sterformen, die Gliederung und vor allem die
aus den flachgehaltenen Fassaden vorsto-
ßenden fünfseitigen Treppenhäuser den un-
verwechselbaren Charakter geben.
Die übrigen Gebäude der Gruppe sind sehr
viel nüchterner gegliedert, wobei allerdings
durch die „Kolossalordnung“ über Sockelge-
schoß und Ziersetzungen an Plinkestraße 5/7
Affinität zum „Klinkerklassizismus“ der zwan-
ziger Jahre spürbar ist. Die stilistischen Unter-
schiede dieser fast gleichzeitig entstandenen
Gebäudekomplexe zeigen die differenzierten
Möglichkeiten der großstädtischen Wohn-
hausarchitektur für bescheidene Ansprüche.
Dabei besitzt der Bereich große Geschlossen-
heit, ein Eindruck, der nicht zuletzt durch die
prägende Wiederholung der großen Giebel
hervorgerufen wird.
Krankenhaus Siloah
Man errichtete 1907/09 nach Plänen von G.
Fröhlich das erste Gebäude des heutigen
Siloah-Krankenhauses (Roesebeckstraße
15). Als 1910 die Stadt Hannover ankündigte,
daß ab 1913 die hannoverschen Krankenan-
stalten keine Lindener mehr aufnehmen wür-
den, sah sich die Stadt gezwungen, möglichst
schnell eine eigene Klinik einzurichten. Sie
vergrößerte die neugebaute Poliklinik um ein
Infektions- und ein Bettenhaus ebenfalls nach
Plänen von Fröhlich. Insgesamt sollte das
Krankenhaus entsprechend der Entwicklung
der Klinikarchitektur aus größeren Bauten
(Dreiflügelanlage und insolierte Infektionssta-
tion) und mehreren „Pavillons“ bestehen. Er-
halten haben sich drei an der Ritter-Brüning-
Straße stehende zweigeschossige Putzbau-
ten mit hohem Kellersockel und heute verein-
fachtem ausgebautem Mansarddach. Durch
Mittel- und Seitenrisalite und Vorbauten sym-
metrisch gegliedert, demonstrieren die Ge-
bäude eine zweckmäßige, nüchterne Archi-
tektur, an der barockisierende Schmuckele-
mente auftauchen. Sie stellen die letzten gro-
ßen öffentlichen Bauten der Stadt Linden dar.
Lampestraße, Blick nach Norden
Petristraße 5/Lampestraße 8, 6,
Wohnhäuser, 1924
Allerweg 27, 29/Laportestraße 24a/b, Wohnhäuser, um 1928
Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus, um 1912, Architekt G. Fröhlich
155