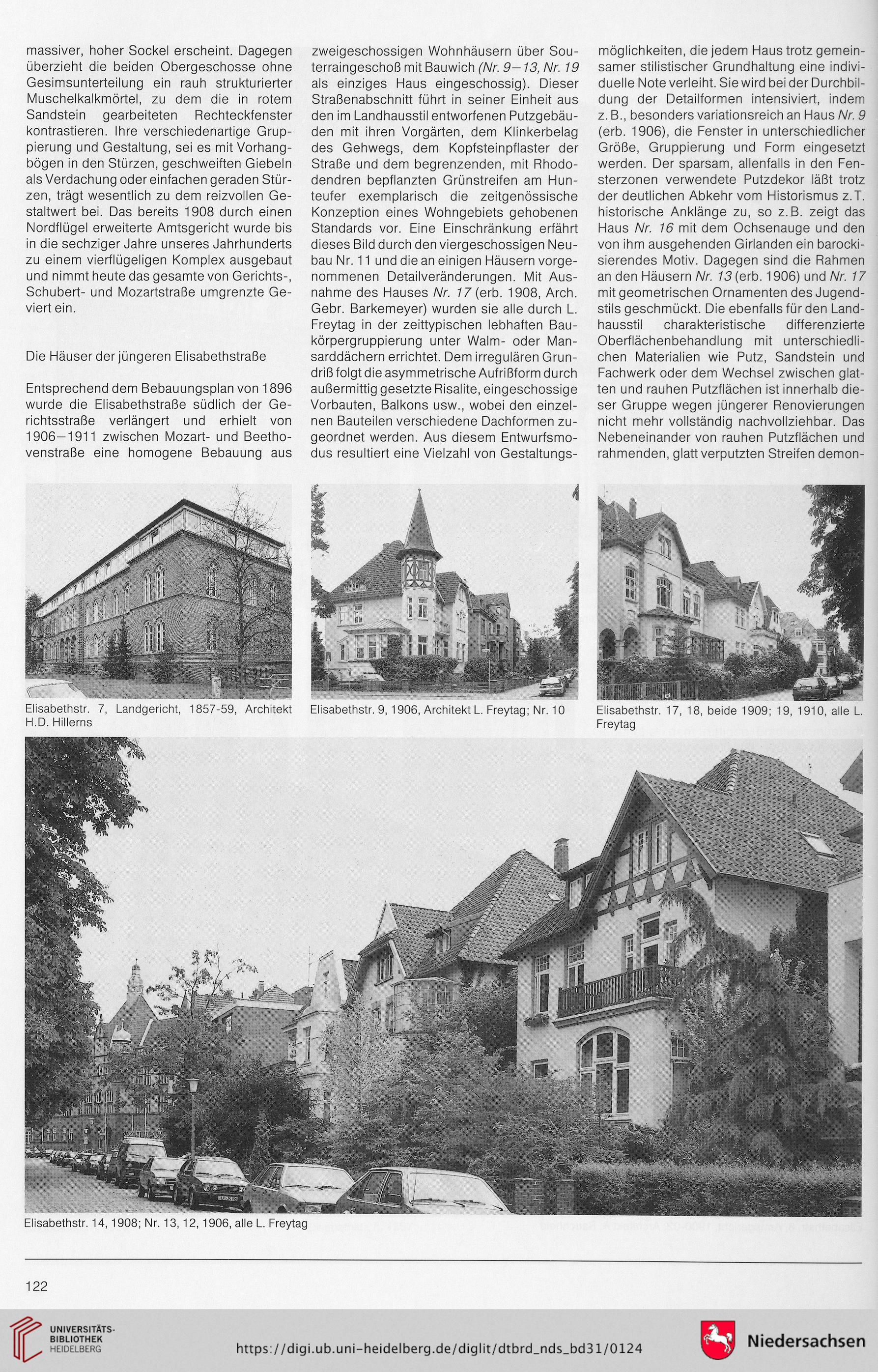massiver, hoher Sockel erscheint. Dagegen
überzieht die beiden Obergeschosse ohne
Gesimsunterteilung ein rauh strukturierter
Muschelkalkmörtel, zu dem die in rotem
Sandstein gearbeiteten Rechteckfenster
kontrastieren. Ihre verschiedenartige Grup-
pierung und Gestaltung, sei es mit Vorhang-
bögen in den Stürzen, geschweiften Giebeln
als Verdachung oder einfachen geraden Stür-
zen, trägt wesentlich zu dem reizvollen Ge-
staltwert bei. Das bereits 1908 durch einen
Nordflügel erweiterte Amtsgericht wurde bis
in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts
zu einem vierflügeligen Komplex ausgebaut
und nimmt heute das gesamte von Gerichts-,
Schubert- und Mozartstraße umgrenzte Ge-
viert ein.
Die Häuser der jüngeren Elisabethstraße
Entsprechend dem Bebauungsplan von 1896
wurde die Elisabethstraße südlich der Ge-
richtsstraße verlängert und erhielt von
1906-1911 zwischen Mozart- und Beetho-
venstraße eine homogene Bebauung aus
zweigeschossigen Wohnhäusern über Sou-
terraingeschoß mit Bauwich (Nr. 9-13, Nr. 19
als einziges Haus eingeschossig). Dieser
Straßenabschnitt führt in seiner Einheit aus
den im Landhausstil entworfenen Putzgebäu-
den mit ihren Vorgärten, dem Klinkerbelag
des Gehwegs, dem Kopfsteinpflaster der
Straße und dem begrenzenden, mit Rhodo-
dendren bepflanzten Grünstreifen am Hun-
teufer exemplarisch die zeitgenössische
Konzeption eines Wohngebiets gehobenen
Standards vor. Eine Einschränkung erfährt
dieses Bild durch den viergeschossigen Neu-
bau Nr. 11 und die an einigen Häusern vorge-
nommenen Detailveränderungen. Mit Aus-
nahme des Hauses Nr. 17 (erb. 1908, Arch.
Gebr. Barkemeyer) wurden sie alle durch L.
Freytag in der zeittypischen lebhaften Bau-
körpergruppierung unter Walm- oder Man-
sarddächern errichtet. Dem irregulären Grun-
driß folgt die asymmetrische Aufrißform durch
außermittig gesetzte Risalite, eingeschossige
Vorbauten, Balkons usw., wobei den einzel-
nen Bauteilen verschiedene Dachformen zu-
geordnet werden. Aus diesem Entwurfsmo-
dus resultiert eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten, die jedem Haus trotz gemein-
samer stilistischer Grundhaltung eine indivi-
duelle Note verleiht. Sie wird bei der Durchbil-
dung der Detailformen intensiviert, indem
z. B., besonders variationsreich an Haus Nr. 9
(erb. 1906), die Fenster in unterschiedlicher
Größe, Gruppierung und Form eingesetzt
werden. Der sparsam, allenfalls in den Fen-
sterzonen verwendete Putzdekor läßt trotz
der deutlichen Abkehr vom Historismus z.T.
historische Anklänge zu, so z.B. zeigt das
Haus Nr. 16 mit dem Ochsenauge und den
von ihm ausgehenden Girlanden ein barocki-
sierendes Motiv. Dagegen sind die Rahmen
an den Häusern Nr. 13 (erb. 1906) und Nr. 17
mit geometrischen Ornamenten des Jugend-
stils geschmückt. Die ebenfalls für den Land-
hausstil charakteristische differenzierte
Oberflächenbehandlung mit unterschiedli-
chen Materialien wie Putz, Sandstein und
Fachwerk oder dem Wechsel zwischen glat-
ten und rauhen Putzflächen ist innerhalb die-
ser Gruppe wegen jüngerer Renovierungen
nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Das
Nebeneinander von rauhen Putzflächen und
rahmenden, glatt verputzten Streifen demon-
Elisabethstr. 14, 1908; Nr. 13, 12, 1906, alle L. Freytag
Elisabethstr. 7, Landgericht, 1857-59, Architekt
H.D. Hillerns
Elisabethstr. 17, 18, beide 1909; 19, 1910, alle L.
Freytag
Elisabethstr. 9, 1906, Architekt L. Freytag; Nr. 10
122
überzieht die beiden Obergeschosse ohne
Gesimsunterteilung ein rauh strukturierter
Muschelkalkmörtel, zu dem die in rotem
Sandstein gearbeiteten Rechteckfenster
kontrastieren. Ihre verschiedenartige Grup-
pierung und Gestaltung, sei es mit Vorhang-
bögen in den Stürzen, geschweiften Giebeln
als Verdachung oder einfachen geraden Stür-
zen, trägt wesentlich zu dem reizvollen Ge-
staltwert bei. Das bereits 1908 durch einen
Nordflügel erweiterte Amtsgericht wurde bis
in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts
zu einem vierflügeligen Komplex ausgebaut
und nimmt heute das gesamte von Gerichts-,
Schubert- und Mozartstraße umgrenzte Ge-
viert ein.
Die Häuser der jüngeren Elisabethstraße
Entsprechend dem Bebauungsplan von 1896
wurde die Elisabethstraße südlich der Ge-
richtsstraße verlängert und erhielt von
1906-1911 zwischen Mozart- und Beetho-
venstraße eine homogene Bebauung aus
zweigeschossigen Wohnhäusern über Sou-
terraingeschoß mit Bauwich (Nr. 9-13, Nr. 19
als einziges Haus eingeschossig). Dieser
Straßenabschnitt führt in seiner Einheit aus
den im Landhausstil entworfenen Putzgebäu-
den mit ihren Vorgärten, dem Klinkerbelag
des Gehwegs, dem Kopfsteinpflaster der
Straße und dem begrenzenden, mit Rhodo-
dendren bepflanzten Grünstreifen am Hun-
teufer exemplarisch die zeitgenössische
Konzeption eines Wohngebiets gehobenen
Standards vor. Eine Einschränkung erfährt
dieses Bild durch den viergeschossigen Neu-
bau Nr. 11 und die an einigen Häusern vorge-
nommenen Detailveränderungen. Mit Aus-
nahme des Hauses Nr. 17 (erb. 1908, Arch.
Gebr. Barkemeyer) wurden sie alle durch L.
Freytag in der zeittypischen lebhaften Bau-
körpergruppierung unter Walm- oder Man-
sarddächern errichtet. Dem irregulären Grun-
driß folgt die asymmetrische Aufrißform durch
außermittig gesetzte Risalite, eingeschossige
Vorbauten, Balkons usw., wobei den einzel-
nen Bauteilen verschiedene Dachformen zu-
geordnet werden. Aus diesem Entwurfsmo-
dus resultiert eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten, die jedem Haus trotz gemein-
samer stilistischer Grundhaltung eine indivi-
duelle Note verleiht. Sie wird bei der Durchbil-
dung der Detailformen intensiviert, indem
z. B., besonders variationsreich an Haus Nr. 9
(erb. 1906), die Fenster in unterschiedlicher
Größe, Gruppierung und Form eingesetzt
werden. Der sparsam, allenfalls in den Fen-
sterzonen verwendete Putzdekor läßt trotz
der deutlichen Abkehr vom Historismus z.T.
historische Anklänge zu, so z.B. zeigt das
Haus Nr. 16 mit dem Ochsenauge und den
von ihm ausgehenden Girlanden ein barocki-
sierendes Motiv. Dagegen sind die Rahmen
an den Häusern Nr. 13 (erb. 1906) und Nr. 17
mit geometrischen Ornamenten des Jugend-
stils geschmückt. Die ebenfalls für den Land-
hausstil charakteristische differenzierte
Oberflächenbehandlung mit unterschiedli-
chen Materialien wie Putz, Sandstein und
Fachwerk oder dem Wechsel zwischen glat-
ten und rauhen Putzflächen ist innerhalb die-
ser Gruppe wegen jüngerer Renovierungen
nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Das
Nebeneinander von rauhen Putzflächen und
rahmenden, glatt verputzten Streifen demon-
Elisabethstr. 14, 1908; Nr. 13, 12, 1906, alle L. Freytag
Elisabethstr. 7, Landgericht, 1857-59, Architekt
H.D. Hillerns
Elisabethstr. 17, 18, beide 1909; 19, 1910, alle L.
Freytag
Elisabethstr. 9, 1906, Architekt L. Freytag; Nr. 10
122