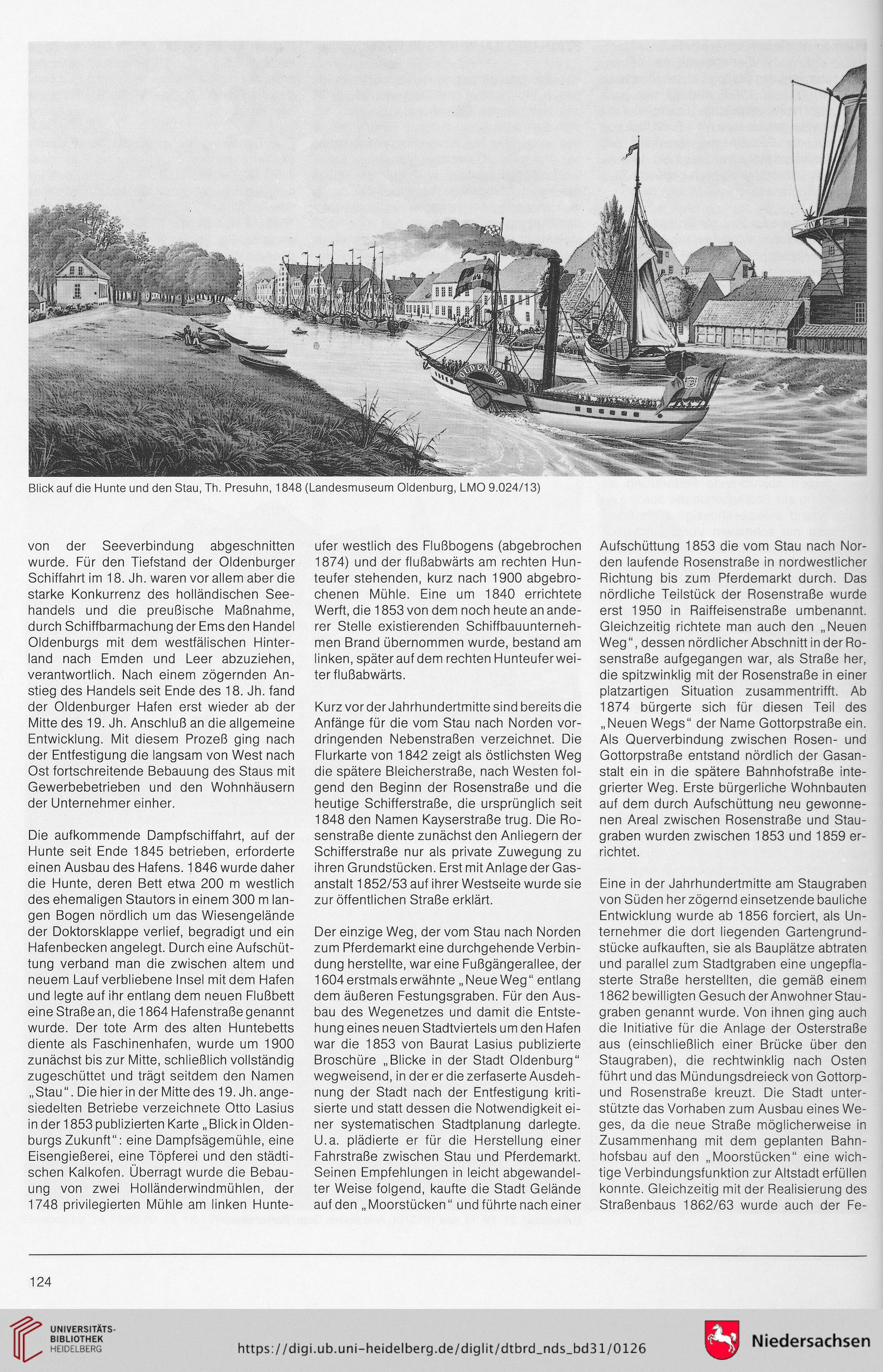Blick auf die Hunte und den Stau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/13)
von der Seeverbindung abgeschnitten
wurde. Für den Tiefstand der Oldenburger
Schiffahrt im 18. Jh. waren vor allem aber die
starke Konkurrenz des holländischen See-
handels und die preußische Maßnahme,
durch Schiffbarmachung der Ems den Handel
Oldenburgs mit dem westfälischen Hinter-
land nach Emden und Leer abzuziehen,
verantwortlich. Nach einem zögernden An-
stieg des Handels seit Ende des 18. Jh. fand
der Oldenburger Hafen erst wieder ab der
Mitte des 19. Jh. Anschluß an die allgemeine
Entwicklung. Mit diesem Prozeß ging nach
der Entfestigung die langsam von West nach
Ost fortschreitende Bebauung des Staus mit
Gewerbebetrieben und den Wohnhäusern
der Unternehmer einher.
Die aufkommende Dampfschiffahrt, auf der
Hunte seit Ende 1845 betrieben, erforderte
einen Ausbau des Hafens. 1846 wurde daher
die Hunte, deren Bett etwa 200 m westlich
des ehemaligen Stautors in einem 300 m lan-
gen Bogen nördlich um das Wiesengelände
der Doktorsklappe verlief, begradigt und ein
Hafenbecken angelegt. Durch eine Aufschüt-
tung verband man die zwischen altem und
neuem Lauf verbliebene Insel mit dem Hafen
und legte auf ihr entlang dem neuen Flußbett
eine Straße an, die 1864 Hafenstraße genannt
wurde. Der tote Arm des alten Huntebetts
diente als Faschinenhafen, wurde um 1900
zunächst bis zur Mitte, schließlich vollständig
zugeschüttet und trägt seitdem den Namen
„Stau“. Die hierin der Mitte des 19. Jh. ange-
siedelten Betriebe verzeichnete Otto Lasius
in der 1853 publizierten Karte „ Blick in Olden-
burgs Zukunft“: eine Dampfsägemühle, eine
Eisengießerei, eine Töpferei und den städti-
schen Kalkofen. Überragt wurde die Bebau-
ung von zwei Holländerwindmühlen, der
1748 privilegierten Mühle am linken Hunte-
ufer westlich des Flußbogens (abgebrochen
1874) und der flußabwärts am rechten Hun-
teufer stehenden, kurz nach 1900 abgebro-
chenen Mühle. Eine um 1840 errichtete
Werft, die 1853 von dem noch heute an ande-
rer Stelle existierenden Schiffbauunterneh-
men Brand übernommen wurde, bestand am
linken, späterauf dem rechten Hunteuferwei-
ter flußabwärts.
Kurz vor der Jahrhundertmitte sind bereits die
Anfänge für die vom Stau nach Norden vor-
dringenden Nebenstraßen verzeichnet. Die
Flurkarte von 1842 zeigt als östlichsten Weg
die spätere Bleicherstraße, nach Westen fol-
gend den Beginn der Rosenstraße und die
heutige Schifferstraße, die ursprünglich seit
1848 den Namen Kayserstraße trug. Die Ro-
senstraße diente zunächst den Anliegern der
Schifferstraße nur als private Zuwegung zu
ihren Grundstücken. Erst mit Anlage der Gas-
anstalt 1852/53 auf ihrer Westseite wurde sie
zur öffentlichen Straße erklärt.
Der einzige Weg, der vom Stau nach Norden
zum Pferdemarkt eine durchgehende Verbin-
dung herstellte, war eine Fußgängerallee, der
1604 erstmals erwähnte „ Neue Weg “ entlang
dem äußeren Festungsgraben. Für den Aus-
bau des Wegenetzes und damit die Entste-
hung eines neuen Stadtviertels um den Hafen
war die 1853 von Baurat Lasius publizierte
Broschüre „Blicke in der Stadt Oldenburg“
wegweisend, in der er die zerfaserte Ausdeh-
nung der Stadt nach der Entfestigung kriti-
sierte und statt dessen die Notwendigkeit ei-
ner systematischen Stadtplanung darlegte.
U.a. plädierte er für die Herstellung einer
Fahrstraße zwischen Stau und Pferdemarkt.
Seinen Empfehlungen in leicht abgewandel-
ter Weise folgend, kaufte die Stadt Gelände
auf den „Moorstücken“ und führte nach einer
Aufschüttung 1853 die vom Stau nach Nor-
den laufende Rosenstraße in nordwestlicher
Richtung bis zum Pferdemarkt durch. Das
nördliche Teilstück der Rosenstraße wurde
erst 1950 in Raiffeisenstraße umbenannt.
Gleichzeitig richtete man auch den „Neuen
Weg“, dessen nördlicher Abschnitt in der Ro-
senstraße aufgegangen war, als Straße her,
die spitzwinklig mit der Rosenstraße in einer
platzartigen Situation zusammentrifft. Ab
1874 bürgerte sich für diesen Teil des
„Neuen Wegs“ der Name Gottorpstraße ein.
Als Querverbindung zwischen Rosen- und
Gottorpstraße entstand nördlich der Gasan-
stalt ein in die spätere Bahnhofstraße inte-
grierter Weg. Erste bürgerliche Wohnbauten
auf dem durch Aufschüttung neu gewonne-
nen Areal zwischen Rosenstraße und Stau-
graben wurden zwischen 1853 und 1859 er-
richtet.
Eine in der Jahrhundertmitte am Staugraben
von Süden her zögernd einsetzende bauliche
Entwicklung wurde ab 1856 forciert, als Un-
ternehmer die dort liegenden Gartengrund-
stücke aufkauften, sie als Bauplätze abtraten
und parallel zum Stadtgraben eine ungepfla-
sterte Straße herstellten, die gemäß einem
1862 bewilligten Gesuch der Anwohner Stau-
graben genannt wurde. Von ihnen ging auch
die Initiative für die Anlage der Osterstraße
aus (einschließlich einer Brücke über den
Staugraben), die rechtwinklig nach Osten
führt und das Mündungsdreieck von Gottorp-
und Rosenstraße kreuzt. Die Stadt unter-
stützte das Vorhaben zum Ausbau eines We-
ges, da die neue Straße möglicherweise in
Zusammenhang mit dem geplanten Bahn-
hofsbau auf den „Moorstücken“ eine wich-
tige Verbindungsfunktion zur Altstadt erfüllen
konnte. Gleichzeitig mit der Realisierung des
Straßenbaus 1862/63 wurde auch der Fe-
124
von der Seeverbindung abgeschnitten
wurde. Für den Tiefstand der Oldenburger
Schiffahrt im 18. Jh. waren vor allem aber die
starke Konkurrenz des holländischen See-
handels und die preußische Maßnahme,
durch Schiffbarmachung der Ems den Handel
Oldenburgs mit dem westfälischen Hinter-
land nach Emden und Leer abzuziehen,
verantwortlich. Nach einem zögernden An-
stieg des Handels seit Ende des 18. Jh. fand
der Oldenburger Hafen erst wieder ab der
Mitte des 19. Jh. Anschluß an die allgemeine
Entwicklung. Mit diesem Prozeß ging nach
der Entfestigung die langsam von West nach
Ost fortschreitende Bebauung des Staus mit
Gewerbebetrieben und den Wohnhäusern
der Unternehmer einher.
Die aufkommende Dampfschiffahrt, auf der
Hunte seit Ende 1845 betrieben, erforderte
einen Ausbau des Hafens. 1846 wurde daher
die Hunte, deren Bett etwa 200 m westlich
des ehemaligen Stautors in einem 300 m lan-
gen Bogen nördlich um das Wiesengelände
der Doktorsklappe verlief, begradigt und ein
Hafenbecken angelegt. Durch eine Aufschüt-
tung verband man die zwischen altem und
neuem Lauf verbliebene Insel mit dem Hafen
und legte auf ihr entlang dem neuen Flußbett
eine Straße an, die 1864 Hafenstraße genannt
wurde. Der tote Arm des alten Huntebetts
diente als Faschinenhafen, wurde um 1900
zunächst bis zur Mitte, schließlich vollständig
zugeschüttet und trägt seitdem den Namen
„Stau“. Die hierin der Mitte des 19. Jh. ange-
siedelten Betriebe verzeichnete Otto Lasius
in der 1853 publizierten Karte „ Blick in Olden-
burgs Zukunft“: eine Dampfsägemühle, eine
Eisengießerei, eine Töpferei und den städti-
schen Kalkofen. Überragt wurde die Bebau-
ung von zwei Holländerwindmühlen, der
1748 privilegierten Mühle am linken Hunte-
ufer westlich des Flußbogens (abgebrochen
1874) und der flußabwärts am rechten Hun-
teufer stehenden, kurz nach 1900 abgebro-
chenen Mühle. Eine um 1840 errichtete
Werft, die 1853 von dem noch heute an ande-
rer Stelle existierenden Schiffbauunterneh-
men Brand übernommen wurde, bestand am
linken, späterauf dem rechten Hunteuferwei-
ter flußabwärts.
Kurz vor der Jahrhundertmitte sind bereits die
Anfänge für die vom Stau nach Norden vor-
dringenden Nebenstraßen verzeichnet. Die
Flurkarte von 1842 zeigt als östlichsten Weg
die spätere Bleicherstraße, nach Westen fol-
gend den Beginn der Rosenstraße und die
heutige Schifferstraße, die ursprünglich seit
1848 den Namen Kayserstraße trug. Die Ro-
senstraße diente zunächst den Anliegern der
Schifferstraße nur als private Zuwegung zu
ihren Grundstücken. Erst mit Anlage der Gas-
anstalt 1852/53 auf ihrer Westseite wurde sie
zur öffentlichen Straße erklärt.
Der einzige Weg, der vom Stau nach Norden
zum Pferdemarkt eine durchgehende Verbin-
dung herstellte, war eine Fußgängerallee, der
1604 erstmals erwähnte „ Neue Weg “ entlang
dem äußeren Festungsgraben. Für den Aus-
bau des Wegenetzes und damit die Entste-
hung eines neuen Stadtviertels um den Hafen
war die 1853 von Baurat Lasius publizierte
Broschüre „Blicke in der Stadt Oldenburg“
wegweisend, in der er die zerfaserte Ausdeh-
nung der Stadt nach der Entfestigung kriti-
sierte und statt dessen die Notwendigkeit ei-
ner systematischen Stadtplanung darlegte.
U.a. plädierte er für die Herstellung einer
Fahrstraße zwischen Stau und Pferdemarkt.
Seinen Empfehlungen in leicht abgewandel-
ter Weise folgend, kaufte die Stadt Gelände
auf den „Moorstücken“ und führte nach einer
Aufschüttung 1853 die vom Stau nach Nor-
den laufende Rosenstraße in nordwestlicher
Richtung bis zum Pferdemarkt durch. Das
nördliche Teilstück der Rosenstraße wurde
erst 1950 in Raiffeisenstraße umbenannt.
Gleichzeitig richtete man auch den „Neuen
Weg“, dessen nördlicher Abschnitt in der Ro-
senstraße aufgegangen war, als Straße her,
die spitzwinklig mit der Rosenstraße in einer
platzartigen Situation zusammentrifft. Ab
1874 bürgerte sich für diesen Teil des
„Neuen Wegs“ der Name Gottorpstraße ein.
Als Querverbindung zwischen Rosen- und
Gottorpstraße entstand nördlich der Gasan-
stalt ein in die spätere Bahnhofstraße inte-
grierter Weg. Erste bürgerliche Wohnbauten
auf dem durch Aufschüttung neu gewonne-
nen Areal zwischen Rosenstraße und Stau-
graben wurden zwischen 1853 und 1859 er-
richtet.
Eine in der Jahrhundertmitte am Staugraben
von Süden her zögernd einsetzende bauliche
Entwicklung wurde ab 1856 forciert, als Un-
ternehmer die dort liegenden Gartengrund-
stücke aufkauften, sie als Bauplätze abtraten
und parallel zum Stadtgraben eine ungepfla-
sterte Straße herstellten, die gemäß einem
1862 bewilligten Gesuch der Anwohner Stau-
graben genannt wurde. Von ihnen ging auch
die Initiative für die Anlage der Osterstraße
aus (einschließlich einer Brücke über den
Staugraben), die rechtwinklig nach Osten
führt und das Mündungsdreieck von Gottorp-
und Rosenstraße kreuzt. Die Stadt unter-
stützte das Vorhaben zum Ausbau eines We-
ges, da die neue Straße möglicherweise in
Zusammenhang mit dem geplanten Bahn-
hofsbau auf den „Moorstücken“ eine wich-
tige Verbindungsfunktion zur Altstadt erfüllen
konnte. Gleichzeitig mit der Realisierung des
Straßenbaus 1862/63 wurde auch der Fe-
124