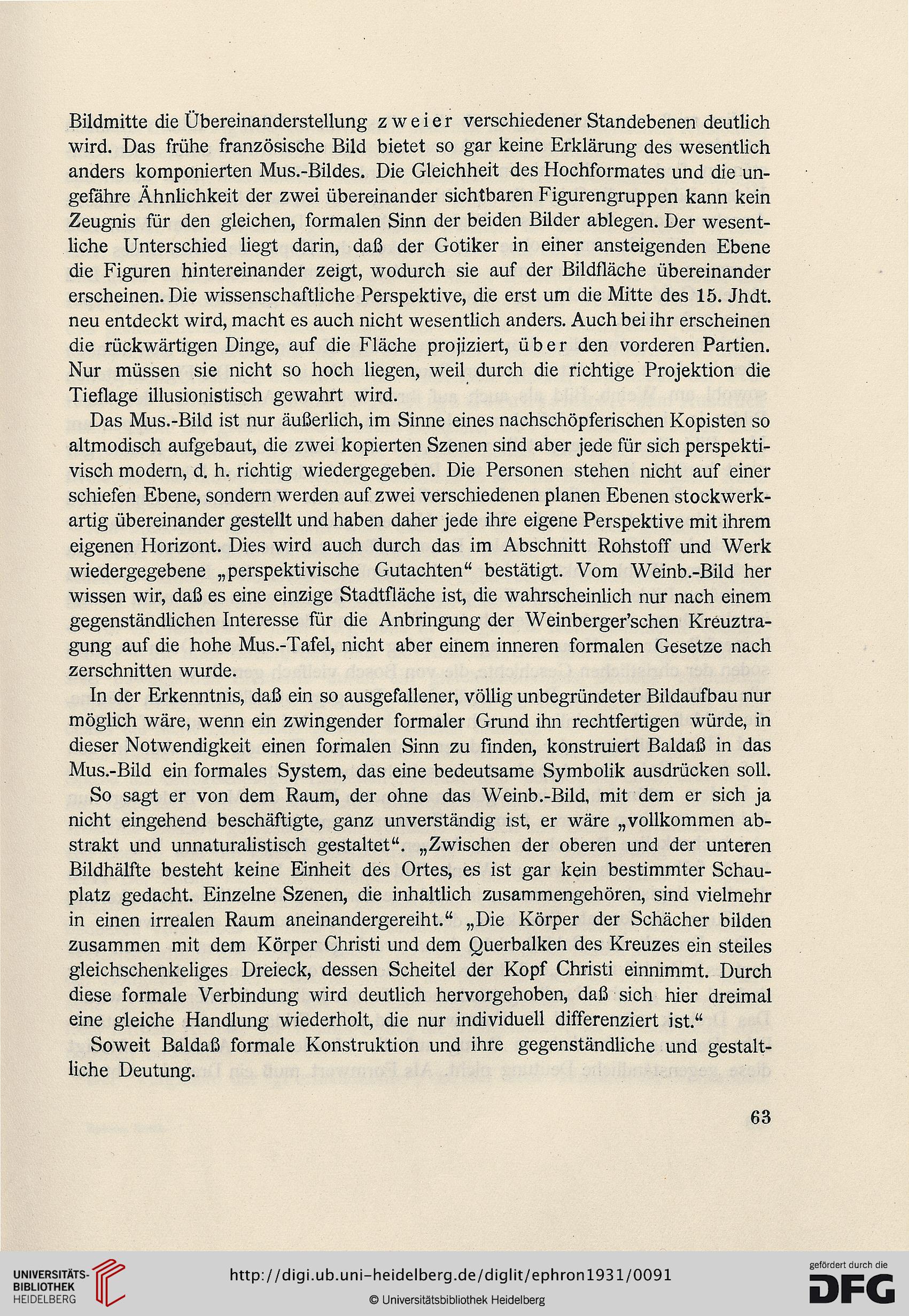Bildmitte die Übereinanderstellung z w e i e r verschiedener Standebenen deutlich
wird. Das frühe französische Bild bietet so gar keine Erklärung des wesentlich
anders komponierten Mus.-Bildes. Die Gleichheit des Hochformates und die un-
gefähre Ähnlichkeit der zwei übereinander sichtbaren Figurengruppen kann kein
Zeugnis für den gleichen, formalen Sinn der beiden Bilder ablegen. Der wesent-
liche Unterschied liegt darin, daß der Gotiker in einer ansteigenden Ebene
die Figuren hintereinander zeigt, wodurch sie auf der Bildfläche übereinander
erscheinen. Die wissenschaftliche Perspektive, die erst um die Mitte des 15. Jhdt.
neu entdeckt wird, macht es auch nicht wesentlich anders. Auch bei ihr erscheinen
die rückwärtigen Dinge, auf die Fläche projiziert, über den vorderen Partien.
Nur müssen sie nicht so hoch liegen, weil durch die richtige Projektion die
Tieflage illusionistisch gewahrt wird.
Das Mus.-Bild ist nur äußerlich, im Sinne eines nachschöpferischen Kopisten so
altmodisch aufgebaut, die zwei kopierten Szenen sind aber jede für sich perspekti-
visch modern, d. h. richtig wiedergegeben. Die Personen stehen nicht auf einer
schiefen Ebene, sondern werden auf zwei verschiedenen planen Ebenen stockwerk-
artig übereinander gestellt und haben daher jede ihre eigene Perspektive mit ihrem
eigenen Horizont. Dies wird auch durch das im Abschnitt Rohstoff und Werk
wiedergegebene „perspektivische Gutachten“ bestätigt. Vom Weinb.-Bild her
wissen wir, daß es eine einzige Stadtfläche ist, die wahrscheinlich nur nach einem
gegenständlichen Interesse für die Anbringung der Weinberger’schen Kreuztra-
gung auf die hohe Mus.-Tafel, nicht aber einem inneren formalen Gesetze nach
zerschnitten wurde.
In der Erkenntnis, daß ein so ausgefallener, völlig unbegründeter Bildaufbau nur
möglich wäre, wenn ein zwingender formaler Grund ihn rechtfertigen würde, in
dieser Notwendigkeit einen formalen Sinn zu finden, konstruiert Baldaß in das
Mus.-Bild ein formales System, das eine bedeutsame Symbolik ausdrücken soll.
So sagt er von dem Raum, der ohne das Weinb.-Bild, mit dem er sich ja
nicht eingehend beschäftigte, ganz unverständig ist, er wäre „vollkommen ab-
strakt und unnaturalistisch gestaltet“. „Zwischen der oberen und der unteren
Bildhälfte besteht keine Einheit des Ortes, es ist gar kein bestimmter Schau-
platz gedacht. Einzelne Szenen, die inhaltlich zusammengehören, sind vielmehr
in einen irrealen Raum aneinandergereiht.“ „Die Körper der Schächer bilden
zusammen mit dem Körper Christi und dem Querbalken des Kreuzes ein steiles
gleichschenkeliges Dreieck, dessen Scheitel der Kopf Christi einnimmt. Durch
diese formale Verbindung wird deutlich hervorgehoben, daß sich hier dreimal
eine gleiche Handlung wiederholt, die nur individuell differenziert ist.“
Soweit Baldaß formale Konstruktion und ihre gegenständliche und gestalt-
liche Deutung.
63
wird. Das frühe französische Bild bietet so gar keine Erklärung des wesentlich
anders komponierten Mus.-Bildes. Die Gleichheit des Hochformates und die un-
gefähre Ähnlichkeit der zwei übereinander sichtbaren Figurengruppen kann kein
Zeugnis für den gleichen, formalen Sinn der beiden Bilder ablegen. Der wesent-
liche Unterschied liegt darin, daß der Gotiker in einer ansteigenden Ebene
die Figuren hintereinander zeigt, wodurch sie auf der Bildfläche übereinander
erscheinen. Die wissenschaftliche Perspektive, die erst um die Mitte des 15. Jhdt.
neu entdeckt wird, macht es auch nicht wesentlich anders. Auch bei ihr erscheinen
die rückwärtigen Dinge, auf die Fläche projiziert, über den vorderen Partien.
Nur müssen sie nicht so hoch liegen, weil durch die richtige Projektion die
Tieflage illusionistisch gewahrt wird.
Das Mus.-Bild ist nur äußerlich, im Sinne eines nachschöpferischen Kopisten so
altmodisch aufgebaut, die zwei kopierten Szenen sind aber jede für sich perspekti-
visch modern, d. h. richtig wiedergegeben. Die Personen stehen nicht auf einer
schiefen Ebene, sondern werden auf zwei verschiedenen planen Ebenen stockwerk-
artig übereinander gestellt und haben daher jede ihre eigene Perspektive mit ihrem
eigenen Horizont. Dies wird auch durch das im Abschnitt Rohstoff und Werk
wiedergegebene „perspektivische Gutachten“ bestätigt. Vom Weinb.-Bild her
wissen wir, daß es eine einzige Stadtfläche ist, die wahrscheinlich nur nach einem
gegenständlichen Interesse für die Anbringung der Weinberger’schen Kreuztra-
gung auf die hohe Mus.-Tafel, nicht aber einem inneren formalen Gesetze nach
zerschnitten wurde.
In der Erkenntnis, daß ein so ausgefallener, völlig unbegründeter Bildaufbau nur
möglich wäre, wenn ein zwingender formaler Grund ihn rechtfertigen würde, in
dieser Notwendigkeit einen formalen Sinn zu finden, konstruiert Baldaß in das
Mus.-Bild ein formales System, das eine bedeutsame Symbolik ausdrücken soll.
So sagt er von dem Raum, der ohne das Weinb.-Bild, mit dem er sich ja
nicht eingehend beschäftigte, ganz unverständig ist, er wäre „vollkommen ab-
strakt und unnaturalistisch gestaltet“. „Zwischen der oberen und der unteren
Bildhälfte besteht keine Einheit des Ortes, es ist gar kein bestimmter Schau-
platz gedacht. Einzelne Szenen, die inhaltlich zusammengehören, sind vielmehr
in einen irrealen Raum aneinandergereiht.“ „Die Körper der Schächer bilden
zusammen mit dem Körper Christi und dem Querbalken des Kreuzes ein steiles
gleichschenkeliges Dreieck, dessen Scheitel der Kopf Christi einnimmt. Durch
diese formale Verbindung wird deutlich hervorgehoben, daß sich hier dreimal
eine gleiche Handlung wiederholt, die nur individuell differenziert ist.“
Soweit Baldaß formale Konstruktion und ihre gegenständliche und gestalt-
liche Deutung.
63