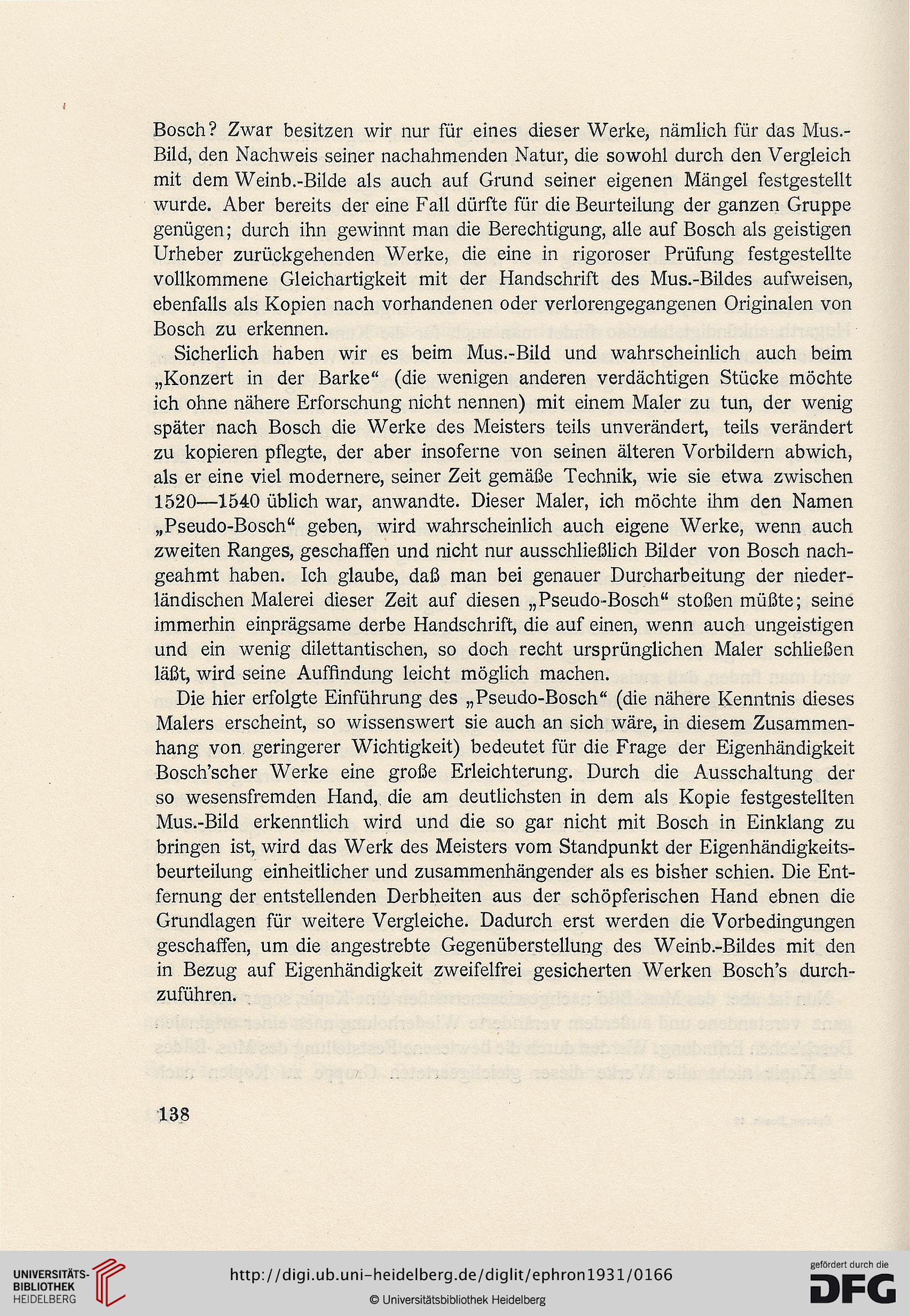Bosch? Zwar besitzen wir nur für eines dieser Werke, nämlich für das Mus.-
Bild, den Nachweis seiner nachahmenden Natur, die sowohl durch den Vergleich
mit dem Weinb.-Bilde als auch auf Grund seiner eigenen Mängel festgestellt
wurde. Aber bereits der eine Fall dürfte für die Beurteilung der ganzen Gruppe
genügen; durch ihn gewinnt man die Berechtigung, alle auf Bosch als geistigen
Urheber zurückgehenden Werke, die eine in rigoroser Prüfung festgestellte
vollkommene Gleichartigkeit mit der Handschrift des Mus.-Bildes aufweisen,
ebenfalls als Kopien nach vorhandenen oder verlorengegangenen Originalen von
Bosch zu erkennen.
Sicherlich haben wir es beim Mus.-Biid und wahrscheinlich auch beim
„Konzert in der Barke“ (die wenigen anderen verdächtigen Stücke möchte
ich ohne nähere Erforschung nicht nennen) mit einem Maler zu tun, der wenig
später nach Bosch die Werke des Meisters teils unverändert, teils verändert
zu kopieren pflegte, der aber insoferne von seinen älteren Vorbildern abwich,
als er eine viel modernere, seiner Zeit gemäße Technik, wie sie etwa zwischen
1520—1540 üblich war, anwandte. Dieser Maler, ich möchte ihm den Namen
„Pseudo-Bosch“ geben, wird wahrscheinlich auch eigene Werke, wenn auch
zweiten Ranges, geschaffen und nicht nur ausschließlich Bilder von Bosch nach-
geahmt haben. Ich glaube, daß man bei genauer Durcharbeitung der nieder-
ländischen Malerei dieser Zeit auf diesen „Pseudo-Bosch“ stoßen müßte; seine
immerhin einprägsame derbe Handschrift, die auf einen, wenn auch ungeistigen
und ein wenig dilettantischen, so doch recht ursprünglichen Maler schließen
läßt, wird seine Auffindung leicht möglich machen.
Die hier erfolgte Einführung des „Pseudo-Bosch“ (die nähere Kenntnis dieses
Malers erscheint, so wissenswert sie auch an sich wäre, in diesem Zusammen-
hang von geringerer Wichtigkeit) bedeutet für die Frage der Eigenhändigkeit
Bosch’scher Werke eine große Erleichterung. Durch die Ausschaltung der
so wesensfremden Hand, die am deutlichsten in dem als Kopie festgestellten
Mus.-Bild erkenntlich wird und die so gar nicht mit Bosch in Einklang zu
bringen ist, wird das Werk des Meisters vom Standpunkt der Eigenhändigkeits-
beurteilung einheitlicher und zusammenhängender als es bisher schien. Die Ent-
fernung der entstellenden Derbheiten aus der schöpferischen Hand ebnen die
Grundlagen für weitere Vergleiche. Dadurch erst werden die Vorbedingungen
geschaffen, um die angestrebte Gegenüberstellung des Weinb.-Bildes mit den
in Bezug auf Eigenhändigkeit zweifelfrei gesicherten Werken Bosch’s durch-
zuführen.
138
Bild, den Nachweis seiner nachahmenden Natur, die sowohl durch den Vergleich
mit dem Weinb.-Bilde als auch auf Grund seiner eigenen Mängel festgestellt
wurde. Aber bereits der eine Fall dürfte für die Beurteilung der ganzen Gruppe
genügen; durch ihn gewinnt man die Berechtigung, alle auf Bosch als geistigen
Urheber zurückgehenden Werke, die eine in rigoroser Prüfung festgestellte
vollkommene Gleichartigkeit mit der Handschrift des Mus.-Bildes aufweisen,
ebenfalls als Kopien nach vorhandenen oder verlorengegangenen Originalen von
Bosch zu erkennen.
Sicherlich haben wir es beim Mus.-Biid und wahrscheinlich auch beim
„Konzert in der Barke“ (die wenigen anderen verdächtigen Stücke möchte
ich ohne nähere Erforschung nicht nennen) mit einem Maler zu tun, der wenig
später nach Bosch die Werke des Meisters teils unverändert, teils verändert
zu kopieren pflegte, der aber insoferne von seinen älteren Vorbildern abwich,
als er eine viel modernere, seiner Zeit gemäße Technik, wie sie etwa zwischen
1520—1540 üblich war, anwandte. Dieser Maler, ich möchte ihm den Namen
„Pseudo-Bosch“ geben, wird wahrscheinlich auch eigene Werke, wenn auch
zweiten Ranges, geschaffen und nicht nur ausschließlich Bilder von Bosch nach-
geahmt haben. Ich glaube, daß man bei genauer Durcharbeitung der nieder-
ländischen Malerei dieser Zeit auf diesen „Pseudo-Bosch“ stoßen müßte; seine
immerhin einprägsame derbe Handschrift, die auf einen, wenn auch ungeistigen
und ein wenig dilettantischen, so doch recht ursprünglichen Maler schließen
läßt, wird seine Auffindung leicht möglich machen.
Die hier erfolgte Einführung des „Pseudo-Bosch“ (die nähere Kenntnis dieses
Malers erscheint, so wissenswert sie auch an sich wäre, in diesem Zusammen-
hang von geringerer Wichtigkeit) bedeutet für die Frage der Eigenhändigkeit
Bosch’scher Werke eine große Erleichterung. Durch die Ausschaltung der
so wesensfremden Hand, die am deutlichsten in dem als Kopie festgestellten
Mus.-Bild erkenntlich wird und die so gar nicht mit Bosch in Einklang zu
bringen ist, wird das Werk des Meisters vom Standpunkt der Eigenhändigkeits-
beurteilung einheitlicher und zusammenhängender als es bisher schien. Die Ent-
fernung der entstellenden Derbheiten aus der schöpferischen Hand ebnen die
Grundlagen für weitere Vergleiche. Dadurch erst werden die Vorbedingungen
geschaffen, um die angestrebte Gegenüberstellung des Weinb.-Bildes mit den
in Bezug auf Eigenhändigkeit zweifelfrei gesicherten Werken Bosch’s durch-
zuführen.
138