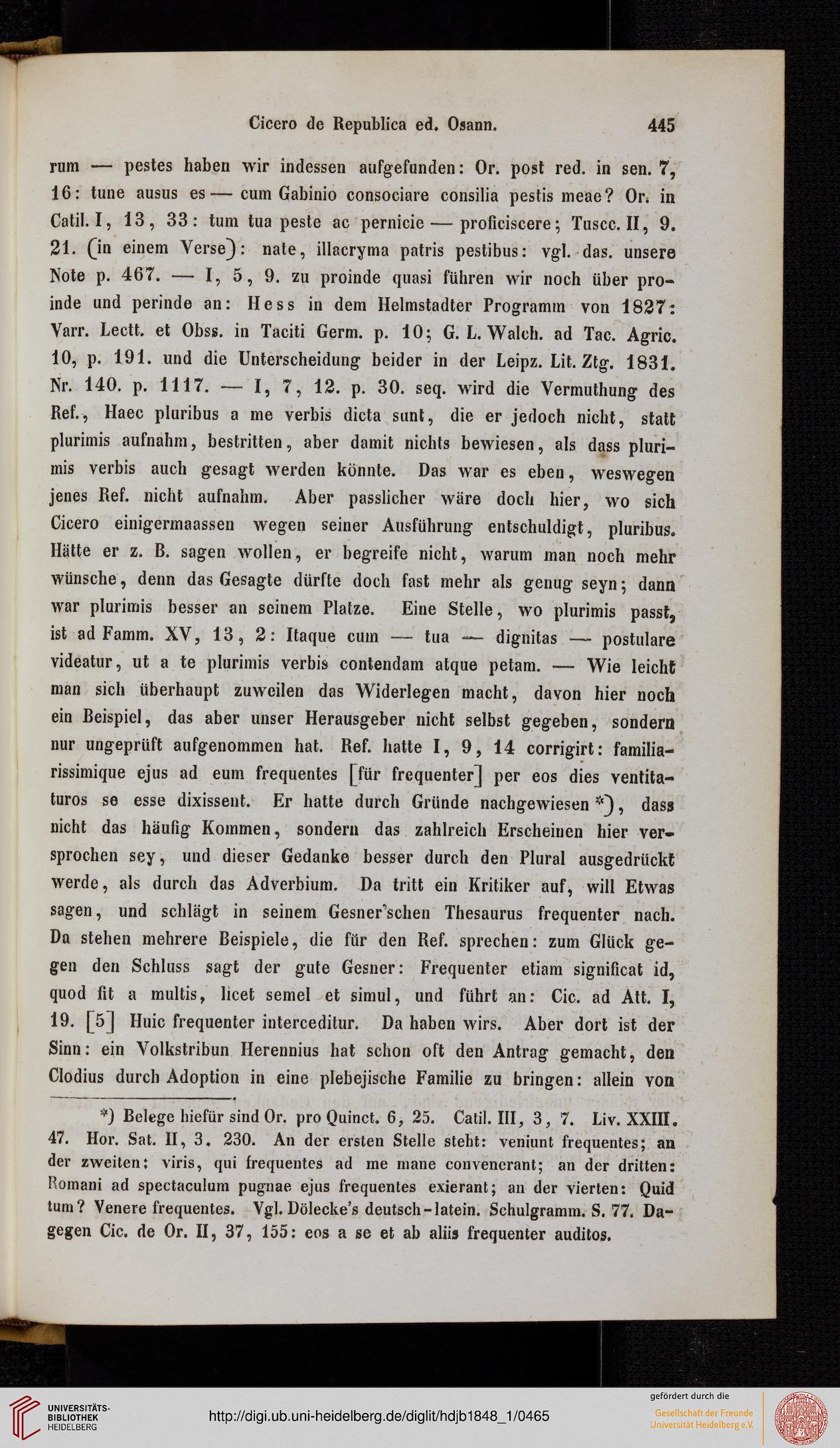Cicero de Republica ed. Osann.
445
rum — pestes haben wir indessen aufgefunden: Or. post red. in sen. 7,
16: tune ausus es— cum Gabinio consociare consilia pestis meae? Or. in
Catil. I, 13, 33: tum tua peste ac pernicie — proficiscere; Tuscc. II, 9.
21. (in einem Verse}: nate, illacryma patris pestibus: vgl. das. unsere
Note p. 467. — I, 5, 9. zu proinde quasi führen wir noch über pro-
inde und perinde an: Hess in dem Helmstadter Programm von 1827:
Varr. Lectt. et Obss. in Taciti Germ. p. 10; G. L. Walch, ad Tac. Agric.
10, p. 191. und die Unterscheidung beider in der Leipz. Lit. Ztg. 1831.
Nr. 140. p. 1117. — I, 7, 12. p. 30. seq. wird die Vermuthung des
Ref., Haec pluribus a me verbis dicta sunt, die er jedoch nicht, statt
plurimis aufnahm, bestritten, aber damit nichts bewiesen, als dass pluri-
mis verbis auch gesagt werden könnte. Das war es eben, weswegen
jenes Ref. nicht aufnahm. Aber passlicher wäre doch hier, wo sich
Cicero einigermaassen wegen seiner Ausführung entschuldigt, pluribus.
Hätte er z. B. sagen wollen, er begreife nicht, warum man noch mehr
wünsche, denn das Gesagte dürfte doch fast mehr als genug seyn; dann
war plurimis besser an seinem Platze. Eine Stelle, wo plurimis passt,
ist ad Famm. XV, 13, 2: Itaque cum — tua — dignitas — postulare
videatur, ut a te plurimis verbis contendam atque petam. — Wie leicht
man sich überhaupt zuweilen das Widerlegen macht, davon hier noch
ein Beispiel, das aber unser Herausgeber nicht selbst gegeben, sondern
nur ungeprüft aufgenommen hat. Ref. hatte I, 9, 14 corrigirt: familia-
rissimique ejus ad eum frequentes [für frequenter] per eos dies ventita-
turos se esse dixissent. Er hatte durch Gründe nachgewiesen , dass
nicht das häufig Kommen, sondern das zahlreich Erscheinen hier ver-
sprochen sey, und dieser Gedanke besser durch den Plural ausgedrückt
werde, als durch das Adverbium. Da tritt ein Kritiker auf, will Etwas
sagen, und schlägt in seinem Gesner’schen Thesaurus frequenter nach.
Da stehen mehrere Beispiele, die für den Ref. sprechen: zum Glück ge-
gen den Schluss sagt der gute Gesner: Frequenter etiam significat id,
quod fit a multis, licet semel et simul, und führt an: Cic. ad Att. I,
19. [5] Huie frequenter interceditur. Da haben wirs. Aber dort ist der
Sinn: ein Volkstribun Herennius hat schon oft den Antrag gemacht, den
Clodius durch Adoption in eine plebejische Familie zu bringen: allein von
*) Belege hiefür sind Or. pro Quinct. 6, 25. Catil. III, 3, 7. Liv. XXIII.
47. Hör. Sat. II, 3. 230. An der ersten Stelle steht: veniunt frequentes; an
der zweiten: viris, qui frequentes ad me mane convenerant; an der dritten:
Romani ad spectaculum pugnae ejus frequentes exierant; an der vierten: Quid
tum? Venere frequentes. Vgl. Dölecke’s deutsch-latein. Schulgramm. S. 77. Da-
gegen Cic. de Or. II, 37, 155: eos a se et ab aliis frequenter auditos.
445
rum — pestes haben wir indessen aufgefunden: Or. post red. in sen. 7,
16: tune ausus es— cum Gabinio consociare consilia pestis meae? Or. in
Catil. I, 13, 33: tum tua peste ac pernicie — proficiscere; Tuscc. II, 9.
21. (in einem Verse}: nate, illacryma patris pestibus: vgl. das. unsere
Note p. 467. — I, 5, 9. zu proinde quasi führen wir noch über pro-
inde und perinde an: Hess in dem Helmstadter Programm von 1827:
Varr. Lectt. et Obss. in Taciti Germ. p. 10; G. L. Walch, ad Tac. Agric.
10, p. 191. und die Unterscheidung beider in der Leipz. Lit. Ztg. 1831.
Nr. 140. p. 1117. — I, 7, 12. p. 30. seq. wird die Vermuthung des
Ref., Haec pluribus a me verbis dicta sunt, die er jedoch nicht, statt
plurimis aufnahm, bestritten, aber damit nichts bewiesen, als dass pluri-
mis verbis auch gesagt werden könnte. Das war es eben, weswegen
jenes Ref. nicht aufnahm. Aber passlicher wäre doch hier, wo sich
Cicero einigermaassen wegen seiner Ausführung entschuldigt, pluribus.
Hätte er z. B. sagen wollen, er begreife nicht, warum man noch mehr
wünsche, denn das Gesagte dürfte doch fast mehr als genug seyn; dann
war plurimis besser an seinem Platze. Eine Stelle, wo plurimis passt,
ist ad Famm. XV, 13, 2: Itaque cum — tua — dignitas — postulare
videatur, ut a te plurimis verbis contendam atque petam. — Wie leicht
man sich überhaupt zuweilen das Widerlegen macht, davon hier noch
ein Beispiel, das aber unser Herausgeber nicht selbst gegeben, sondern
nur ungeprüft aufgenommen hat. Ref. hatte I, 9, 14 corrigirt: familia-
rissimique ejus ad eum frequentes [für frequenter] per eos dies ventita-
turos se esse dixissent. Er hatte durch Gründe nachgewiesen , dass
nicht das häufig Kommen, sondern das zahlreich Erscheinen hier ver-
sprochen sey, und dieser Gedanke besser durch den Plural ausgedrückt
werde, als durch das Adverbium. Da tritt ein Kritiker auf, will Etwas
sagen, und schlägt in seinem Gesner’schen Thesaurus frequenter nach.
Da stehen mehrere Beispiele, die für den Ref. sprechen: zum Glück ge-
gen den Schluss sagt der gute Gesner: Frequenter etiam significat id,
quod fit a multis, licet semel et simul, und führt an: Cic. ad Att. I,
19. [5] Huie frequenter interceditur. Da haben wirs. Aber dort ist der
Sinn: ein Volkstribun Herennius hat schon oft den Antrag gemacht, den
Clodius durch Adoption in eine plebejische Familie zu bringen: allein von
*) Belege hiefür sind Or. pro Quinct. 6, 25. Catil. III, 3, 7. Liv. XXIII.
47. Hör. Sat. II, 3. 230. An der ersten Stelle steht: veniunt frequentes; an
der zweiten: viris, qui frequentes ad me mane convenerant; an der dritten:
Romani ad spectaculum pugnae ejus frequentes exierant; an der vierten: Quid
tum? Venere frequentes. Vgl. Dölecke’s deutsch-latein. Schulgramm. S. 77. Da-
gegen Cic. de Or. II, 37, 155: eos a se et ab aliis frequenter auditos.