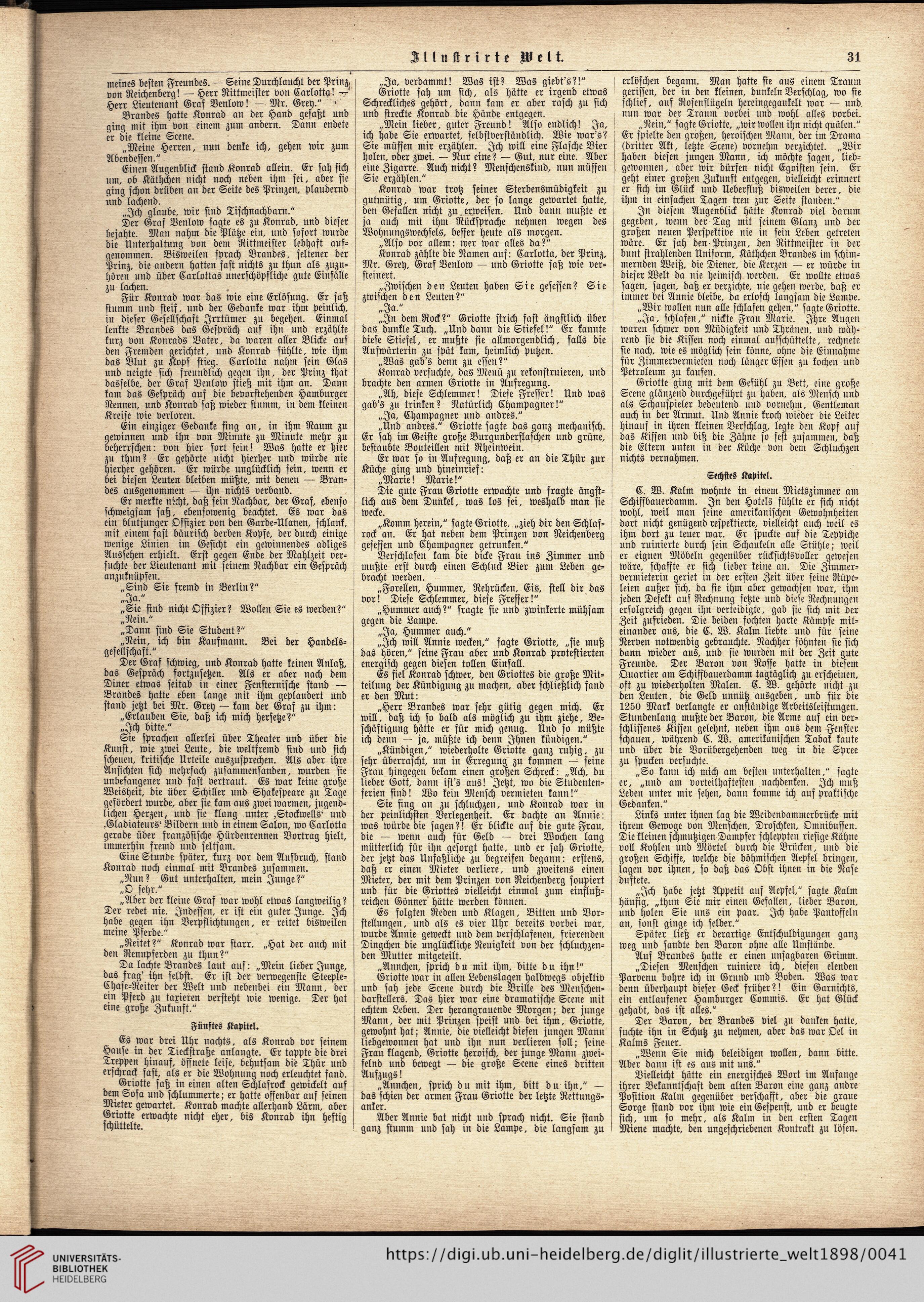Zllnkrirte M e l t.
31
meines besten Freundes. — Seine Durchlaucht der Prinz,
von Reichenberg! — Herr Rittmeister von Carlotty!
Herr Lieutenant Graf Denlow! — Mr. Grey." -
Brandes hatte Konrad an der Hand gefaßt und
ging mit ihm von einem zum andern. Dann endete
er die kleine Scene.
„Meine Herren, nun denke ich, gehen wir zum
Abendessen."
Einen Augenblick stand Konrad allein. Er sah sich
um, ob Käthchen nicht noch neben ihm sei, aber sie
ging schon drüben an der Seite des Prinzen, plaudernd
und lachend.
„Ich glaube, wir sind Tischnachbarn."
Der Graf Venlow sagte es zu Konrad, und dieser
bejahte. Man nahm die Plätze ein, und sofort wurde
die Unterhaltung von dem Rittmeister lebhaft aus-
genommen. Bisweilen sprach Brandes, seltener der
Prinz, die andern hatten fast nichts zu thun als zuzu-
hören und über Carlottas unerschöpfliche gute Einfälle
zu lachen.
Für Konrad war das wie eine Erlösung. Er saß
stumm und steif, und der Gedanke war ihm peinlich,
in dieser Gesellschaft Irrtümer zu begehen. Einmal
lenkte Brandes das Gespräch aus ihn und erzählte
kurz von Konrads Vater, da waren aller Blicke auf
den Fremden gerichtet, und Konrad fühlte, wie ihm
das Blut zu Kopf stieg. Carlotta nahm sein Glas
und neigte sich freundlich gegen ihn, der Prinz that
dasselbe, der Graf Venlow'stieß mit ihm an. Dann
kam das Gespräch aus die bevorstehenden Hamburger
Rennen, und Konrad saß wieder stumm, in dem kleinen
Kreise wie verloren.
Ein einziger Gedanke fing an, in ihm Raum zu
gewinnen und ihn von Minute zu Minute mehr zu
beherrschen: von hier fort sein! Was hatte er hier
zu thun? Er gehörte nicht hierher und würde nie
hierher gehören. Er würde unglücklich sein, wenn er
bei diesen Leuten bleiben müßte, mit denen — Bran-
des ausgenommen — ihn nichts verband.
Er merkte nicht, daß sein Nachbar, der Graf, ebenso
schweigsam saß, ebensowenig beachtet. Es war das
ein blutjunger Offizier von den Garde-Ulanen, schlank,
mit einem fast bäurisch derben Kopse, der durch einige
wenige Linien im Gesicht ein gewinnendes adliges
Aussehen erhielt. Erst gegen Ende der Mahlzeit ver-
suchte der Lieutenant mit seinem Nachbar ein Gespräch
anzuknüpfen.
„Sind Sie fremd in Berlin?"
„Ja."
„Sie sind nicht Offizier? Wollen Sie es werden?"
„Nein."
„Dann sind Sie Student?"
„Nein, ich bin Kaufmann. Bei der Handels-
gesellschaft."
Der Graf schwieg, und Konrad hatte keinen Anlaß,
das Gespräch fortzusetzen. Als er aber nach dem
Diner etwas seitab in einer Fensternische stand —
Brandes hatte eben lange mit ihm geplaudert und
stand jetzt bei Mr. Grey — kam der Graf zu ihm:
„Erlauben Sie, daß ich mich hersetze?"
„Ich bitte."
Sie sprachen allerlei über Theater und über die
Kunst, wie zwei Leute, die weltfremd sind und sich
scheuen, kritische Urteile auszusprechen. Als aber ihre
Ansichten sich mehrfach zusammenfanden, wurden sie
unbefangener und fast vertraut. Es war keine große
Weisheit, die über Schiller und Shakespeare zu Tage
gefördert wurde, aber sie kam aus zwei warmen, jugend-
lichen Herzen, und sie klang unter ,Stockwells' und
Madiateurs' Bildern und in einem Salon, wo Carlotta
gerade über französische Hürdenrennen Vortrag hielt,
immerhin fremd und seltsam.
Eine Stunde später, kurz vor dem Aufbruch, stand
Konrad noch einmal mit Brandes zusammen.
„Nun? Gut unterhalten, mein Junge?"
„O sehr."
„Aber der kleine Graf war wohl etwas langweilig?
Der redet nie. Indessen, er ist ein guter Junge. Ich
habe gegen ihn Verpflichtungen, er reitet bisweilen
meine Pferde."
„Reitet?" Konrad war starr. „Hat der auch mit
den Rennpferden zu thun?"
Da lachte Brandes laut auf: „Mein lieber Junge,
das frag' ihn selbst. Er ist der verwegenste Steeple-
Chase-Reiter der Welt und nebenbei ein Mann, der
ein Pferd zu taxieren versteht wie wenige. Der hat
eine große Zukunft."
Fünftes Kapitel.
Es war drei Uhr nachts, als Konrad vor seinem
Hause in der Tieckstraße anlangte. Er tappte die drei
Treppen hinauf, öffnete leise, behutsam die Thür und
erschrack fast, als er die Wohnung noch erleuchtet fand.
Griotte saß in einen alten Schlafrock gewickelt auf
dem Sofa und schlummerte; er hatte offenbar aus seinen
Mieter gewartet. Konrad machte allerhand Lärm, aber
Griotte erwachte nicht eher, bis Konrad ihn heftig
„Ja, verdammt! Was ist? Was giebt's?!"
Griotte sah um sich, als hätte er irgend etwas
Schreckliches gehört, dann kam er aber rasch zu sich
und streckte Konrad die Hände entgegen.
„Mein lieber, guter Freund! Also endlich! Ja,
ich habe Sie erwartet, selbstverständlich. Wie war's?
Sie müssen mir erzählen. Ich will eine Flasche Bier
holen, oder zwei. — Nur eine? — Gut, nur eine. Aber
eine Zigarre. Auch nicht? Menschenkind, nun müssen
Sie erzählen."
Konrad war trotz seiner Sterbensmüdigkeit zu
gutmütig, um Griotte, der so lange gewartet hatte,
den Gefallen nicht zu erweisen. Und dann mußte er
ja auch mit ihm Rücksprache nehmen wegen des
Wohnungswechsels, besser heute als morgen.
„Also vor allem: wer war alles da?"
Konrad zählte die Namen aus: Carlotta, der Prinz,
Mr. Grey, Graf Venlow — und Griotte saß wie ver-
steinert.
„Zwischen den Leuten haben Sie gesessen? Sie
zwischen den Leuten?"
„Ja."
„In dem Rock?" Griotte strich fast ängstlich über
das dunkle Tuch. „Und dann die Stiesel!" Er kannte
diese Stiefel, er mußte sie allmorgendlich, falls die
Aufwärterin zu spät kam, heimlich putzen.
„Was gab's denn zu essen?"
Konrad versuchte, das Menü zu rekonstruieren, und
brachte den armen Griotte in Aufregung.
„Ah, diese Schlemmer! Diese Fresser! Und was
gab's zu trinken? Natürlich Champagner!"
„Ja, Champagner und andres."
„Und andres." Griotte sagte das ganz mechanisch.
Er sah im Geiste große Burgunderflaschen und grüne,
bestaubte Bouteillen mit Rheinwein.
Er war so in Aufregung, daß er an die Thür zur
Küche ging und hineinrief:
„Marie! Marie!"
Die gute Frau Griotte erwachte und fragte ängst-
lich aus dem Dunkel, was los sei, weshalb man sie
wecke.
„Komm herein," sagte Griotte, „zieh dir den Schlaf-
rock an. Er hat neben dem Prinzen von Reichenberg
gesessen und Champagner getrunken."
Verschlafen kam die dicke Frau ins Zimmer und
mußte erst durch einen Schluck Bier zum Leben ge-
bracht werden.
„Forellen, Hummer, Rehrücken, Eis, stell dir das
vor! Diese Schlemmer, diese Fresser!"
„Hummer auch?" fragte sie und zwinkerte mühsam
gegen die Lampe.
„Ja, Hummer auch."
„Ich will Annie wecken," sagte Griotte, „sie muß
das hören," seine Frau aber und Konrad protestierten
energisch gegen diesen tollen Einfall.
Es fiel Konrad schwer, den Griottes die große Mit-
teilung der Kündigung zu machen, aber schließlich fand
er den Mut:
„Herr Brandes war sehr gütig gegen mich. Er
will, daß ich so bald als möglich zu ihm ziehe, Be-
schäftigung hätte er für mich genug. Und so müßte
ich denn — ja, müßte ich denn Ihnen kündigen."
„Kündigen," wiederholte Griotte ganz ruhig, zu
sehr überrascht, um in Erregung zu kommen — seine
Frau hingegen bekam einen großen Schreck: „Ach, du
lieber Gott, dann ist's aus! Jetzt, wo die Studenten-
ferien sind! Wo kein Mensch vermieten kann!"
Sie fing an zu schluchzen, und Konrad war in
der peinlichsten Verlegenheit. Er dachte an Annie:
was würde die sagen?! Er blickte auf die gute Frau,
die — wenn auch für Geld — drei Wochen lang
mütterlich für ihn gesorgt hatte, und er sah Griotte,
der jetzt das Unsaßliche zu begreifen begann: erstens,
daß er einen Mieter verliere, und zweitens einen
Mieter, der mit dem Prinzen von Reichenberg soupiert
und für die Griottes vielleicht einmal zum einfluß-
reichen Gönner hätte werden können.
Es folgten Reden und Klagen, Bitten und Vor-
stellungen, und als es vier Uhr bereits vorbei war,
wurde Annie geweckt und dem verschlafenen, frierenden
Dingchen die unglückliche Neuigkeit von der schluchzen-
den Mutter mitgeteilt.
„Annchen, sprich du mit ihm, bitte du ihn!"
Griotte war in allen Lebenslagen Halbwegs objektiv
und sah jede Scene durch die Brille des Menschen-
darstellers. Das hier war eine dramatische Scene mit
echtem Leben. Der herangrauende Morgen; der junge
Mann, der mit Prinzen speist und bei ihm, Griotte,
gewohnt hat; Annie, die vielleicht diesen jungen Mann
liebgewonnen hat und ihn nun verlieren soll; seine
Frau klagend, Griotte heroisch, der junge Mann zwei-
felnd und bewegt — die große Scene eines dritten
Aufzugs!
„Annchen, sprich du mit ihm, bitt du ihn," —
das schien der armen Frau Griotte der letzte Rettungs-
anker.
Aber Annie bat nicht und sprach nicht. Sie stand
ganz stumm und sah in die Lampe, die langsam zu
erlöschen begann. Man hatte sie aus einem Traum
gerissen, der in den kleinen, dunkeln Verschlag, wo sie
schlief, auf Rosenflügeln hereingegaukelt war — und.
nun war der Traum vorbei und wohl alles vorbei.
„Nein," sagte Griotte, „wir wollen ihn nicht quälen."
Er spielte den großen, heroischen Mann, der im Drama
(dritter Akt, letzte Scene) vornehm verzichtet. „Wir
haben diesen jungen Mann, ich möchte sagen, lieb-
gewonnen, aber wir dürfen nicht Egoisten sein. Er-
geht einer großen Zukunft entgegen, vielleicht erinnert
er sich im Glück und Ueberfluß bisweilen derer, die
ihm in einfachen Tagen treu zur Seite standen."
In diesem Augenblick hätte Konrad viel darum
gegeben, wenn der Tag mit seinem Glanz und der
großen neuen Perspektive nie in sein Leben getreten
wäre. Er sah den-Prinzen, den Rittmeister in der
bunt strahlenden Uniform, Käthchen Brandes im schim-
mernden Weiß, die Diener, die Kerzen — er würde in
dieser Welt da nie heimisch werden. Er wollte etwas
sagen, sagen, daß er verzichte, nie gehen werde, daß Kr-
immer bei Annie bleibe, da erlosch langsam die Lampe.
„Wir wollen nun alle schlafen gehen," sagte Griotte.
„Ja, schlafen," nickte Frau Marie. Ihre Augen
waren schwer von Müdigkeit und Thränen, und wäh-
rend sie die Kissen noch einmal aufschüttelte, rechnete
sie nach, wie es möglich sein könne, ohne die Einnahme
für Zimmervermieten noch länger Essen zu kochen und
Petroleum zu kaufen.
Griotte ging mit dem Gefühl zu Bett, eine große
Scene glänzend durchgeführt zu haben, als Mensch und
als Schauspieler bedeutend und vornehm, Gentleman
auch in der Armut. Und Annie kroch wieder die Leiter
hinauf in ihren kleinen Verschlag, legte den Kops auf
das Kissen und biß die Zähne so fest zusammen, daß
die Eltern unten in der Küche von dem Schluchzen
nichts vernahmen.
Sechstes Kapitel.
C. W. Kalm wohnte in einem Mietszimmer am
Schiffbauerdamm. In den Hotels fühlte er sich nicht
wohl, weil man seine amerikanischen Gewohnheiten
dort nicht genügend respektierte, vielleicht auch weil es
ihm dort zu teuer war. Er spuckte auf die Teppiche
und ruinierte durch sein Schaukeln alle Stühle; weil
er eignen Möbeln gegenüber rücksichtsvoller gewesen
wäre, schaffte er sich lieber keine an. Die Zimmer-
vermieterin geriet in der ersten Zeit über seine Rüpe-
leien außer sich, da sie ihm aber gewachsen war, ihm
jeden Defekt auf Rechnung setzte und diese Rechnungen
erfolgreich gegen ihn verteidigte, gab sie sich mit der
Zeit zufrieden. Die beiden fochten harte Kämpfe mit-
einander aus, die C. W. Kalm liebte und für seine
Nerven notwendig gebrauchte. Nachher söhnten sie sich
dann wieder aus, und sie wurden mit der Zeit gute
Freunde. Der Baron von Rosse hatte in diesem
Quartier am Schiffbauerdamm tagtäglich zu erscheinen,
oft zu wiederholten Malen. C. W. gehörte nicht zu
den Leuten, die Geld unnütz ausgeben, und für die
1250 Mark verlangte er anständige Arbeitsleistungen.
Stundenlang mußte der Baron, die Arme auf ein ver-
schlissenes Kissen gelehnt, neben ihm aus dem Fenster-
schauen, während C. W. amerikanischen Tabak kaute
und über die Vorübergehenden weg in die Spree
zu spucken versuchte.
„So kann ich mich am besten unterhalten," sagte
er, „und am vorteilhaftesten nachdenken. Ich muß
Leben unter mir sehen, dann komme ich aus praktische
Gedanken."
Links unter ihnen lag die Weidendammerbrücke mit
ihrem Gewoge von Menschen, Droschken, Omnibussen.
Die kleinen schmutzigen Dampfer schleppten riesige Kähne
voll Kohlen und Mörtel durch die Brücken, und die
großen Schiffe, welche die böhmischen Aepfel bringen,
lagen vor ihnen, so daß das Obst ihnen in die Nase
duftete.
„Ich habe jetzt Appetit auf Aepfel," sagte Kalm
häufig, „thun Sie mir einen Gefallen, lieber Baron,
und holen Sie uns ein paar. Ich habe Pantoffeln
an, sonst ginge ich selber."
Später ließ er derartige Entschuldigungen ganz
weg und sandte den Baron ohne alle Umstände.
Auf Brandes hatte er einen unsagbaren Grimm.
„Diesen Menschen ruiniere ich, diesen elenden
Parvenü bohre ich in Grund und Boden. Was war
denn überhaupt dieser Geck früher?! Ein Garnichts,
ein entlaufener Hamburger Commis. Er hat Glück
gehabt, das ist alles."
Der Baron, der Brandes viel zu danken hatte,
suchte ihn in Schutz zu nehmen, aber das war Oel in
Kalms Feuer.
„Wenn Sie mich beleidigen wollen, dann bitte.
Aber dann ist es aus mit uns."
Vielleicht hätte ein energisches Wort im Anfänge
ihrer Bekanntschaft dem alten Baron eine ganz andre
Position Kalm gegenüber verschafft, aber die graue
Sorge stand vor ihm wie ein Gespenst, und er beugte
sich, um so mehr, als Kalm in den ersten Tagen
Miene machte, den ungeschriebenen Kontrakt zu lösen.
31
meines besten Freundes. — Seine Durchlaucht der Prinz,
von Reichenberg! — Herr Rittmeister von Carlotty!
Herr Lieutenant Graf Denlow! — Mr. Grey." -
Brandes hatte Konrad an der Hand gefaßt und
ging mit ihm von einem zum andern. Dann endete
er die kleine Scene.
„Meine Herren, nun denke ich, gehen wir zum
Abendessen."
Einen Augenblick stand Konrad allein. Er sah sich
um, ob Käthchen nicht noch neben ihm sei, aber sie
ging schon drüben an der Seite des Prinzen, plaudernd
und lachend.
„Ich glaube, wir sind Tischnachbarn."
Der Graf Venlow sagte es zu Konrad, und dieser
bejahte. Man nahm die Plätze ein, und sofort wurde
die Unterhaltung von dem Rittmeister lebhaft aus-
genommen. Bisweilen sprach Brandes, seltener der
Prinz, die andern hatten fast nichts zu thun als zuzu-
hören und über Carlottas unerschöpfliche gute Einfälle
zu lachen.
Für Konrad war das wie eine Erlösung. Er saß
stumm und steif, und der Gedanke war ihm peinlich,
in dieser Gesellschaft Irrtümer zu begehen. Einmal
lenkte Brandes das Gespräch aus ihn und erzählte
kurz von Konrads Vater, da waren aller Blicke auf
den Fremden gerichtet, und Konrad fühlte, wie ihm
das Blut zu Kopf stieg. Carlotta nahm sein Glas
und neigte sich freundlich gegen ihn, der Prinz that
dasselbe, der Graf Venlow'stieß mit ihm an. Dann
kam das Gespräch aus die bevorstehenden Hamburger
Rennen, und Konrad saß wieder stumm, in dem kleinen
Kreise wie verloren.
Ein einziger Gedanke fing an, in ihm Raum zu
gewinnen und ihn von Minute zu Minute mehr zu
beherrschen: von hier fort sein! Was hatte er hier
zu thun? Er gehörte nicht hierher und würde nie
hierher gehören. Er würde unglücklich sein, wenn er
bei diesen Leuten bleiben müßte, mit denen — Bran-
des ausgenommen — ihn nichts verband.
Er merkte nicht, daß sein Nachbar, der Graf, ebenso
schweigsam saß, ebensowenig beachtet. Es war das
ein blutjunger Offizier von den Garde-Ulanen, schlank,
mit einem fast bäurisch derben Kopse, der durch einige
wenige Linien im Gesicht ein gewinnendes adliges
Aussehen erhielt. Erst gegen Ende der Mahlzeit ver-
suchte der Lieutenant mit seinem Nachbar ein Gespräch
anzuknüpfen.
„Sind Sie fremd in Berlin?"
„Ja."
„Sie sind nicht Offizier? Wollen Sie es werden?"
„Nein."
„Dann sind Sie Student?"
„Nein, ich bin Kaufmann. Bei der Handels-
gesellschaft."
Der Graf schwieg, und Konrad hatte keinen Anlaß,
das Gespräch fortzusetzen. Als er aber nach dem
Diner etwas seitab in einer Fensternische stand —
Brandes hatte eben lange mit ihm geplaudert und
stand jetzt bei Mr. Grey — kam der Graf zu ihm:
„Erlauben Sie, daß ich mich hersetze?"
„Ich bitte."
Sie sprachen allerlei über Theater und über die
Kunst, wie zwei Leute, die weltfremd sind und sich
scheuen, kritische Urteile auszusprechen. Als aber ihre
Ansichten sich mehrfach zusammenfanden, wurden sie
unbefangener und fast vertraut. Es war keine große
Weisheit, die über Schiller und Shakespeare zu Tage
gefördert wurde, aber sie kam aus zwei warmen, jugend-
lichen Herzen, und sie klang unter ,Stockwells' und
Madiateurs' Bildern und in einem Salon, wo Carlotta
gerade über französische Hürdenrennen Vortrag hielt,
immerhin fremd und seltsam.
Eine Stunde später, kurz vor dem Aufbruch, stand
Konrad noch einmal mit Brandes zusammen.
„Nun? Gut unterhalten, mein Junge?"
„O sehr."
„Aber der kleine Graf war wohl etwas langweilig?
Der redet nie. Indessen, er ist ein guter Junge. Ich
habe gegen ihn Verpflichtungen, er reitet bisweilen
meine Pferde."
„Reitet?" Konrad war starr. „Hat der auch mit
den Rennpferden zu thun?"
Da lachte Brandes laut auf: „Mein lieber Junge,
das frag' ihn selbst. Er ist der verwegenste Steeple-
Chase-Reiter der Welt und nebenbei ein Mann, der
ein Pferd zu taxieren versteht wie wenige. Der hat
eine große Zukunft."
Fünftes Kapitel.
Es war drei Uhr nachts, als Konrad vor seinem
Hause in der Tieckstraße anlangte. Er tappte die drei
Treppen hinauf, öffnete leise, behutsam die Thür und
erschrack fast, als er die Wohnung noch erleuchtet fand.
Griotte saß in einen alten Schlafrock gewickelt auf
dem Sofa und schlummerte; er hatte offenbar aus seinen
Mieter gewartet. Konrad machte allerhand Lärm, aber
Griotte erwachte nicht eher, bis Konrad ihn heftig
„Ja, verdammt! Was ist? Was giebt's?!"
Griotte sah um sich, als hätte er irgend etwas
Schreckliches gehört, dann kam er aber rasch zu sich
und streckte Konrad die Hände entgegen.
„Mein lieber, guter Freund! Also endlich! Ja,
ich habe Sie erwartet, selbstverständlich. Wie war's?
Sie müssen mir erzählen. Ich will eine Flasche Bier
holen, oder zwei. — Nur eine? — Gut, nur eine. Aber
eine Zigarre. Auch nicht? Menschenkind, nun müssen
Sie erzählen."
Konrad war trotz seiner Sterbensmüdigkeit zu
gutmütig, um Griotte, der so lange gewartet hatte,
den Gefallen nicht zu erweisen. Und dann mußte er
ja auch mit ihm Rücksprache nehmen wegen des
Wohnungswechsels, besser heute als morgen.
„Also vor allem: wer war alles da?"
Konrad zählte die Namen aus: Carlotta, der Prinz,
Mr. Grey, Graf Venlow — und Griotte saß wie ver-
steinert.
„Zwischen den Leuten haben Sie gesessen? Sie
zwischen den Leuten?"
„Ja."
„In dem Rock?" Griotte strich fast ängstlich über
das dunkle Tuch. „Und dann die Stiesel!" Er kannte
diese Stiefel, er mußte sie allmorgendlich, falls die
Aufwärterin zu spät kam, heimlich putzen.
„Was gab's denn zu essen?"
Konrad versuchte, das Menü zu rekonstruieren, und
brachte den armen Griotte in Aufregung.
„Ah, diese Schlemmer! Diese Fresser! Und was
gab's zu trinken? Natürlich Champagner!"
„Ja, Champagner und andres."
„Und andres." Griotte sagte das ganz mechanisch.
Er sah im Geiste große Burgunderflaschen und grüne,
bestaubte Bouteillen mit Rheinwein.
Er war so in Aufregung, daß er an die Thür zur
Küche ging und hineinrief:
„Marie! Marie!"
Die gute Frau Griotte erwachte und fragte ängst-
lich aus dem Dunkel, was los sei, weshalb man sie
wecke.
„Komm herein," sagte Griotte, „zieh dir den Schlaf-
rock an. Er hat neben dem Prinzen von Reichenberg
gesessen und Champagner getrunken."
Verschlafen kam die dicke Frau ins Zimmer und
mußte erst durch einen Schluck Bier zum Leben ge-
bracht werden.
„Forellen, Hummer, Rehrücken, Eis, stell dir das
vor! Diese Schlemmer, diese Fresser!"
„Hummer auch?" fragte sie und zwinkerte mühsam
gegen die Lampe.
„Ja, Hummer auch."
„Ich will Annie wecken," sagte Griotte, „sie muß
das hören," seine Frau aber und Konrad protestierten
energisch gegen diesen tollen Einfall.
Es fiel Konrad schwer, den Griottes die große Mit-
teilung der Kündigung zu machen, aber schließlich fand
er den Mut:
„Herr Brandes war sehr gütig gegen mich. Er
will, daß ich so bald als möglich zu ihm ziehe, Be-
schäftigung hätte er für mich genug. Und so müßte
ich denn — ja, müßte ich denn Ihnen kündigen."
„Kündigen," wiederholte Griotte ganz ruhig, zu
sehr überrascht, um in Erregung zu kommen — seine
Frau hingegen bekam einen großen Schreck: „Ach, du
lieber Gott, dann ist's aus! Jetzt, wo die Studenten-
ferien sind! Wo kein Mensch vermieten kann!"
Sie fing an zu schluchzen, und Konrad war in
der peinlichsten Verlegenheit. Er dachte an Annie:
was würde die sagen?! Er blickte auf die gute Frau,
die — wenn auch für Geld — drei Wochen lang
mütterlich für ihn gesorgt hatte, und er sah Griotte,
der jetzt das Unsaßliche zu begreifen begann: erstens,
daß er einen Mieter verliere, und zweitens einen
Mieter, der mit dem Prinzen von Reichenberg soupiert
und für die Griottes vielleicht einmal zum einfluß-
reichen Gönner hätte werden können.
Es folgten Reden und Klagen, Bitten und Vor-
stellungen, und als es vier Uhr bereits vorbei war,
wurde Annie geweckt und dem verschlafenen, frierenden
Dingchen die unglückliche Neuigkeit von der schluchzen-
den Mutter mitgeteilt.
„Annchen, sprich du mit ihm, bitte du ihn!"
Griotte war in allen Lebenslagen Halbwegs objektiv
und sah jede Scene durch die Brille des Menschen-
darstellers. Das hier war eine dramatische Scene mit
echtem Leben. Der herangrauende Morgen; der junge
Mann, der mit Prinzen speist und bei ihm, Griotte,
gewohnt hat; Annie, die vielleicht diesen jungen Mann
liebgewonnen hat und ihn nun verlieren soll; seine
Frau klagend, Griotte heroisch, der junge Mann zwei-
felnd und bewegt — die große Scene eines dritten
Aufzugs!
„Annchen, sprich du mit ihm, bitt du ihn," —
das schien der armen Frau Griotte der letzte Rettungs-
anker.
Aber Annie bat nicht und sprach nicht. Sie stand
ganz stumm und sah in die Lampe, die langsam zu
erlöschen begann. Man hatte sie aus einem Traum
gerissen, der in den kleinen, dunkeln Verschlag, wo sie
schlief, auf Rosenflügeln hereingegaukelt war — und.
nun war der Traum vorbei und wohl alles vorbei.
„Nein," sagte Griotte, „wir wollen ihn nicht quälen."
Er spielte den großen, heroischen Mann, der im Drama
(dritter Akt, letzte Scene) vornehm verzichtet. „Wir
haben diesen jungen Mann, ich möchte sagen, lieb-
gewonnen, aber wir dürfen nicht Egoisten sein. Er-
geht einer großen Zukunft entgegen, vielleicht erinnert
er sich im Glück und Ueberfluß bisweilen derer, die
ihm in einfachen Tagen treu zur Seite standen."
In diesem Augenblick hätte Konrad viel darum
gegeben, wenn der Tag mit seinem Glanz und der
großen neuen Perspektive nie in sein Leben getreten
wäre. Er sah den-Prinzen, den Rittmeister in der
bunt strahlenden Uniform, Käthchen Brandes im schim-
mernden Weiß, die Diener, die Kerzen — er würde in
dieser Welt da nie heimisch werden. Er wollte etwas
sagen, sagen, daß er verzichte, nie gehen werde, daß Kr-
immer bei Annie bleibe, da erlosch langsam die Lampe.
„Wir wollen nun alle schlafen gehen," sagte Griotte.
„Ja, schlafen," nickte Frau Marie. Ihre Augen
waren schwer von Müdigkeit und Thränen, und wäh-
rend sie die Kissen noch einmal aufschüttelte, rechnete
sie nach, wie es möglich sein könne, ohne die Einnahme
für Zimmervermieten noch länger Essen zu kochen und
Petroleum zu kaufen.
Griotte ging mit dem Gefühl zu Bett, eine große
Scene glänzend durchgeführt zu haben, als Mensch und
als Schauspieler bedeutend und vornehm, Gentleman
auch in der Armut. Und Annie kroch wieder die Leiter
hinauf in ihren kleinen Verschlag, legte den Kops auf
das Kissen und biß die Zähne so fest zusammen, daß
die Eltern unten in der Küche von dem Schluchzen
nichts vernahmen.
Sechstes Kapitel.
C. W. Kalm wohnte in einem Mietszimmer am
Schiffbauerdamm. In den Hotels fühlte er sich nicht
wohl, weil man seine amerikanischen Gewohnheiten
dort nicht genügend respektierte, vielleicht auch weil es
ihm dort zu teuer war. Er spuckte auf die Teppiche
und ruinierte durch sein Schaukeln alle Stühle; weil
er eignen Möbeln gegenüber rücksichtsvoller gewesen
wäre, schaffte er sich lieber keine an. Die Zimmer-
vermieterin geriet in der ersten Zeit über seine Rüpe-
leien außer sich, da sie ihm aber gewachsen war, ihm
jeden Defekt auf Rechnung setzte und diese Rechnungen
erfolgreich gegen ihn verteidigte, gab sie sich mit der
Zeit zufrieden. Die beiden fochten harte Kämpfe mit-
einander aus, die C. W. Kalm liebte und für seine
Nerven notwendig gebrauchte. Nachher söhnten sie sich
dann wieder aus, und sie wurden mit der Zeit gute
Freunde. Der Baron von Rosse hatte in diesem
Quartier am Schiffbauerdamm tagtäglich zu erscheinen,
oft zu wiederholten Malen. C. W. gehörte nicht zu
den Leuten, die Geld unnütz ausgeben, und für die
1250 Mark verlangte er anständige Arbeitsleistungen.
Stundenlang mußte der Baron, die Arme auf ein ver-
schlissenes Kissen gelehnt, neben ihm aus dem Fenster-
schauen, während C. W. amerikanischen Tabak kaute
und über die Vorübergehenden weg in die Spree
zu spucken versuchte.
„So kann ich mich am besten unterhalten," sagte
er, „und am vorteilhaftesten nachdenken. Ich muß
Leben unter mir sehen, dann komme ich aus praktische
Gedanken."
Links unter ihnen lag die Weidendammerbrücke mit
ihrem Gewoge von Menschen, Droschken, Omnibussen.
Die kleinen schmutzigen Dampfer schleppten riesige Kähne
voll Kohlen und Mörtel durch die Brücken, und die
großen Schiffe, welche die böhmischen Aepfel bringen,
lagen vor ihnen, so daß das Obst ihnen in die Nase
duftete.
„Ich habe jetzt Appetit auf Aepfel," sagte Kalm
häufig, „thun Sie mir einen Gefallen, lieber Baron,
und holen Sie uns ein paar. Ich habe Pantoffeln
an, sonst ginge ich selber."
Später ließ er derartige Entschuldigungen ganz
weg und sandte den Baron ohne alle Umstände.
Auf Brandes hatte er einen unsagbaren Grimm.
„Diesen Menschen ruiniere ich, diesen elenden
Parvenü bohre ich in Grund und Boden. Was war
denn überhaupt dieser Geck früher?! Ein Garnichts,
ein entlaufener Hamburger Commis. Er hat Glück
gehabt, das ist alles."
Der Baron, der Brandes viel zu danken hatte,
suchte ihn in Schutz zu nehmen, aber das war Oel in
Kalms Feuer.
„Wenn Sie mich beleidigen wollen, dann bitte.
Aber dann ist es aus mit uns."
Vielleicht hätte ein energisches Wort im Anfänge
ihrer Bekanntschaft dem alten Baron eine ganz andre
Position Kalm gegenüber verschafft, aber die graue
Sorge stand vor ihm wie ein Gespenst, und er beugte
sich, um so mehr, als Kalm in den ersten Tagen
Miene machte, den ungeschriebenen Kontrakt zu lösen.