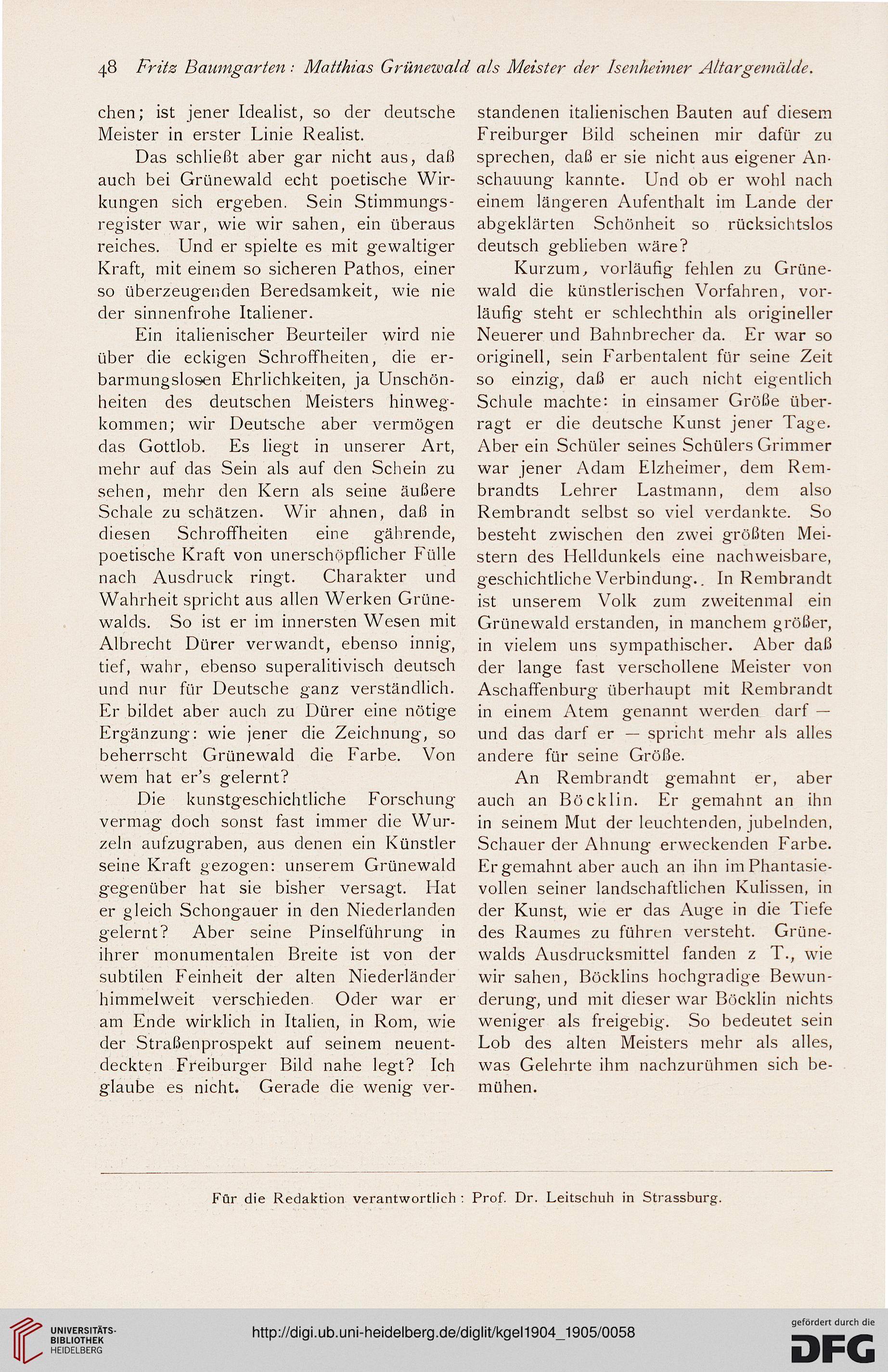48 Fritz Baumgarten : Matthias Grünewald als Meister der Isenheimer Altargemälde.
chen; ist jener Idealist, so der deutsche
Meister in erster Linie Realist.
Das schließt aber gar nicht aus, daß
auch bei Grünewald echt poetische Wir-
kungen sich ergeben. Sein Stimmungs-
register war, wie wir sahen, ein überaus
reiches. Und er spielte es mit gewaltiger
Kraft, mit einem so sicheren Pathos, einer
so überzeugenden Beredsamkeit, wie nie
der sinnenfrohe Italiener.
Ein italienischer Beurteiler wird nie
über die eckigen Schroffheiten, die er-
barmungslosen Ehrlichkeiten, ja Unschön-
heiten des deutschen Meisters hinweg-
kommen; wir Deutsche aber vermögen
das Gottlob. Es liegt in unserer Art,
mehr auf das Sein als auf den Schein zu
selien, mehr den Kern als seine äußere
Schale zu schätzen. Wir ahnen, daß in
diesen Schroffheiten eine gährende,
poetische Kraft von unerschöpflicher Fülle
nach Ausdruck ringt. Charakter und
Wahrheit spricht aus allen Werken Grüne-
walds. So ist er im innersten Wesen mit
Albrecht Dürer verwandt, ebenso innig,
tief, wahr, ebenso superalitivisch deutsch
und nur für Deutsche ganz verständlich.
Er bildet aber auch zu Dürer eine nötige
Ergänzung: wie jener die Zeichnung, so
beherrscht Grünewald die Farbe. Von
wem hat er's gelernt?
Die kunstgeschichtliche Forschung
vermag doch sonst fast immer die Wur-
zeln aufzugraben, aus denen ein Künstler
seine Kraft gezogen: unserem Grünewald
gegenüber hat sie bisher versagt. Hat
er gleich Schongauer in den Niederlanden
gelernt? Aber seine Pinselführung in
ihrer monumentalen Breite ist von der
subtilen Feinheit der alten Niederländer
himmelweit verschieden. Oder war er
am Ende wirklich in Italien, in Rom, wie
der Straßenprospekt auf seinem neuent-
deckten Freiburger Bild nahe legt? Ich
glaube es nicht. Gerade die wenig ver-
standenen italienischen Bauten auf diesem
Freiburger Bild scheinen mir dafür zu
sprechen, daß er sie nicht aus eigener An-
schauung kannte. Und ob er wohl nach
einem längeren Aufenthalt im Lande der
abgeklärten Schönheit so rücksichtslos
deutsch geblieben wäre?
Kurzum, vorläufig fehlen zu Grüne-
wald die künstlerischen Vorfahren, vor-
läufig steht er schlechthin als origineller
Neuerer und Bahnbrecher da. Er war so
originell, sein Farbentalent für seine Zeit
so einzig, daß er auch nicht eigentlich
Schule machte: in einsamer Größe über-
ragt er die deutsche Kunst jener Tage.
Aber ein Schüler seines Schülers Grimmer
war jener Adam Elzheimer, dem Rem-
brandts Lehrer Lastmann, dem also
Rembrandt selbst so viel verdankte. So
besteht zwischen den zwei größten Mei-
stern des Helldunkels eine nachweisbare,
geschichtliche Verbindung.. In Rembrandt
ist unserem Volk zum zweitenmal ein
Grünewald erstanden, in manchem größer,
in vielem uns sympathischer. Aber daß
der lange fast verschollene Meister von
Aschaffenburg überhaupt mit Rembrandt
in einem Atem genannt werden darf —
und das darf er — spricht mehr als alles
andere für seine Größe.
An Rembrandt gemahnt er, aber
auch an Böcklin. Er gemahnt an ihn
in seinem Mut der leuchtenden, jubelnden,
Schauer der Ahnung erweckenden Farbe.
Er gemahnt aber auch an ihn im Phantasie-
vollen seiner landschaftlichen Kulissen, in
der Kunst, wie er das Auge in die Tiefe
des Raumes zu führen versteht. Grüne-
walds Ausdrucksmittel fanden z T., wie
wir sahen, Böcklins hochgradige Bewun-
derung, und mit dieser war Böcklin nichts
weniger als freigebig. So bedeutet sein
Lob des alten Meisters mehr als alles,
was Gelehrte ihm nachzurühmen sich be-
mühen.
Für die Redaktion verantwortlieh : Prof. Dr. Leitschuh in Strassburg.
chen; ist jener Idealist, so der deutsche
Meister in erster Linie Realist.
Das schließt aber gar nicht aus, daß
auch bei Grünewald echt poetische Wir-
kungen sich ergeben. Sein Stimmungs-
register war, wie wir sahen, ein überaus
reiches. Und er spielte es mit gewaltiger
Kraft, mit einem so sicheren Pathos, einer
so überzeugenden Beredsamkeit, wie nie
der sinnenfrohe Italiener.
Ein italienischer Beurteiler wird nie
über die eckigen Schroffheiten, die er-
barmungslosen Ehrlichkeiten, ja Unschön-
heiten des deutschen Meisters hinweg-
kommen; wir Deutsche aber vermögen
das Gottlob. Es liegt in unserer Art,
mehr auf das Sein als auf den Schein zu
selien, mehr den Kern als seine äußere
Schale zu schätzen. Wir ahnen, daß in
diesen Schroffheiten eine gährende,
poetische Kraft von unerschöpflicher Fülle
nach Ausdruck ringt. Charakter und
Wahrheit spricht aus allen Werken Grüne-
walds. So ist er im innersten Wesen mit
Albrecht Dürer verwandt, ebenso innig,
tief, wahr, ebenso superalitivisch deutsch
und nur für Deutsche ganz verständlich.
Er bildet aber auch zu Dürer eine nötige
Ergänzung: wie jener die Zeichnung, so
beherrscht Grünewald die Farbe. Von
wem hat er's gelernt?
Die kunstgeschichtliche Forschung
vermag doch sonst fast immer die Wur-
zeln aufzugraben, aus denen ein Künstler
seine Kraft gezogen: unserem Grünewald
gegenüber hat sie bisher versagt. Hat
er gleich Schongauer in den Niederlanden
gelernt? Aber seine Pinselführung in
ihrer monumentalen Breite ist von der
subtilen Feinheit der alten Niederländer
himmelweit verschieden. Oder war er
am Ende wirklich in Italien, in Rom, wie
der Straßenprospekt auf seinem neuent-
deckten Freiburger Bild nahe legt? Ich
glaube es nicht. Gerade die wenig ver-
standenen italienischen Bauten auf diesem
Freiburger Bild scheinen mir dafür zu
sprechen, daß er sie nicht aus eigener An-
schauung kannte. Und ob er wohl nach
einem längeren Aufenthalt im Lande der
abgeklärten Schönheit so rücksichtslos
deutsch geblieben wäre?
Kurzum, vorläufig fehlen zu Grüne-
wald die künstlerischen Vorfahren, vor-
läufig steht er schlechthin als origineller
Neuerer und Bahnbrecher da. Er war so
originell, sein Farbentalent für seine Zeit
so einzig, daß er auch nicht eigentlich
Schule machte: in einsamer Größe über-
ragt er die deutsche Kunst jener Tage.
Aber ein Schüler seines Schülers Grimmer
war jener Adam Elzheimer, dem Rem-
brandts Lehrer Lastmann, dem also
Rembrandt selbst so viel verdankte. So
besteht zwischen den zwei größten Mei-
stern des Helldunkels eine nachweisbare,
geschichtliche Verbindung.. In Rembrandt
ist unserem Volk zum zweitenmal ein
Grünewald erstanden, in manchem größer,
in vielem uns sympathischer. Aber daß
der lange fast verschollene Meister von
Aschaffenburg überhaupt mit Rembrandt
in einem Atem genannt werden darf —
und das darf er — spricht mehr als alles
andere für seine Größe.
An Rembrandt gemahnt er, aber
auch an Böcklin. Er gemahnt an ihn
in seinem Mut der leuchtenden, jubelnden,
Schauer der Ahnung erweckenden Farbe.
Er gemahnt aber auch an ihn im Phantasie-
vollen seiner landschaftlichen Kulissen, in
der Kunst, wie er das Auge in die Tiefe
des Raumes zu führen versteht. Grüne-
walds Ausdrucksmittel fanden z T., wie
wir sahen, Böcklins hochgradige Bewun-
derung, und mit dieser war Böcklin nichts
weniger als freigebig. So bedeutet sein
Lob des alten Meisters mehr als alles,
was Gelehrte ihm nachzurühmen sich be-
mühen.
Für die Redaktion verantwortlieh : Prof. Dr. Leitschuh in Strassburg.