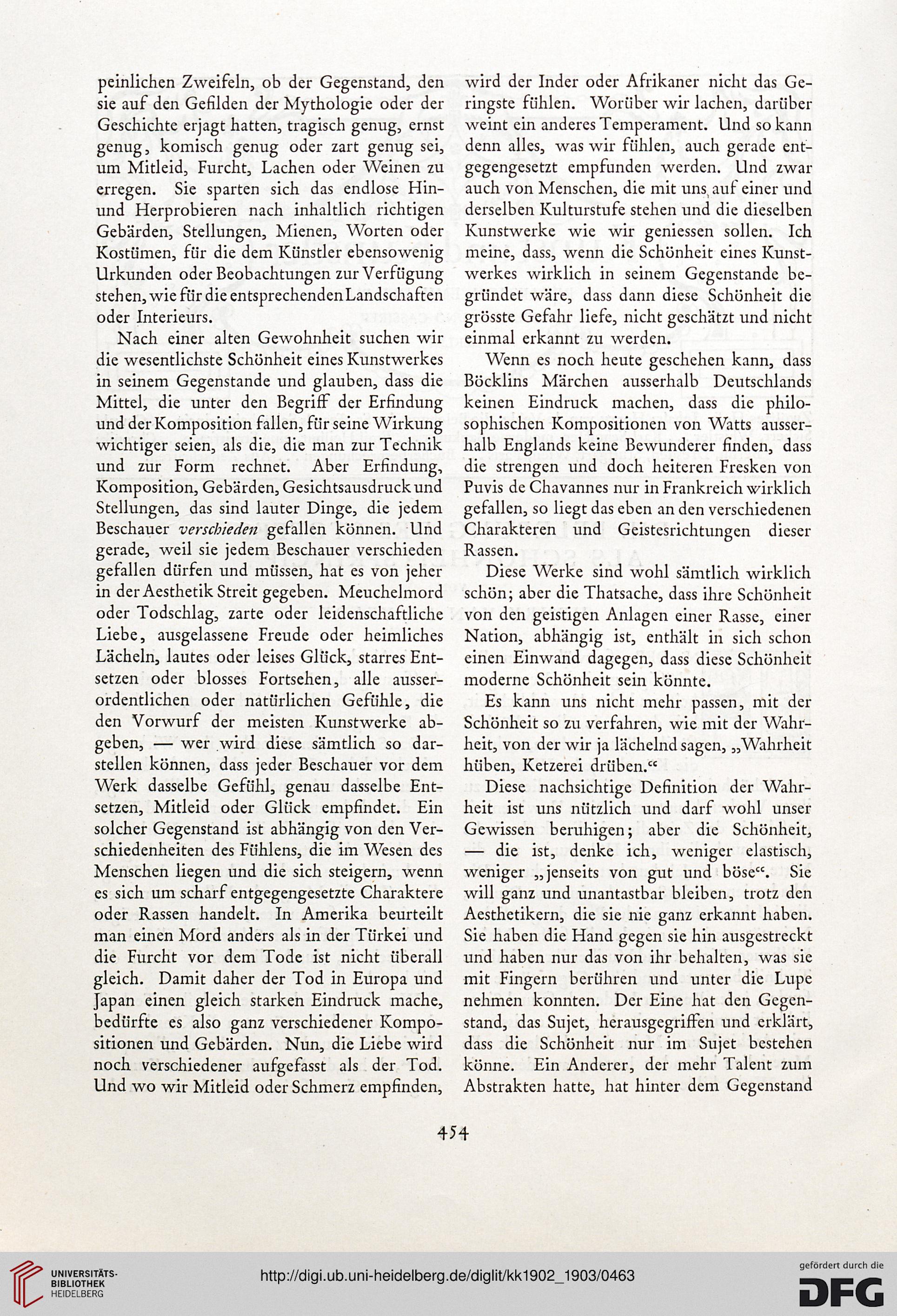peinlichen Zweifeln, ob der Gegenstand, den
sie auf den Gefilden der Mythologie oder der
Geschichte erjagt hatten, tragisch genug, ernst
genug, komisch genug oder zart genug sei,
um Mitleid, Furcht, Lachen oder Weinen zu
erregen. Sie sparten sich das endlose Hin-
und Herprobieren nach inhaltlich richtigen
Gebärden, Stellungen, Mienen, Worten oder
Kostümen, für die dem Künstler ebensowenig
Urkunden oder Beobachtungen zur Verfügung
steh en, wie für die entsprechenden Landschaften
oder Interieurs.
Nach einer alten Gewohnheit suchen wir
die wesentlichste Schönheit eines Kunstwerkes
in seinem Gegenstande und glauben, dass die
Mittel, die unter den Begriff der Erfindung
und der Komposition fallen, für seine Wirkung
wichtiger seien, als die, die man zur Technik
und zur Form rechnet. Aber Erfindung,
Komposition, Gebärden, Gesichtsausdruck und
Stellungen, das sind lauter Dinge, die jedem
Beschauer verschieden gefallen können. Und
gerade, weil sie jedem Beschauer verschieden
gefallen dürfen und müssen, hat es von jeher
in der Aesthetik Streit gegeben. Meuchelmord
oder Todschlag, zarte oder leidenschaftliche
Liebe, ausgelassene Freude oder heimliches
Lächeln, lautes oder leises Glück, starres Ent-
setzen oder blosses Fortsehen, alle ausser-
ordentlichen oder natürlichen Gefühle, die
den Vorwurf der meisten Kunstwerke ab-
geben, — wer wird diese sämtlich so dar-
stellen können, dass jeder Beschauer vor dem
Werk dasselbe Gefühl, genau dasselbe Ent-
setzen, Mitleid oder Glück empfindet. Ein
solcher Gegenstand ist abhängig von den Ver-
schiedenheiten des Fühlens, die im Wesen des
Menschen liegen und die sich steigern, wenn
es sich um scharf entgegengesetzte Charaktere
oder Rassen handelt. In Amerika beurteilt
man einen Mord anders als in der Türkei und
die Furcht vor dem Tode ist nicht überall
gleich. Damit daher der Tod in Europa und
Japan einen gleich starken Eindruck mache,
bedürfte es also ganz verschiedener Kompo-
sitionen und Gebärden. Nun, die Liebe wird
noch verschiedener aufgefasst als der Tod.
Und wo wir Mitleid oder Schmerz empfinden,
wird der Inder oder Afrikaner nicht das Ge-
ringste fühlen. Worüber wir lachen, darüber
weint ein anderes Temperament. Und so kann
denn alles, was wir fühlen, auch gerade ent-
gegengesetzt empfunden werden. Und zwar
auch von Menschen, die mit uns, auf einer und
derselben Kulturstufe stehen und die dieselben
Kunstwerke wie wir gemessen sollen. Ich
meine, dass, wenn die Schönheit eines Kunst-
werkes wirklich in seinem Gegenstande be-
gründet wäre, dass dann diese Schönheit die
grösste Gefahr liefe, nicht geschätzt und nicht
einmal erkannt zu werden.
Wenn es noch heute geschehen kann, dass
Böcklins Märchen ausserhalb Deutschlands
keinen Eindruck machen, dass die philo-
sophischen Kompositionen von Watts ausser-
halb Englands keine Bewunderer finden, dass
die strengen und doch heiteren Fresken von
Puvis de Chavannes nur in Frankreich wirklich
gefallen, so liegt das eben an den verschiedenen
Charakteren und Geistesrichtungen dieser
Rassen.
Diese Werke sind wohl sämtlich wirklich
schön; aber die Thatsache, dass ihre Schönheit
von den geistigen Anlagen einer Rasse, einer
Nation, abhängig ist, enthält in sich schon
einen Einwand dagegen, dass diese Schönheit
moderne Schönheit sein könnte.
Es kann uns nicht mehr passen, mit der
Schönheit so zu verfahren, wie mit der Wahr-
heit, von der wir ja lächelnd sagen, „Wahrheit
hüben, Ketzerei drüben."
Diese nachsichtige Definition der Wahr-
heit ist uns nützlich und darf wohl unser
Gewissen beruhigen; aber die Schönheit,
— die ist, denke ich, weniger elastisch,
weniger „jenseits von gut und böse". Sie
will ganz und unantastbar bleiben, trotz den
Aesthetikern, die sie nie ganz erkannt haben.
Sie haben die Hand gegen sie hin ausgestreckt
und haben nur das von ihr behalten, was sie
mit Fingern berühren und unter die Lupe
nehmen konnten. Der Eine hat den Gegen-
stand, das Sujet, herausgegriffen und erklärt,
dass die Schönheit nur im Sujet bestehen
könne. Ein Anderer, der mehr Talent zum
Abstrakten hatte, hat hinter dem Gegenstand
454
sie auf den Gefilden der Mythologie oder der
Geschichte erjagt hatten, tragisch genug, ernst
genug, komisch genug oder zart genug sei,
um Mitleid, Furcht, Lachen oder Weinen zu
erregen. Sie sparten sich das endlose Hin-
und Herprobieren nach inhaltlich richtigen
Gebärden, Stellungen, Mienen, Worten oder
Kostümen, für die dem Künstler ebensowenig
Urkunden oder Beobachtungen zur Verfügung
steh en, wie für die entsprechenden Landschaften
oder Interieurs.
Nach einer alten Gewohnheit suchen wir
die wesentlichste Schönheit eines Kunstwerkes
in seinem Gegenstande und glauben, dass die
Mittel, die unter den Begriff der Erfindung
und der Komposition fallen, für seine Wirkung
wichtiger seien, als die, die man zur Technik
und zur Form rechnet. Aber Erfindung,
Komposition, Gebärden, Gesichtsausdruck und
Stellungen, das sind lauter Dinge, die jedem
Beschauer verschieden gefallen können. Und
gerade, weil sie jedem Beschauer verschieden
gefallen dürfen und müssen, hat es von jeher
in der Aesthetik Streit gegeben. Meuchelmord
oder Todschlag, zarte oder leidenschaftliche
Liebe, ausgelassene Freude oder heimliches
Lächeln, lautes oder leises Glück, starres Ent-
setzen oder blosses Fortsehen, alle ausser-
ordentlichen oder natürlichen Gefühle, die
den Vorwurf der meisten Kunstwerke ab-
geben, — wer wird diese sämtlich so dar-
stellen können, dass jeder Beschauer vor dem
Werk dasselbe Gefühl, genau dasselbe Ent-
setzen, Mitleid oder Glück empfindet. Ein
solcher Gegenstand ist abhängig von den Ver-
schiedenheiten des Fühlens, die im Wesen des
Menschen liegen und die sich steigern, wenn
es sich um scharf entgegengesetzte Charaktere
oder Rassen handelt. In Amerika beurteilt
man einen Mord anders als in der Türkei und
die Furcht vor dem Tode ist nicht überall
gleich. Damit daher der Tod in Europa und
Japan einen gleich starken Eindruck mache,
bedürfte es also ganz verschiedener Kompo-
sitionen und Gebärden. Nun, die Liebe wird
noch verschiedener aufgefasst als der Tod.
Und wo wir Mitleid oder Schmerz empfinden,
wird der Inder oder Afrikaner nicht das Ge-
ringste fühlen. Worüber wir lachen, darüber
weint ein anderes Temperament. Und so kann
denn alles, was wir fühlen, auch gerade ent-
gegengesetzt empfunden werden. Und zwar
auch von Menschen, die mit uns, auf einer und
derselben Kulturstufe stehen und die dieselben
Kunstwerke wie wir gemessen sollen. Ich
meine, dass, wenn die Schönheit eines Kunst-
werkes wirklich in seinem Gegenstande be-
gründet wäre, dass dann diese Schönheit die
grösste Gefahr liefe, nicht geschätzt und nicht
einmal erkannt zu werden.
Wenn es noch heute geschehen kann, dass
Böcklins Märchen ausserhalb Deutschlands
keinen Eindruck machen, dass die philo-
sophischen Kompositionen von Watts ausser-
halb Englands keine Bewunderer finden, dass
die strengen und doch heiteren Fresken von
Puvis de Chavannes nur in Frankreich wirklich
gefallen, so liegt das eben an den verschiedenen
Charakteren und Geistesrichtungen dieser
Rassen.
Diese Werke sind wohl sämtlich wirklich
schön; aber die Thatsache, dass ihre Schönheit
von den geistigen Anlagen einer Rasse, einer
Nation, abhängig ist, enthält in sich schon
einen Einwand dagegen, dass diese Schönheit
moderne Schönheit sein könnte.
Es kann uns nicht mehr passen, mit der
Schönheit so zu verfahren, wie mit der Wahr-
heit, von der wir ja lächelnd sagen, „Wahrheit
hüben, Ketzerei drüben."
Diese nachsichtige Definition der Wahr-
heit ist uns nützlich und darf wohl unser
Gewissen beruhigen; aber die Schönheit,
— die ist, denke ich, weniger elastisch,
weniger „jenseits von gut und böse". Sie
will ganz und unantastbar bleiben, trotz den
Aesthetikern, die sie nie ganz erkannt haben.
Sie haben die Hand gegen sie hin ausgestreckt
und haben nur das von ihr behalten, was sie
mit Fingern berühren und unter die Lupe
nehmen konnten. Der Eine hat den Gegen-
stand, das Sujet, herausgegriffen und erklärt,
dass die Schönheit nur im Sujet bestehen
könne. Ein Anderer, der mehr Talent zum
Abstrakten hatte, hat hinter dem Gegenstand
454