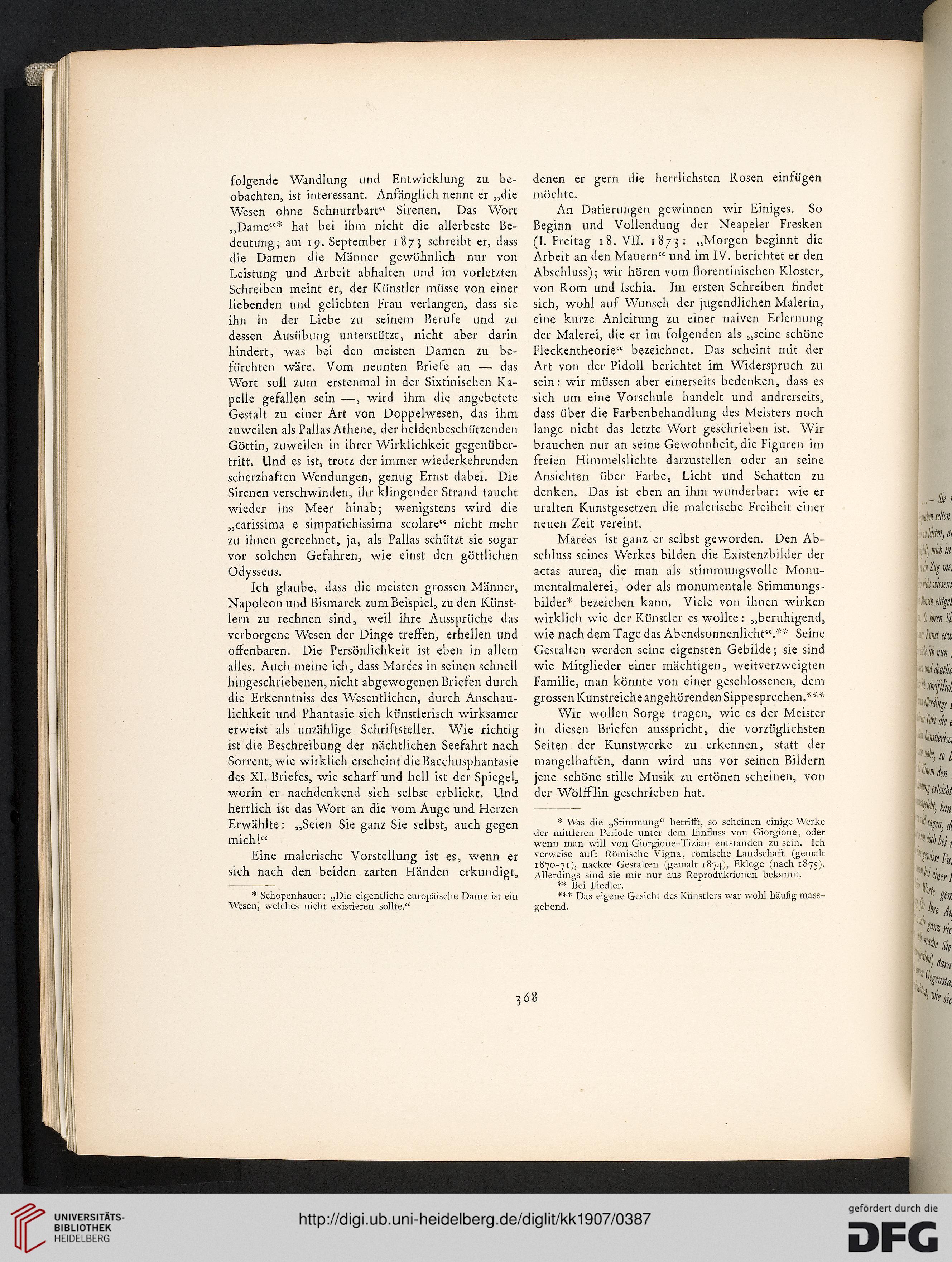folgende Wandlung und Entwicklung zu be-
obachten, ist interessant. Anfänglich nennt er „die
Wesen ohne Schnurrbart" Sirenen. Das Wort
„Dame"* hat bei ihm nicht die allerbeste Be-
deutung; am 19. September 1873 schreibt er, dass
die Damen die Männer gewöhnlich nur von
Leistung und Arbeit abhalten und im vorletzten
Schreiben meint er, der Künstler müsse von einer
liebenden und geliebten Frau verlangen, dass sie
ihn in der Liebe zu seinem Berufe und zu
dessen Ausübung unterstützt, nicht aber darin
hindert, was bei den meisten Damen zu be-
fürchten wäre. Vom neunten Briefe an — das
Wort soll zum erstenmal in der Sixtinischen Ka-
pelle gefallen sein —, wird ihm die angebetete
Gestalt zu einer Art von Doppelwesen, das ihm
zuweilen als Pallas Athene, der heldenbeschützenden
Göttin, zuweilen in ihrer Wirklichkeit gegenüber-
tritt. Und es ist, trotz der immer wiederkehrenden
scherzhaften Wendungen, genug Ernst dabei. Die
Sirenen verschwinden, ihr klingender Strand taucht
wieder ins Meer hinab; wenigstens wird die
„carissima e simpatichissima scolare" nicht mehr
zu ihnen gerechnet, ja, als Pallas schützt sie sogar
vor solchen Gefahren, wie einst den göttlichen
Odysseus.
Ich glaube, dass die meisten grossen Männer,
Napoleon und Bismarck zum Beispiel, zu den Künst-
lern zu rechnen sind, weil ihre Aussprüche das
verborgene Wesen der Dinge treffen, erhellen und
offenbaren. Die Persönlichkeit ist eben in allem
alles. Auch meine ich, dass Marees in seinen schnell
hingeschriebenen, nicht abgewogenen Briefen durch
die Erkenntniss des Wesentlichen, durch Anschau-
lichkeit und Phantasie sich künstlerisch wirksamer
erweist als unzählige Schriftsteller. Wie richtig
ist die Beschreibung der nächtlichen Seefahrt nach
Sorrent, wie wirklich erscheint die Bacchusphantasie
des XI. Briefes, wie scharf und hell ist der Spiegel,
worin er nachdenkend sich selbst erblickt. Und
herrlich ist das Wort an die vom Auge und Herzen
Erwählte: „Seien Sie ganz Sie selbst, auch gegen
mich!"
Eine malerische Vorstellung ist es, wenn er
sich nach den beiden zarten Händen erkundigt,
* Schopenhauer: „Die eigentliche europäische Dame ist ein
Wesen, welches nicht existieren sollte."
denen er gern die herrlichsten Rosen einfügen
möchte.
An Datierungen gewinnen wir Einiges. So
Beginn und Vollendung der Neapeler Fresken
(I. Freitag 18. VII. 1873: „Morgen beginnt die
Arbeit an den Mauern" und im IV. berichtet er den
Abschluss); wir hören vom florentinischen Kloster,
von Rom und Ischia. Im ersten Schreiben findet
sich, wohl auf Wunsch der jugendlichen Malerin,
eine kurze Anleitung zu einer naiven Erlernung
der Malerei, die er im folgenden als „seine schöne
Fleckentheorie" bezeichnet. Das scheint mit der
Art von der Pidoll berichtet im Widerspruch zu
sein: wir müssen aber einerseits bedenken, dass es
sich um eine Vorschule handelt und andrerseits,
dass über die Farbenbehandlung des Meisters noch
lange nicht das letzte Wort geschrieben ist. Wir
brauchen nur an seine Gewohnheit, die Figuren im
freien Himmelslichte darzustellen oder an seine
Ansichten über Farbe, Licht und Schatten zu
denken. Das ist eben an ihm wunderbar: wie er
uralten Kunstgesetzen die malerische Freiheit einer
neuen Zeit vereint.
Marees ist ganz er selbst geworden. Den Ab-
schluss seines Werkes bilden die Existenzbilder der
actas aurea, die man als stimmungsvolle Monu-
mentalmalerei, oder als monumentale Stimmungs-
bilder* bezeichen kann. Viele von ihnen wirken
wirklich wie der Künstler es wollte: „beruhigend,
wie nach dem Tage das Abendsonnenlicht".*"* Seine
Gestalten werden seine eigensten Gebilde; sie sind
wie Mitglieder einer mächtigen, weitverzweigten
Familie, man könnte von einer geschlossenen, dem
grossen Kunstreiche angehörenden Sippe sprechen.***
Wir wollen Sorge tragen, wie es der Meister
in diesen Briefen ausspricht, die vorzüglichsten
Seiten der Kunstwerke zu erkennen, statt der
mangelhaften, dann wird uns vor seinen Bildern
jene schöne stille Musik zu ertönen scheinen, von
der Wölfflin geschrieben hat.
* Was die „Stimmung" betrifft, so scheinen einige Werke
der mittleren Periode unter dem Einfluss von Giorgione, oder
wenn man will von Giorgione-Tizian entstanden zu sein. Ich
verweise auf: Römische Vigna, römische Landschaft (gemalt
1870-71), nackte Gestalten (gemalt 1874), Ekloge (nach 1875).
Allerdings sind sie mir nur aus Reproduktionen bekannt.
** Bei Fiedler.
*** Das eigene Gesicht des Künstlers war wohl häufig mass-
gebend.
368
obachten, ist interessant. Anfänglich nennt er „die
Wesen ohne Schnurrbart" Sirenen. Das Wort
„Dame"* hat bei ihm nicht die allerbeste Be-
deutung; am 19. September 1873 schreibt er, dass
die Damen die Männer gewöhnlich nur von
Leistung und Arbeit abhalten und im vorletzten
Schreiben meint er, der Künstler müsse von einer
liebenden und geliebten Frau verlangen, dass sie
ihn in der Liebe zu seinem Berufe und zu
dessen Ausübung unterstützt, nicht aber darin
hindert, was bei den meisten Damen zu be-
fürchten wäre. Vom neunten Briefe an — das
Wort soll zum erstenmal in der Sixtinischen Ka-
pelle gefallen sein —, wird ihm die angebetete
Gestalt zu einer Art von Doppelwesen, das ihm
zuweilen als Pallas Athene, der heldenbeschützenden
Göttin, zuweilen in ihrer Wirklichkeit gegenüber-
tritt. Und es ist, trotz der immer wiederkehrenden
scherzhaften Wendungen, genug Ernst dabei. Die
Sirenen verschwinden, ihr klingender Strand taucht
wieder ins Meer hinab; wenigstens wird die
„carissima e simpatichissima scolare" nicht mehr
zu ihnen gerechnet, ja, als Pallas schützt sie sogar
vor solchen Gefahren, wie einst den göttlichen
Odysseus.
Ich glaube, dass die meisten grossen Männer,
Napoleon und Bismarck zum Beispiel, zu den Künst-
lern zu rechnen sind, weil ihre Aussprüche das
verborgene Wesen der Dinge treffen, erhellen und
offenbaren. Die Persönlichkeit ist eben in allem
alles. Auch meine ich, dass Marees in seinen schnell
hingeschriebenen, nicht abgewogenen Briefen durch
die Erkenntniss des Wesentlichen, durch Anschau-
lichkeit und Phantasie sich künstlerisch wirksamer
erweist als unzählige Schriftsteller. Wie richtig
ist die Beschreibung der nächtlichen Seefahrt nach
Sorrent, wie wirklich erscheint die Bacchusphantasie
des XI. Briefes, wie scharf und hell ist der Spiegel,
worin er nachdenkend sich selbst erblickt. Und
herrlich ist das Wort an die vom Auge und Herzen
Erwählte: „Seien Sie ganz Sie selbst, auch gegen
mich!"
Eine malerische Vorstellung ist es, wenn er
sich nach den beiden zarten Händen erkundigt,
* Schopenhauer: „Die eigentliche europäische Dame ist ein
Wesen, welches nicht existieren sollte."
denen er gern die herrlichsten Rosen einfügen
möchte.
An Datierungen gewinnen wir Einiges. So
Beginn und Vollendung der Neapeler Fresken
(I. Freitag 18. VII. 1873: „Morgen beginnt die
Arbeit an den Mauern" und im IV. berichtet er den
Abschluss); wir hören vom florentinischen Kloster,
von Rom und Ischia. Im ersten Schreiben findet
sich, wohl auf Wunsch der jugendlichen Malerin,
eine kurze Anleitung zu einer naiven Erlernung
der Malerei, die er im folgenden als „seine schöne
Fleckentheorie" bezeichnet. Das scheint mit der
Art von der Pidoll berichtet im Widerspruch zu
sein: wir müssen aber einerseits bedenken, dass es
sich um eine Vorschule handelt und andrerseits,
dass über die Farbenbehandlung des Meisters noch
lange nicht das letzte Wort geschrieben ist. Wir
brauchen nur an seine Gewohnheit, die Figuren im
freien Himmelslichte darzustellen oder an seine
Ansichten über Farbe, Licht und Schatten zu
denken. Das ist eben an ihm wunderbar: wie er
uralten Kunstgesetzen die malerische Freiheit einer
neuen Zeit vereint.
Marees ist ganz er selbst geworden. Den Ab-
schluss seines Werkes bilden die Existenzbilder der
actas aurea, die man als stimmungsvolle Monu-
mentalmalerei, oder als monumentale Stimmungs-
bilder* bezeichen kann. Viele von ihnen wirken
wirklich wie der Künstler es wollte: „beruhigend,
wie nach dem Tage das Abendsonnenlicht".*"* Seine
Gestalten werden seine eigensten Gebilde; sie sind
wie Mitglieder einer mächtigen, weitverzweigten
Familie, man könnte von einer geschlossenen, dem
grossen Kunstreiche angehörenden Sippe sprechen.***
Wir wollen Sorge tragen, wie es der Meister
in diesen Briefen ausspricht, die vorzüglichsten
Seiten der Kunstwerke zu erkennen, statt der
mangelhaften, dann wird uns vor seinen Bildern
jene schöne stille Musik zu ertönen scheinen, von
der Wölfflin geschrieben hat.
* Was die „Stimmung" betrifft, so scheinen einige Werke
der mittleren Periode unter dem Einfluss von Giorgione, oder
wenn man will von Giorgione-Tizian entstanden zu sein. Ich
verweise auf: Römische Vigna, römische Landschaft (gemalt
1870-71), nackte Gestalten (gemalt 1874), Ekloge (nach 1875).
Allerdings sind sie mir nur aus Reproduktionen bekannt.
** Bei Fiedler.
*** Das eigene Gesicht des Künstlers war wohl häufig mass-
gebend.
368