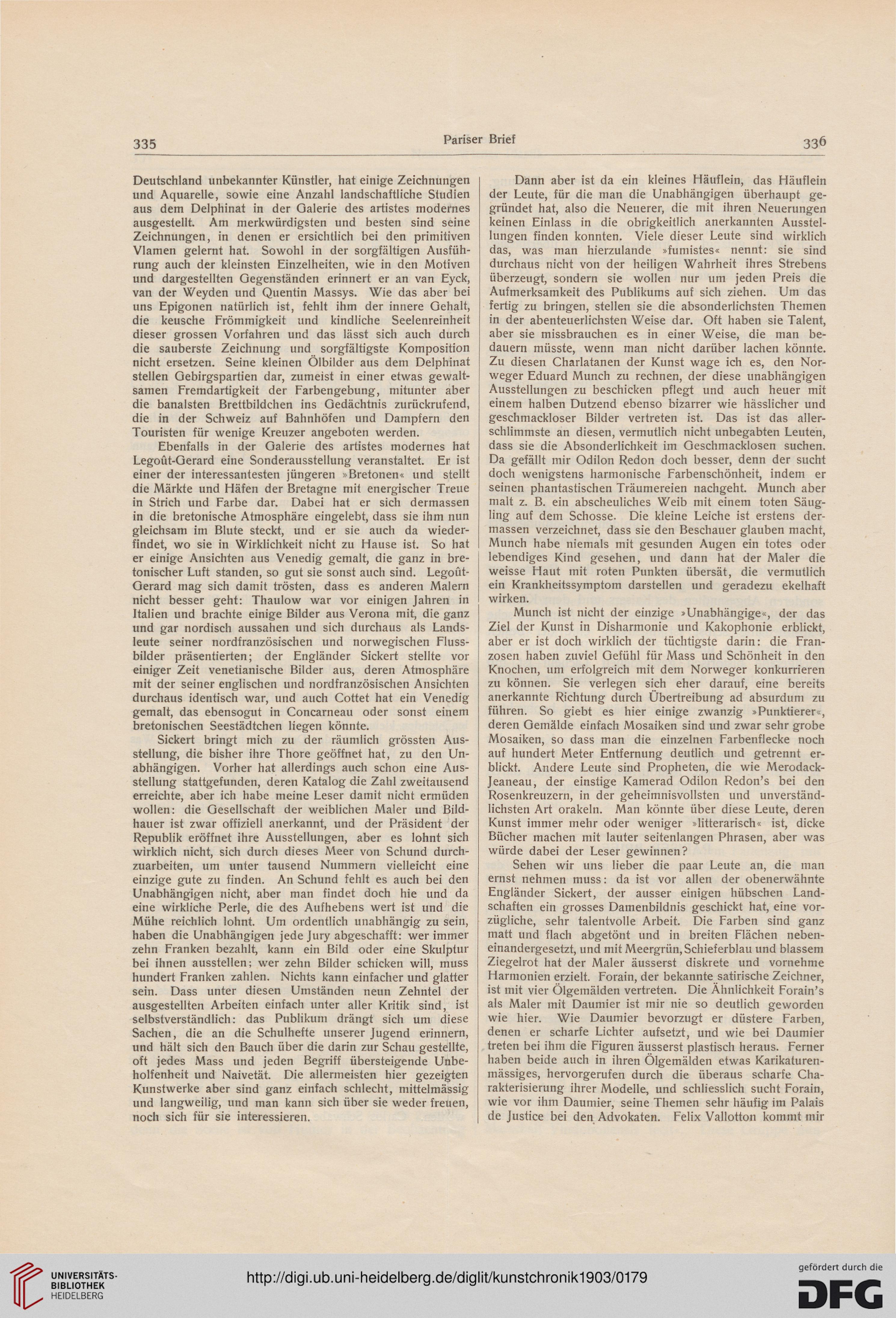335
Pariser Brief
336
Deutschland unbekannter Künstler, hat einige Zeichnungen
und Aquarelle, sowie eine Anzahl landschaftliche Studien
aus dem Delphinat in der Galerie des artistes modernes
ausgestellt. Am merkwürdigsten und besten sind seine
Zeichnungen, in denen er ersichtlich bei den primitiven
Vlamen gelernt hat. Sowohl in der sorgfältigen Ausfüh-
rung auch der kleinsten Einzelheiten, wie in den Motiven
und dargestellten Gegenständen erinnert er an van Eyck,
van der Weyden und Quentin Massys. Wie das aber bei
uns Epigonen natürlich ist, fehlt ihm der innere Gehalt,
die keusche Frömmigkeit und kindliche Seelenreinheit
dieser grossen Vorfahren und das lässt sich auch durch
die sauberste Zeichnung und sorgfältigste Komposition
nicht ersetzen. Seine kleinen Ölbilder aus dem Delphinat
stellen Gebirgspartien dar, zumeist in einer etwas gewalt-
samen Fremdartigkeit der Farbengebung, mitunter aber
die banalsten Brettbildchen ins Gedächtnis zurückrufend,
die in der Schweiz auf Bahnhöfen und Dampfern den
Touristen für wenige Kreuzer angeboten werden.
Ebenfalls in der Galerie des artistes modernes hat
Legoüt-Gerard eine Sonderausstellung veranstaltet. Er ist
einer der interessantesten jüngeren »Bretonen« und stellt
die Märkte und Häfen der Bretagne mit energischer Treue
in Strich und Farbe dar. Dabei hat er sich dermassen
in die bretonische Atmosphäre eingelebt, dass sie ihm nun
gleichsam im Blute steckt, und er sie auch da wieder-
findet, wo sie in Wirklichkeit nicht zu Hause ist. So hat
er einige Ansichten aus Venedig gemalt, die ganz in bre-
tonischer Luft standen, so gut sie sonst auch sind. Legoüt-
Gerard mag sich damit trösten, dass es anderen Malern
nicht besser geht: Thaulow war vor einigen Jahren in
Italien und brachte einige Bilder aus Verona mit, die ganz
und gar nordisch aussahen und sich durchaus als Lands-
leute seiner nordfranzösischen und norwegischen Fluss-
bilder präsentierten; der Engländer Sickert stellte vor
einiger Zeit venetianische Bilder aus, deren Atmosphäre
mit der seiner englischen und nordfranzösischen Ansichten
durchaus identisch war, und auch Cottet hat ein Venedig
gemalt, das ebensogut in Concarneau oder sonst einem
bretonischen Seestädtchen liegen könnte.
Sickert bringt mich zu der räumlich grössten Aus-
stellung, die bisher ihre Thore geöffnet hat, zu den Un-
abhängigen. Vorher hat allerdings auch schon eine Aus-
stellung stattgefunden, deren Katalog die Zahl zweitausend
erreichte, aber ich habe meine Leser damit nicht ermüden
wollen: die Gesellschaft der weiblichen Maler und Bild-
hauer ist zwar offiziell anerkannt, und der Präsident der
Republik eröffnet ihre Ausstellungen, aber es lohnt sich
wirklich nicht, sich durch dieses Meer von Schund durch-
zuarbeiten, um unter tausend Nummern vielleicht eine
einzige gute zu finden. An Schund fehlt es auch bei den
Unabhängigen nicht, aber man findet doch hie und da
eine wirkliche Perle, die des Aufhebens wert ist und die
Mühe reichlich lohnt. Um ordentlich unabhängig zu sein,
haben die Unabhängigen jede Jury abgeschafft: wer immer
zehn Franken bezahlt, kann ein Bild oder eine Skulptur
bei ihnen ausstellen; wer zehn Bilder schicken will, muss
hundert Franken zahlen. Nichts kann einfacher und glatter
sein. Dass unter diesen Umständen neun Zehntel der
ausgestellten Arbeiten einfach unter aller Kritik sind, ist
selbstverständlich: das Publikum drängt sich um diese
Sachen, die an die Schulhefte unserer Jugend erinnern,
und hält sich den Bauch über die darin zur Schau gestellte,
oft jedes Mass und jeden Begriff übersteigende Unbe-
holfenheit und Naivetät. Die allermeisten hier gezeigten
Kunstwerke aber sind ganz einfach schlecht, mittelmässig
und langweilig, und man kann sich über sie weder freuen,
noch sich für sie interessieren.
Dann aber ist da ein kleines Häuflein, das Häuflein
der Leute, für die man die Unabhängigen überhaupt ge-
gründet hat, also die Neuerer, die mit ihren Neuerungen
keinen Einlass in die obrigkeitlich anerkannten Ausstel-
lungen finden konnten. Viele dieser Leute sind wirklich
das, was man hierzulande »fumistes« nennt: sie sind
durchaus nicht von der heiligen Wahrheit ihres Strebens
überzeugt, sondern sie wollen nur um jeden Preis die
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Um das
fertig zu bringen, stellen sie die absonderlichsten Themen
in der abenteuerlichsten Weise dar. Oft haben sie Talent,
aber sie missbrauchen es in einer Weise, die man be-
dauern müsste, wenn man nicht darüber lachen könnte.
Zu diesen Charlatanen der Kunst wage ich es, den Nor-
weger Eduard Münch zu rechnen, der diese unabhängigen
Ausstellungen zu beschicken pflegt und auch heuer mit
einem halben Dutzend ebenso bizarrer wie hässlicher und
geschmackloser Bilder vertreten ist. Das ist das aller-
schlimmste an diesen, vermutlich nicht unbegabten Leuten,
dass sie die Absonderlichkeit im Geschmacklosen suchen.
Da gefällt mir Odilon Redon doch besser, denn der sucht
doch wenigstens harmonische Farbenschönheit, indem er
seinen phantastischen Träumereien nachgeht. Münch aber
malt z. B. ein abscheuliches Weib mit einem toten Säug-
ling auf dem Schosse. Die kleine Leiche ist erstens der-
massen verzeichnet, dass sie den Beschauer glauben macht,
Münch habe niemals mit gesunden Augen ein totes oder
lebendiges Kind gesehen, und dann hat der Maler die
weisse Haut mit roten Punkten übersät, die vermutlich
ein Krankheitssymptom darstellen und geradezu ekelhaft
wirken.
Münch ist nicht der einzige »Unabhängige«, der das
Ziel der Kunst in Disharmonie und Kakophonie erblickt,
aber er ist doch wirklich der tüchtigste darin: die Fran-
zosen haben zuviel Gefühl für Mass und Schönheit in den
Knochen, um erfolgreich mit dem Norweger konkurrieren
zu können. Sie verlegen sich eher darauf, eine bereits
anerkannte Richtung durch Übertreibung ad absurdum zu
führen. So giebt es hier einige zwanzig »Punktieren,
deren Gemälde einfach Mosaiken sind und zwar sehr grobe
Mosaiken, so dass man die einzelnen Farbenflecke noch
auf hundert Meter Entfernung deutlich und getrennt er-
blickt. Andere Leute sind Propheten, die wie Merodack-
Jeaneau, der einstige Kamerad Odilon Redon's bei den
Rosenkreuzern, in der geheimnisvollsten und unverständ-
lichsten Art orakeln. Man könnte über diese Leute, deren
Kunst immer mehr oder weniger »litterarisch« ist, dicke
Bücher machen mit lauter seitenlangen Phrasen, aber was
würde dabei der Leser gewinnen?
Sehen wir uns lieber die paar Leute an, die man
ernst nehmen muss: da ist vor allen der obenerwähnte
Engländer Sickert, der ausser einigen hübschen Land-
schaften ein grosses Damenbildnis geschickt hat, eine vor-
zügliche, sehr talentvolle Arbeit. Die Farben sind ganz
matt und flach abgetönt und in breiten Flächen neben-
einandergesetzt, und mit Meergrün, Schieferblau und blassem
Ziegelrot hat der Maler äusserst diskrete und vornehme
Harmonien erzielt. Forain, der bekannte satirische Zeichner,
ist mit vier Ölgemälden vertreten. Die Ähnlichkeit Forain's
als Maler mit Daumier ist mir nie so deutlich geworden
wie hier. Wie Daumier bevorzugt er düstere Farben,
denen er scharfe Lichter aufsetzt, und wie bei Daumier
treten bei ihm die Figuren äusserst plastisch heraus. Ferner
haben beide auch in ihren Ölgemälden etwas Karikaturen-
mässiges, hervorgerufen durch die überaus scharfe Cha-
rakterisierung ihrer Modelle, und schliesslich sucht Forain,
wie vor ihm Daumier, seine Themen sehr häufig im Palais
de Justice bei den Advokaten. Felix Vallotton kommt mir
Pariser Brief
336
Deutschland unbekannter Künstler, hat einige Zeichnungen
und Aquarelle, sowie eine Anzahl landschaftliche Studien
aus dem Delphinat in der Galerie des artistes modernes
ausgestellt. Am merkwürdigsten und besten sind seine
Zeichnungen, in denen er ersichtlich bei den primitiven
Vlamen gelernt hat. Sowohl in der sorgfältigen Ausfüh-
rung auch der kleinsten Einzelheiten, wie in den Motiven
und dargestellten Gegenständen erinnert er an van Eyck,
van der Weyden und Quentin Massys. Wie das aber bei
uns Epigonen natürlich ist, fehlt ihm der innere Gehalt,
die keusche Frömmigkeit und kindliche Seelenreinheit
dieser grossen Vorfahren und das lässt sich auch durch
die sauberste Zeichnung und sorgfältigste Komposition
nicht ersetzen. Seine kleinen Ölbilder aus dem Delphinat
stellen Gebirgspartien dar, zumeist in einer etwas gewalt-
samen Fremdartigkeit der Farbengebung, mitunter aber
die banalsten Brettbildchen ins Gedächtnis zurückrufend,
die in der Schweiz auf Bahnhöfen und Dampfern den
Touristen für wenige Kreuzer angeboten werden.
Ebenfalls in der Galerie des artistes modernes hat
Legoüt-Gerard eine Sonderausstellung veranstaltet. Er ist
einer der interessantesten jüngeren »Bretonen« und stellt
die Märkte und Häfen der Bretagne mit energischer Treue
in Strich und Farbe dar. Dabei hat er sich dermassen
in die bretonische Atmosphäre eingelebt, dass sie ihm nun
gleichsam im Blute steckt, und er sie auch da wieder-
findet, wo sie in Wirklichkeit nicht zu Hause ist. So hat
er einige Ansichten aus Venedig gemalt, die ganz in bre-
tonischer Luft standen, so gut sie sonst auch sind. Legoüt-
Gerard mag sich damit trösten, dass es anderen Malern
nicht besser geht: Thaulow war vor einigen Jahren in
Italien und brachte einige Bilder aus Verona mit, die ganz
und gar nordisch aussahen und sich durchaus als Lands-
leute seiner nordfranzösischen und norwegischen Fluss-
bilder präsentierten; der Engländer Sickert stellte vor
einiger Zeit venetianische Bilder aus, deren Atmosphäre
mit der seiner englischen und nordfranzösischen Ansichten
durchaus identisch war, und auch Cottet hat ein Venedig
gemalt, das ebensogut in Concarneau oder sonst einem
bretonischen Seestädtchen liegen könnte.
Sickert bringt mich zu der räumlich grössten Aus-
stellung, die bisher ihre Thore geöffnet hat, zu den Un-
abhängigen. Vorher hat allerdings auch schon eine Aus-
stellung stattgefunden, deren Katalog die Zahl zweitausend
erreichte, aber ich habe meine Leser damit nicht ermüden
wollen: die Gesellschaft der weiblichen Maler und Bild-
hauer ist zwar offiziell anerkannt, und der Präsident der
Republik eröffnet ihre Ausstellungen, aber es lohnt sich
wirklich nicht, sich durch dieses Meer von Schund durch-
zuarbeiten, um unter tausend Nummern vielleicht eine
einzige gute zu finden. An Schund fehlt es auch bei den
Unabhängigen nicht, aber man findet doch hie und da
eine wirkliche Perle, die des Aufhebens wert ist und die
Mühe reichlich lohnt. Um ordentlich unabhängig zu sein,
haben die Unabhängigen jede Jury abgeschafft: wer immer
zehn Franken bezahlt, kann ein Bild oder eine Skulptur
bei ihnen ausstellen; wer zehn Bilder schicken will, muss
hundert Franken zahlen. Nichts kann einfacher und glatter
sein. Dass unter diesen Umständen neun Zehntel der
ausgestellten Arbeiten einfach unter aller Kritik sind, ist
selbstverständlich: das Publikum drängt sich um diese
Sachen, die an die Schulhefte unserer Jugend erinnern,
und hält sich den Bauch über die darin zur Schau gestellte,
oft jedes Mass und jeden Begriff übersteigende Unbe-
holfenheit und Naivetät. Die allermeisten hier gezeigten
Kunstwerke aber sind ganz einfach schlecht, mittelmässig
und langweilig, und man kann sich über sie weder freuen,
noch sich für sie interessieren.
Dann aber ist da ein kleines Häuflein, das Häuflein
der Leute, für die man die Unabhängigen überhaupt ge-
gründet hat, also die Neuerer, die mit ihren Neuerungen
keinen Einlass in die obrigkeitlich anerkannten Ausstel-
lungen finden konnten. Viele dieser Leute sind wirklich
das, was man hierzulande »fumistes« nennt: sie sind
durchaus nicht von der heiligen Wahrheit ihres Strebens
überzeugt, sondern sie wollen nur um jeden Preis die
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Um das
fertig zu bringen, stellen sie die absonderlichsten Themen
in der abenteuerlichsten Weise dar. Oft haben sie Talent,
aber sie missbrauchen es in einer Weise, die man be-
dauern müsste, wenn man nicht darüber lachen könnte.
Zu diesen Charlatanen der Kunst wage ich es, den Nor-
weger Eduard Münch zu rechnen, der diese unabhängigen
Ausstellungen zu beschicken pflegt und auch heuer mit
einem halben Dutzend ebenso bizarrer wie hässlicher und
geschmackloser Bilder vertreten ist. Das ist das aller-
schlimmste an diesen, vermutlich nicht unbegabten Leuten,
dass sie die Absonderlichkeit im Geschmacklosen suchen.
Da gefällt mir Odilon Redon doch besser, denn der sucht
doch wenigstens harmonische Farbenschönheit, indem er
seinen phantastischen Träumereien nachgeht. Münch aber
malt z. B. ein abscheuliches Weib mit einem toten Säug-
ling auf dem Schosse. Die kleine Leiche ist erstens der-
massen verzeichnet, dass sie den Beschauer glauben macht,
Münch habe niemals mit gesunden Augen ein totes oder
lebendiges Kind gesehen, und dann hat der Maler die
weisse Haut mit roten Punkten übersät, die vermutlich
ein Krankheitssymptom darstellen und geradezu ekelhaft
wirken.
Münch ist nicht der einzige »Unabhängige«, der das
Ziel der Kunst in Disharmonie und Kakophonie erblickt,
aber er ist doch wirklich der tüchtigste darin: die Fran-
zosen haben zuviel Gefühl für Mass und Schönheit in den
Knochen, um erfolgreich mit dem Norweger konkurrieren
zu können. Sie verlegen sich eher darauf, eine bereits
anerkannte Richtung durch Übertreibung ad absurdum zu
führen. So giebt es hier einige zwanzig »Punktieren,
deren Gemälde einfach Mosaiken sind und zwar sehr grobe
Mosaiken, so dass man die einzelnen Farbenflecke noch
auf hundert Meter Entfernung deutlich und getrennt er-
blickt. Andere Leute sind Propheten, die wie Merodack-
Jeaneau, der einstige Kamerad Odilon Redon's bei den
Rosenkreuzern, in der geheimnisvollsten und unverständ-
lichsten Art orakeln. Man könnte über diese Leute, deren
Kunst immer mehr oder weniger »litterarisch« ist, dicke
Bücher machen mit lauter seitenlangen Phrasen, aber was
würde dabei der Leser gewinnen?
Sehen wir uns lieber die paar Leute an, die man
ernst nehmen muss: da ist vor allen der obenerwähnte
Engländer Sickert, der ausser einigen hübschen Land-
schaften ein grosses Damenbildnis geschickt hat, eine vor-
zügliche, sehr talentvolle Arbeit. Die Farben sind ganz
matt und flach abgetönt und in breiten Flächen neben-
einandergesetzt, und mit Meergrün, Schieferblau und blassem
Ziegelrot hat der Maler äusserst diskrete und vornehme
Harmonien erzielt. Forain, der bekannte satirische Zeichner,
ist mit vier Ölgemälden vertreten. Die Ähnlichkeit Forain's
als Maler mit Daumier ist mir nie so deutlich geworden
wie hier. Wie Daumier bevorzugt er düstere Farben,
denen er scharfe Lichter aufsetzt, und wie bei Daumier
treten bei ihm die Figuren äusserst plastisch heraus. Ferner
haben beide auch in ihren Ölgemälden etwas Karikaturen-
mässiges, hervorgerufen durch die überaus scharfe Cha-
rakterisierung ihrer Modelle, und schliesslich sucht Forain,
wie vor ihm Daumier, seine Themen sehr häufig im Palais
de Justice bei den Advokaten. Felix Vallotton kommt mir