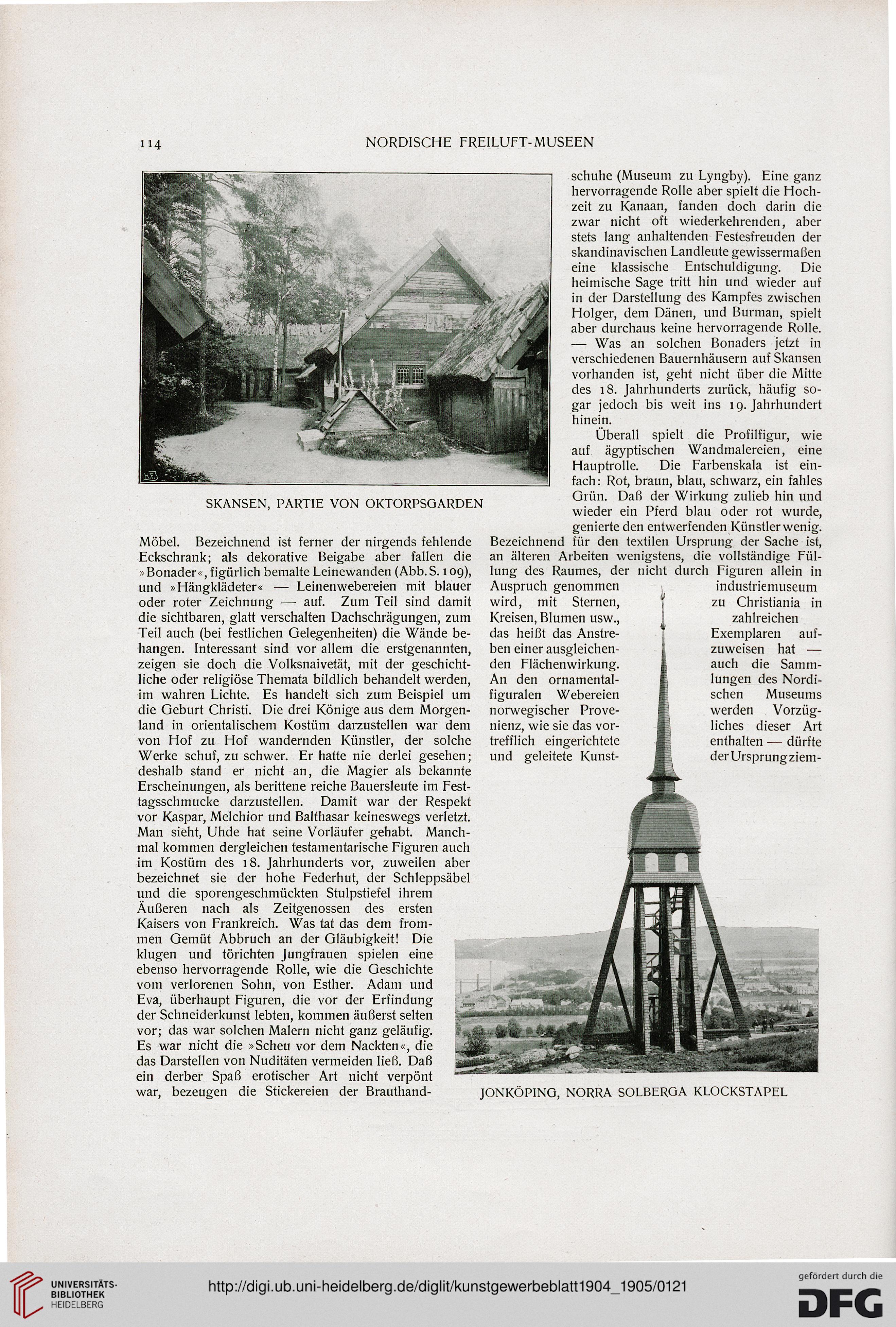114
NORDISCHE FREILUFT-MUSEEN
SKANSEN, PARTIE VON OKTORPSGARDEN
Möbel. Bezeichnend ist ferner der nirgends fehlende
Eckschrank; als dekorative Beigabe aber fallen die
»Bonader«, figürlich bemalte Leinewanden (Abb.S. 109),
und »Hängklädeter« — Leinenwebereien mit blauer
oder roter Zeichnung — auf. Zum Teil sind damit
die sichtbaren, glatt verschalten Dachschrägungen, zum
Teil auch (bei festlichen Gelegenheiten) die Wände be-
hangen. Interessant sind vor allem die erstgenannten,
zeigen sie doch die Volksnaivetät, mit der geschicht-
liche oder religiöse Themata bildlich behandelt werden,
im wahren Lichte. Es handelt sich zum Beispiel um
die Geburt Christi. Die drei Könige aus dem Morgen-
land in orientalischem Kostüm darzustellen war dem
von Hof zu Hof wandernden Künstler, der solche
Werke schuf, zu schwer. Er hatte nie derlei gesehen;
deshalb stand er nicht an, die Magier als bekannte
Erscheinungen, als berittene reiche Bauersleute im Fest-
tagsschmucke darzustellen. Damit war der Respekt
vor Kaspar, Melchior und Balthasar keineswegs verletzt.
Man sieht, Uhde hat seine Vorläufer gehabt. Manch-
mal kommen dergleichen testamentarische Figuren auch
im Kostüm des 18. Jahrhunderts vor, zuweilen aber
bezeichnet sie der hohe Federhut, der Schleppsäbel
und die sporengeschmückten Stulpstiefel ihrem
Äußeren nach als Zeitgenossen des ersten
Kaisers von Frankreich. Was tat das dem from-
men Gemüt Abbruch an der Gläubigkeit! Die
klugen und törichten Jungfrauen spielen eine
ebenso hervorragende Rolle, wie die Geschichte
vom verlorenen Sohn, von Esther. Adam und
Eva, überhaupt Figuren, die vor der Erfindung
der Schneiderkunst lebten, kommen äußerst selten
vor; das war solchen Malern nicht ganz geläufig.
Es war nicht die »Scheu vor dem Nackten«, die
das Darstellen von Nuditäten vermeiden ließ. Daß
derber Spaß erotischer Art nicht verpönt
schuhe (Museum zu Lyngby). Eine ganz
hervorragende Rolle aber spielt die Hoch-
zeit zu Kanaan, fanden doch darin die
zwar nicht oft wiederkehrenden, aber
stets lang anhaltenden Festesfreuden der
skandinavischen Landleute gewissermaßen
eine klassische Entschuldigung. Die
heimische Sage tritt hin und wieder auf
in der Darstellung des Kampfes zwischen
Holger, dem Dänen, und Burman, spielt
aber durchaus keine hervorragende Rolle.
— Was an solchen Bonaders jetzt in
verschiedenen Bauernhäusern auf Skansen
vorhanden ist, geht nicht über die Mitte
des 18. Jahrhunderts zurück, häufig so-
gar jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert
hinein.
Überall spielt die Profilfigur, wie
auf ägyptischen Wandmalereien, eine
Hauptrolle. Die Farbenskala ist ein-
fach: Rot, braun, blau, schwarz, ein fahles
Grün. Daß der Wirkung zulieb hin und
wieder ein Pferd blau oder rot wurde,
genierte den entwerfenden Künstler wenig.
Bezeichnend für den textilen Ursprung der Sache ist,
an älteren Arbeiten wenigstens, die vollständige Fül-
lung des Raumes, der nicht durch Figuren allein in
Auspruch genommen
wird, mit Sternen,
Kreisen, Blumen usw.,
das heißt das Anstre-
ben einer ausgleichen-
den Flächenwirkung.
An den ornamental-
figuralen Webereien
norwegischer Prove-
nienz, wie sie das vor-
trefflich eingerichtete
und geleitete Kunst-
industriemuseum
zu Christiania in
zahlreichen
Exemplaren auf-
zuweisen hat —
auch die Samm-
lungen des Nordi-
schen Museums
werden Vorzüg-
liches dieser Art
enthalten — dürfte
derUrsprungziem-
ein
war, bezeugen die Stickereien der Brauthand-
JONKÖPINO, NORRA SOLBERGA KLOCKSTAPEL
NORDISCHE FREILUFT-MUSEEN
SKANSEN, PARTIE VON OKTORPSGARDEN
Möbel. Bezeichnend ist ferner der nirgends fehlende
Eckschrank; als dekorative Beigabe aber fallen die
»Bonader«, figürlich bemalte Leinewanden (Abb.S. 109),
und »Hängklädeter« — Leinenwebereien mit blauer
oder roter Zeichnung — auf. Zum Teil sind damit
die sichtbaren, glatt verschalten Dachschrägungen, zum
Teil auch (bei festlichen Gelegenheiten) die Wände be-
hangen. Interessant sind vor allem die erstgenannten,
zeigen sie doch die Volksnaivetät, mit der geschicht-
liche oder religiöse Themata bildlich behandelt werden,
im wahren Lichte. Es handelt sich zum Beispiel um
die Geburt Christi. Die drei Könige aus dem Morgen-
land in orientalischem Kostüm darzustellen war dem
von Hof zu Hof wandernden Künstler, der solche
Werke schuf, zu schwer. Er hatte nie derlei gesehen;
deshalb stand er nicht an, die Magier als bekannte
Erscheinungen, als berittene reiche Bauersleute im Fest-
tagsschmucke darzustellen. Damit war der Respekt
vor Kaspar, Melchior und Balthasar keineswegs verletzt.
Man sieht, Uhde hat seine Vorläufer gehabt. Manch-
mal kommen dergleichen testamentarische Figuren auch
im Kostüm des 18. Jahrhunderts vor, zuweilen aber
bezeichnet sie der hohe Federhut, der Schleppsäbel
und die sporengeschmückten Stulpstiefel ihrem
Äußeren nach als Zeitgenossen des ersten
Kaisers von Frankreich. Was tat das dem from-
men Gemüt Abbruch an der Gläubigkeit! Die
klugen und törichten Jungfrauen spielen eine
ebenso hervorragende Rolle, wie die Geschichte
vom verlorenen Sohn, von Esther. Adam und
Eva, überhaupt Figuren, die vor der Erfindung
der Schneiderkunst lebten, kommen äußerst selten
vor; das war solchen Malern nicht ganz geläufig.
Es war nicht die »Scheu vor dem Nackten«, die
das Darstellen von Nuditäten vermeiden ließ. Daß
derber Spaß erotischer Art nicht verpönt
schuhe (Museum zu Lyngby). Eine ganz
hervorragende Rolle aber spielt die Hoch-
zeit zu Kanaan, fanden doch darin die
zwar nicht oft wiederkehrenden, aber
stets lang anhaltenden Festesfreuden der
skandinavischen Landleute gewissermaßen
eine klassische Entschuldigung. Die
heimische Sage tritt hin und wieder auf
in der Darstellung des Kampfes zwischen
Holger, dem Dänen, und Burman, spielt
aber durchaus keine hervorragende Rolle.
— Was an solchen Bonaders jetzt in
verschiedenen Bauernhäusern auf Skansen
vorhanden ist, geht nicht über die Mitte
des 18. Jahrhunderts zurück, häufig so-
gar jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert
hinein.
Überall spielt die Profilfigur, wie
auf ägyptischen Wandmalereien, eine
Hauptrolle. Die Farbenskala ist ein-
fach: Rot, braun, blau, schwarz, ein fahles
Grün. Daß der Wirkung zulieb hin und
wieder ein Pferd blau oder rot wurde,
genierte den entwerfenden Künstler wenig.
Bezeichnend für den textilen Ursprung der Sache ist,
an älteren Arbeiten wenigstens, die vollständige Fül-
lung des Raumes, der nicht durch Figuren allein in
Auspruch genommen
wird, mit Sternen,
Kreisen, Blumen usw.,
das heißt das Anstre-
ben einer ausgleichen-
den Flächenwirkung.
An den ornamental-
figuralen Webereien
norwegischer Prove-
nienz, wie sie das vor-
trefflich eingerichtete
und geleitete Kunst-
industriemuseum
zu Christiania in
zahlreichen
Exemplaren auf-
zuweisen hat —
auch die Samm-
lungen des Nordi-
schen Museums
werden Vorzüg-
liches dieser Art
enthalten — dürfte
derUrsprungziem-
ein
war, bezeugen die Stickereien der Brauthand-
JONKÖPINO, NORRA SOLBERGA KLOCKSTAPEL