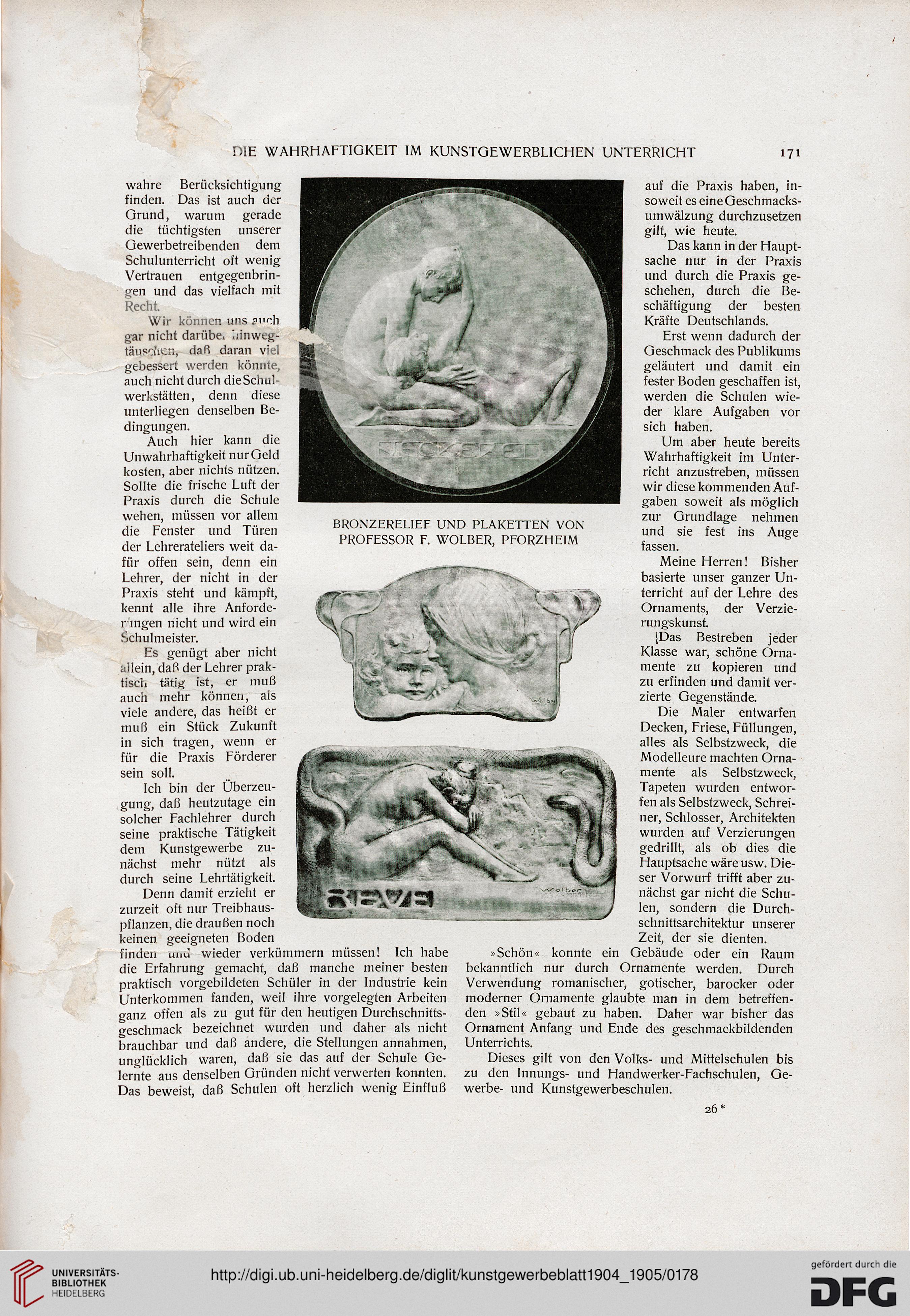DIE WAHRHAFTIGKEIT IM KUNSTGEWERBLICHEN UNTERRICHT
171
vv
wahre Berücksichtigung
finden. Das ist auch der
Grund, warum gerade
die tüchtigsten unserer
Gewerbetreibenden dem
Schulunterricht oft wenig
Vertrauen entgegenbrin-
gen und das vielfach mit
Recht.
Wir können uns ?i'oh
gar nicht darübe. ".n'nweg-
täusa'icn, daß daran viel
gebessert werden könnte,
auch nicht durch die Schul-
werkstätten , denn diese
unterliegen denselben Be-
dingungen.
Auch hier kann die
Unwahrhaftigkeit nurGeld
kosten, aber nichts nützen.
Sollte die frische Luft der
Praxis durch die Schule
wehen, müssen vor allem
die Fenster und Türen
der Lehrerateliers weit da-
für offen sein, denn ein
Lehrer, der nicht in der
Praxis steht und kämpft,
kennt alle ihre Anforde-
ringen nicht und wird ein
Schulmeister.
Es genügt aber nicht
allein, daß der Lehrer prak-
tisch tätig ist, er muß
auch mehr können, als
viele andere, das heißt er
muß ein Stück Zukunft
in sich tragen, wenn er
für die Praxis Förderer
sein soll.
Ich bin der Überzeu-
gung, daß heutzutage ein
solcher Fachlehrer durch
seine praktische Tätigkeit
dem Kunstgewerbe zu-
nächst mehr nützt als
durch seine Lehrtätigkeit.
Denn damit erzieht er
zurzeit oft nur Treibhaus-
pflanzen, die draußen noch
keinen geeigneten Boden
finden uuü wieder verkümmern müssen! Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß manche meiner besten
praktisch vorgebildeten Schüler in der Industrie kein
Unterkommen fanden, weil ihre vorgelegten Arbeiten
ganz offen als zu gut für den heutigen Durchschnitts-
geschmack bezeichnet wurden und daher als nicht
brauchbar und daß andere, die Stellungen annahmen,
unglücklich waren, daß sie das auf der Schule Ge-
lernte aus denselben Gründen nicht verwerten konnten.
Das beweist, daß Schulen oft herzlich wenig Einfluß
BRONZERELIEF UND PLAKETTEN VON
PROFESSOR F. WOLBER, PFORZHEIM
^N
Ä
auf die Praxis haben, in-
soweit es eine Geschmacks-
umwälzung durchzusetzen
gilt, wie heute.
Das kann in der Haupt-
sache nur in der Praxis
und durch die Praxis ge-
schehen, durch die Be-
schäftigung der besten
Kräfte Deutschlands.
Erst wenn dadurch der
Geschmack des Publikums
geläutert und damit ein
fester Boden geschaffen ist,
werden die Schulen wie-
der klare Aufgaben vor
sich haben.
Um aber heute bereits
Wahrhaftigkeit im Unter-
richt anzustreben, müssen
wir diese kommenden Auf-
gaben soweit als möglich
zur Grundlage nehmen
und sie fest ins Auge
fassen.
Meine Herren! Bisher
basierte unser ganzer Un-
terricht auf der Lehre des
Ornaments, der Verzie-
rungskunst.
[Das Bestreben jeder
Klasse war, schöne Orna-
mente zu kopieren und
zu erfinden und damit ver-
zierte Gegenstände.
Die Maler entwarfen
Decken, Friese, Füllungen,
alles als Selbstzweck, die
Modelleure machten Orna-
mente als Selbstzweck,
Tapeten wurden entwor-
fen als Selbstzweck, Schrei-
ner, Schlosser, Architekten
wurden auf Verzierungen
gedrillt, als ob dies die
Hauptsache wäre usw. Die-
ser Vorwurf trifft aber zu-
nächst gar nicht die Schu-
len, sondern die Durch-
schnittsarchitektur unserer
Zeit, der sie dienten.
»Schön« konnte ein Gebäude oder ein Raum
bekanntlich nur durch Ornamente werden. Durch
Verwendung romanischer, gotischer, barocker oder
moderner Ornamente glaubte man in dem betreffen-
den »Stil« gebaut zu haben. Daher war bisher das
Ornament Anfang und Ende des geschmackbildenden
Unterrichts.
Dieses gilt von den Volks- und Mittelschulen bis
zu den Innungs- und Handwerker-Fachschulen, Ge-
werbe- und Kunstgewerbeschulen.
26*
171
vv
wahre Berücksichtigung
finden. Das ist auch der
Grund, warum gerade
die tüchtigsten unserer
Gewerbetreibenden dem
Schulunterricht oft wenig
Vertrauen entgegenbrin-
gen und das vielfach mit
Recht.
Wir können uns ?i'oh
gar nicht darübe. ".n'nweg-
täusa'icn, daß daran viel
gebessert werden könnte,
auch nicht durch die Schul-
werkstätten , denn diese
unterliegen denselben Be-
dingungen.
Auch hier kann die
Unwahrhaftigkeit nurGeld
kosten, aber nichts nützen.
Sollte die frische Luft der
Praxis durch die Schule
wehen, müssen vor allem
die Fenster und Türen
der Lehrerateliers weit da-
für offen sein, denn ein
Lehrer, der nicht in der
Praxis steht und kämpft,
kennt alle ihre Anforde-
ringen nicht und wird ein
Schulmeister.
Es genügt aber nicht
allein, daß der Lehrer prak-
tisch tätig ist, er muß
auch mehr können, als
viele andere, das heißt er
muß ein Stück Zukunft
in sich tragen, wenn er
für die Praxis Förderer
sein soll.
Ich bin der Überzeu-
gung, daß heutzutage ein
solcher Fachlehrer durch
seine praktische Tätigkeit
dem Kunstgewerbe zu-
nächst mehr nützt als
durch seine Lehrtätigkeit.
Denn damit erzieht er
zurzeit oft nur Treibhaus-
pflanzen, die draußen noch
keinen geeigneten Boden
finden uuü wieder verkümmern müssen! Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß manche meiner besten
praktisch vorgebildeten Schüler in der Industrie kein
Unterkommen fanden, weil ihre vorgelegten Arbeiten
ganz offen als zu gut für den heutigen Durchschnitts-
geschmack bezeichnet wurden und daher als nicht
brauchbar und daß andere, die Stellungen annahmen,
unglücklich waren, daß sie das auf der Schule Ge-
lernte aus denselben Gründen nicht verwerten konnten.
Das beweist, daß Schulen oft herzlich wenig Einfluß
BRONZERELIEF UND PLAKETTEN VON
PROFESSOR F. WOLBER, PFORZHEIM
^N
Ä
auf die Praxis haben, in-
soweit es eine Geschmacks-
umwälzung durchzusetzen
gilt, wie heute.
Das kann in der Haupt-
sache nur in der Praxis
und durch die Praxis ge-
schehen, durch die Be-
schäftigung der besten
Kräfte Deutschlands.
Erst wenn dadurch der
Geschmack des Publikums
geläutert und damit ein
fester Boden geschaffen ist,
werden die Schulen wie-
der klare Aufgaben vor
sich haben.
Um aber heute bereits
Wahrhaftigkeit im Unter-
richt anzustreben, müssen
wir diese kommenden Auf-
gaben soweit als möglich
zur Grundlage nehmen
und sie fest ins Auge
fassen.
Meine Herren! Bisher
basierte unser ganzer Un-
terricht auf der Lehre des
Ornaments, der Verzie-
rungskunst.
[Das Bestreben jeder
Klasse war, schöne Orna-
mente zu kopieren und
zu erfinden und damit ver-
zierte Gegenstände.
Die Maler entwarfen
Decken, Friese, Füllungen,
alles als Selbstzweck, die
Modelleure machten Orna-
mente als Selbstzweck,
Tapeten wurden entwor-
fen als Selbstzweck, Schrei-
ner, Schlosser, Architekten
wurden auf Verzierungen
gedrillt, als ob dies die
Hauptsache wäre usw. Die-
ser Vorwurf trifft aber zu-
nächst gar nicht die Schu-
len, sondern die Durch-
schnittsarchitektur unserer
Zeit, der sie dienten.
»Schön« konnte ein Gebäude oder ein Raum
bekanntlich nur durch Ornamente werden. Durch
Verwendung romanischer, gotischer, barocker oder
moderner Ornamente glaubte man in dem betreffen-
den »Stil« gebaut zu haben. Daher war bisher das
Ornament Anfang und Ende des geschmackbildenden
Unterrichts.
Dieses gilt von den Volks- und Mittelschulen bis
zu den Innungs- und Handwerker-Fachschulen, Ge-
werbe- und Kunstgewerbeschulen.
26*