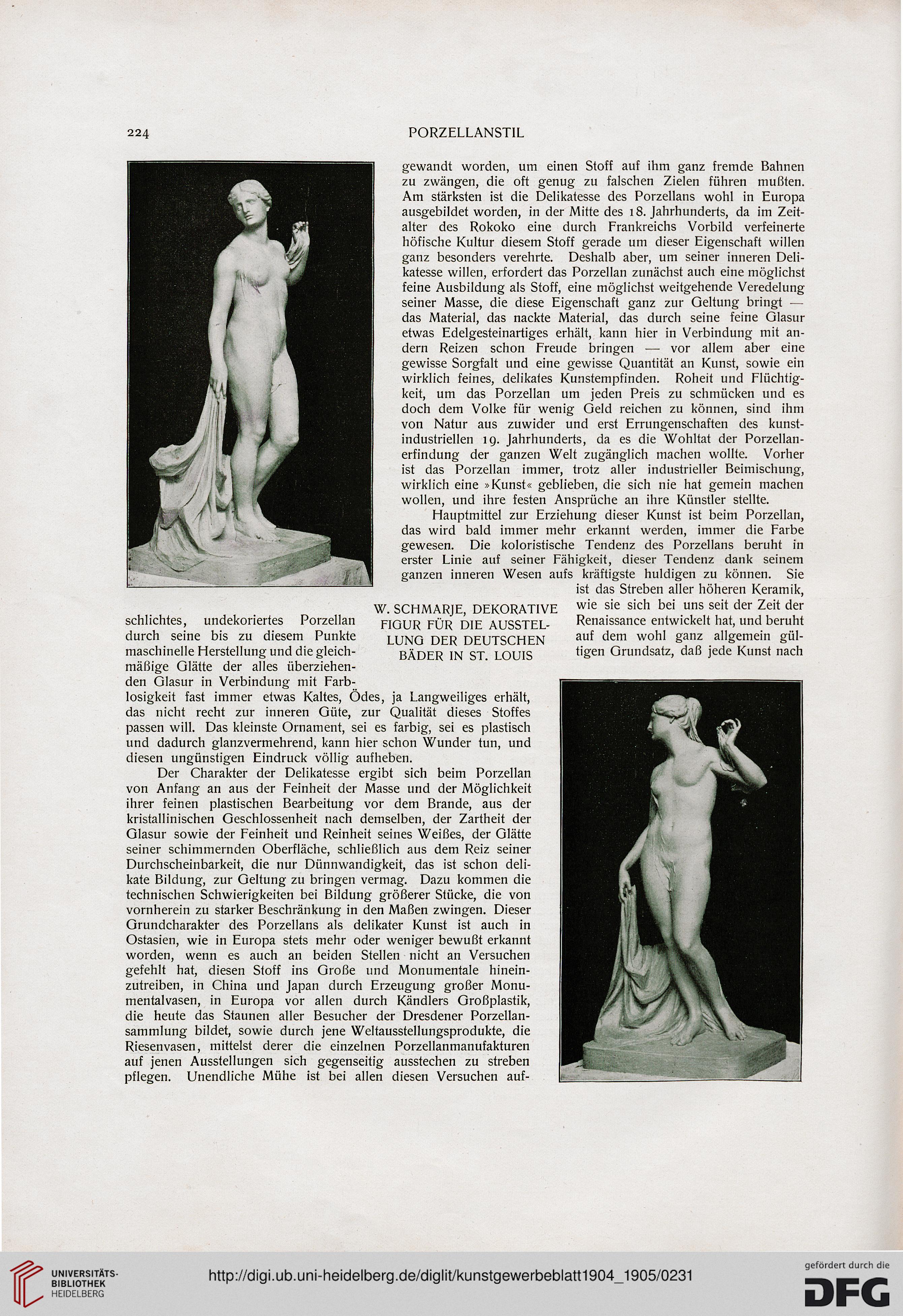224
PORZELLANSTIL
HBlj
s 1
■
Vi,
1 m • Ia
I %A
PV "
> N_ '"'
schlichtes, undekoriertes Porzellan
durch seine bis zu diesem Punkte
maschinelle Herstellung und die gleich-
mäßige Glätte der alles überziehen-
den Glasur in Verbindung mit Farb-
losigkeit fast immer etwas Kaltes, Ödes, ja Langweiliges erhält,
das nicht recht zur inneren Güte, zur Qualität dieses Stoffes
passen will. Das kleinste Ornament, sei es farbig, sei es plastisch
und dadurch glanzvermehrend, kann hier schon Wunder tun, und
diesen ungünstigen Eindruck völlig aufheben.
Der Charakter der Delikatesse ergibt sich beim Porzellan
von Anfang an aus der Feinheit der Masse und der Möglichkeit
ihrer feinen plastischen Bearbeitung vor dem Brande, aus der
kristallinischen Geschlossenheit nach demselben, der Zartheit der
Glasur sowie der Feinheit und Reinheit seines Weißes, der Glätte
seiner schimmernden Oberfläche, schließlich aus dem Reiz seiner
Durchscheinbarkeit, die nur Dünnwandigkeit, das ist schon deli-
kate Bildung, zur Geltung zu bringen vermag. Dazu kommen die
technischen Schwierigkeiten bei Bildung größerer Stücke, die von
vornherein zu starker Beschränkung in den Maßen zwingen. Dieser
Grundcharakter des Porzellans als delikater Kunst ist auch in
Ostasien, wie in Europa stets mehr oder weniger bewußt erkannt
worden, wenn es auch an beiden Stellen nicht an Versuchen
gefehlt hat, diesen Stoff ins Große und Monumentale hinein-
zutreiben, in China und Japan durch Erzeugung großer Monu-
mentalvasen, in Europa vor allen durch Kändlers Großplastik,
die heute das Staunen aller Besucher der Dresdener Porzellan-
sammlung bildet, sowie durch jene Weltausstellungsprodukte, die
Riesenvasen, mittelst derer die einzelnen Porzellanmanufakturen
auf jenen Ausstellungen sich gegenseitig ausstechen zu streben
pflegen. Unendliche Mühe ist bei allen diesen Versuchen auf-
gewandt worden, um einen Stoff auf ihm ganz fremde Bahnen
zu zwängen, die oft genug zu falschen Zielen führen mußten.
Am stärksten ist die Delikatesse des Porzellans wohl in Europa
ausgebildet worden, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da im Zeit-
alter des Rokoko eine durch Frankreichs Vorbild verfeinerte
höfische Kultur diesem Stoff gerade um dieser Eigenschaft willen
ganz besonders verehrte. Deshalb aber, um seiner inneren Deli-
katesse willen, erfordert das Porzellan zunächst auch eine möglichst
feine Ausbildung als Stoff, eine möglichst weitgehende Veredelung
seiner Masse, die diese Eigenschaft ganz zur Geltung bringt —
das Material, das nackte Material, das durch seine feine Glasur
etwas Edelgesteinartiges erhält, kann hier in Verbindung mit an-
dern Reizen schon Freude bringen — vor allem aber eine
gewisse Sorgfalt und eine gewisse Quantität an Kunst, sowie ein
wirklich feines, delikates Kunstempfinden. Roheit und Flüchtig-
keit, um das Porzellan um jeden Preis zu schmücken und es
doch dem Volke für wenig Geld reichen zu können, sind ihm
von Natur aus zuwider und erst Errungenschaften des kunst-
industriellen ig. Jahrhunderts, da es die Wohltat der Porzellan-
erfindung der ganzen Welt zugänglich machen wollte. Vorher
ist das Porzellan immer, trotz aller industrieller Beimischung,
wirklich eine »Kunst« geblieben, die sich nie hat gemein machen
wollen, und ihre festen Ansprüche an ihre Künstler stellte.
Hauptmittel zur Erziehung dieser Kunst ist beim Porzellan,
das wird bald immer mehr erkannt werden, immer die Farbe
gewesen. Die koloristische Tendenz des Porzellans beruht in
erster Linie auf seiner Fähigkeit, dieser Tendenz dank seinem
ganzen inneren Wesen aufs kräftigste huldigen zu können. Sie
ist das Streben aller höheren Keramik,
wie sie sich bei uns seit der Zeit der
Renaissance entwickelt hat, und beruht
auf dem wohl ganz allgemein gül-
tigen Grundsatz, daß jede Kunst nach
W. SCHMARJE, DEKORATIVE
FIGUR FÜR DIE AUSSTEL-
LUNG DER DEUTSCHEN
BÄDER IN ST. LOUIS
PORZELLANSTIL
HBlj
s 1
■
Vi,
1 m • Ia
I %A
PV "
> N_ '"'
schlichtes, undekoriertes Porzellan
durch seine bis zu diesem Punkte
maschinelle Herstellung und die gleich-
mäßige Glätte der alles überziehen-
den Glasur in Verbindung mit Farb-
losigkeit fast immer etwas Kaltes, Ödes, ja Langweiliges erhält,
das nicht recht zur inneren Güte, zur Qualität dieses Stoffes
passen will. Das kleinste Ornament, sei es farbig, sei es plastisch
und dadurch glanzvermehrend, kann hier schon Wunder tun, und
diesen ungünstigen Eindruck völlig aufheben.
Der Charakter der Delikatesse ergibt sich beim Porzellan
von Anfang an aus der Feinheit der Masse und der Möglichkeit
ihrer feinen plastischen Bearbeitung vor dem Brande, aus der
kristallinischen Geschlossenheit nach demselben, der Zartheit der
Glasur sowie der Feinheit und Reinheit seines Weißes, der Glätte
seiner schimmernden Oberfläche, schließlich aus dem Reiz seiner
Durchscheinbarkeit, die nur Dünnwandigkeit, das ist schon deli-
kate Bildung, zur Geltung zu bringen vermag. Dazu kommen die
technischen Schwierigkeiten bei Bildung größerer Stücke, die von
vornherein zu starker Beschränkung in den Maßen zwingen. Dieser
Grundcharakter des Porzellans als delikater Kunst ist auch in
Ostasien, wie in Europa stets mehr oder weniger bewußt erkannt
worden, wenn es auch an beiden Stellen nicht an Versuchen
gefehlt hat, diesen Stoff ins Große und Monumentale hinein-
zutreiben, in China und Japan durch Erzeugung großer Monu-
mentalvasen, in Europa vor allen durch Kändlers Großplastik,
die heute das Staunen aller Besucher der Dresdener Porzellan-
sammlung bildet, sowie durch jene Weltausstellungsprodukte, die
Riesenvasen, mittelst derer die einzelnen Porzellanmanufakturen
auf jenen Ausstellungen sich gegenseitig ausstechen zu streben
pflegen. Unendliche Mühe ist bei allen diesen Versuchen auf-
gewandt worden, um einen Stoff auf ihm ganz fremde Bahnen
zu zwängen, die oft genug zu falschen Zielen führen mußten.
Am stärksten ist die Delikatesse des Porzellans wohl in Europa
ausgebildet worden, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da im Zeit-
alter des Rokoko eine durch Frankreichs Vorbild verfeinerte
höfische Kultur diesem Stoff gerade um dieser Eigenschaft willen
ganz besonders verehrte. Deshalb aber, um seiner inneren Deli-
katesse willen, erfordert das Porzellan zunächst auch eine möglichst
feine Ausbildung als Stoff, eine möglichst weitgehende Veredelung
seiner Masse, die diese Eigenschaft ganz zur Geltung bringt —
das Material, das nackte Material, das durch seine feine Glasur
etwas Edelgesteinartiges erhält, kann hier in Verbindung mit an-
dern Reizen schon Freude bringen — vor allem aber eine
gewisse Sorgfalt und eine gewisse Quantität an Kunst, sowie ein
wirklich feines, delikates Kunstempfinden. Roheit und Flüchtig-
keit, um das Porzellan um jeden Preis zu schmücken und es
doch dem Volke für wenig Geld reichen zu können, sind ihm
von Natur aus zuwider und erst Errungenschaften des kunst-
industriellen ig. Jahrhunderts, da es die Wohltat der Porzellan-
erfindung der ganzen Welt zugänglich machen wollte. Vorher
ist das Porzellan immer, trotz aller industrieller Beimischung,
wirklich eine »Kunst« geblieben, die sich nie hat gemein machen
wollen, und ihre festen Ansprüche an ihre Künstler stellte.
Hauptmittel zur Erziehung dieser Kunst ist beim Porzellan,
das wird bald immer mehr erkannt werden, immer die Farbe
gewesen. Die koloristische Tendenz des Porzellans beruht in
erster Linie auf seiner Fähigkeit, dieser Tendenz dank seinem
ganzen inneren Wesen aufs kräftigste huldigen zu können. Sie
ist das Streben aller höheren Keramik,
wie sie sich bei uns seit der Zeit der
Renaissance entwickelt hat, und beruht
auf dem wohl ganz allgemein gül-
tigen Grundsatz, daß jede Kunst nach
W. SCHMARJE, DEKORATIVE
FIGUR FÜR DIE AUSSTEL-
LUNG DER DEUTSCHEN
BÄDER IN ST. LOUIS