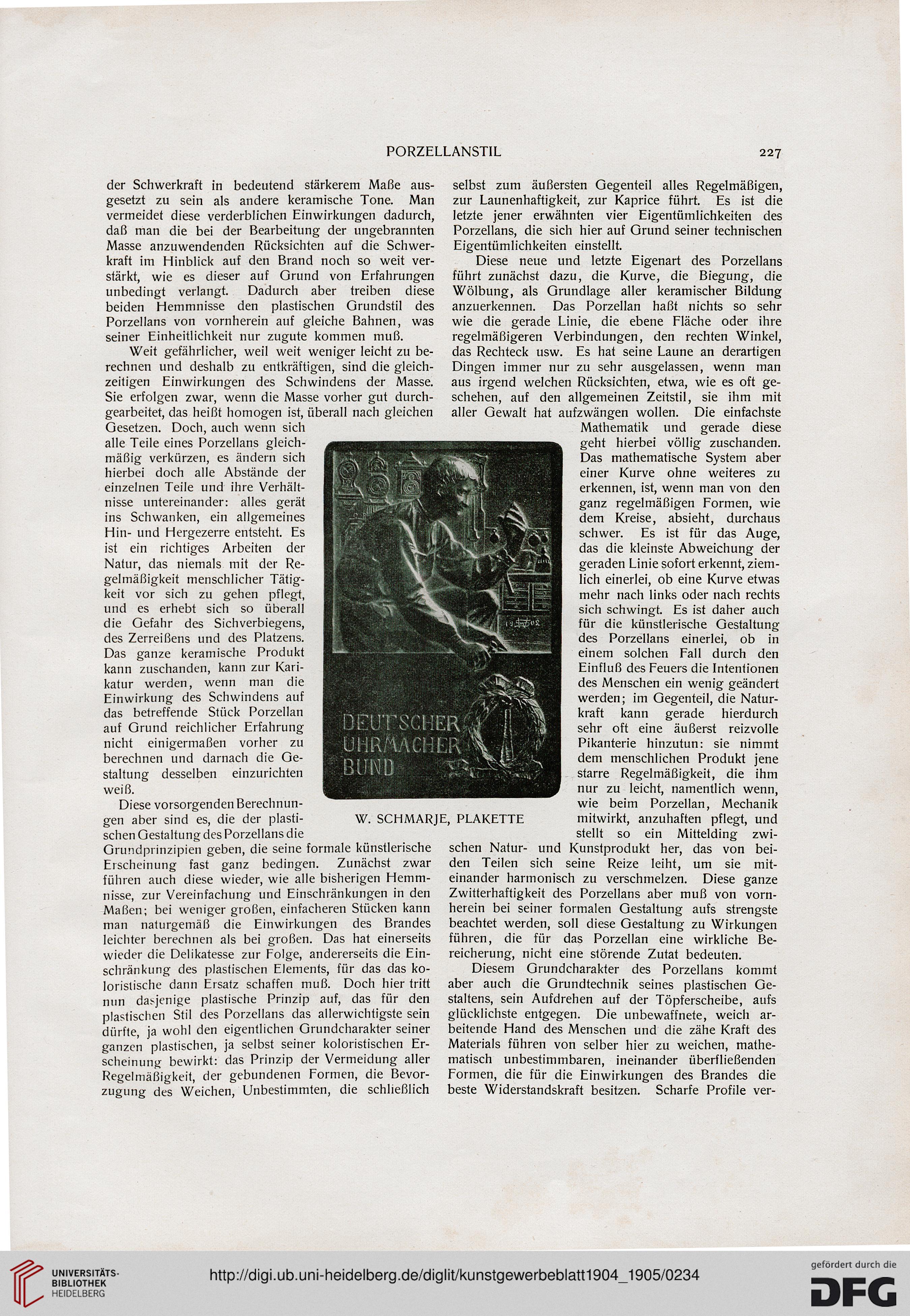PORZELLANSTIL
227
der Schwerkraft in bedeutend stärkerem Maße aus-
gesetzt zu sein als andere keramische Tone. Man
vermeidet diese verderblichen Einwirkungen dadurch,
daß man die bei der Bearbeitung der ungebrannten
Masse anzuwendenden Rücksichten auf die Schwer-
kraft im Hinblick auf den Brand noch so weit ver-
stärkt, wie es dieser auf Grund von Erfahrungen
unbedingt verlangt. Dadurch aber treiben diese
beiden Hemmnisse den plastischen Grundstil des
Porzellans von vornherein auf gleiche Bahnen, was
seiner Einheitlichkeit nur zugute kommen muß.
Weit gefährlicher, weil weit weniger leicht zu be-
rechnen und deshalb zu entkräftigen, sind die gleich-
zeitigen Einwirkungen des Schwindens der Masse.
Sie erfolgen zwar, wenn die Masse vorher gut durch-
gearbeitet, das heißt homogen ist, überall nach gleichen
Gesetzen. Doch, auch wenn sich
alle Teile eines Porzellans gleich-
mäßig verkürzen, es ändern sich
hierbei doch alle Abstände der
einzelnen Teile und ihre Verhält-
nisse untereinander: alles gerät
ins Schwanken, ein allgemeines
Hin- und Hergezerre entsteht. Es
ist ein richtiges Arbeiten der
Natur, das niemals mit der Re-
gelmäßigkeit menschlicher Tätig-
keit vor sich zu gehen pflegt,
und es erhebt sich so überall
die Gefahr des Sichverbiegens,
des Zerreißens und des Platzens.
Das ganze keramische Produkt
kann zuschanden, kann zur Kari-
katur werden, wenn man die
Einwirkung des Schwindens auf
das betreffende Stück Porzellan
auf Grund reichlicher Erfahrung
nicht einigermaßen vorher zu
berechnen und darnach die Ge-
staltung desselben einzurichten
weiß.
Diese vorsorgenden Berechnun-
gen aber sind es, die der plasti-
schen Gestaltung des Porzellans die
Grundprinzipien geben, die seine formale künstlerische
Erscheinung fast ganz bedingen. Zunächst zwar
führen auch diese wieder, wie alle bisherigen Hemm-
nisse, zur Vereinfachung und Einschränkungen in den
Maßen; bei weniger großen, einfacheren Stücken kann
man naturgemäß die Einwirkungen des Brandes
leichter berechnen als bei großen. Das hat einerseits
wieder die Delikatesse zur Folge, andererseits die Ein-
schränkung des plastischen Elements, für das das ko-
loristische dann Ersatz schaffen muß. Doch hier tritt
nun dasjenige plastische Prinzip auf, das für den
plastischen Stil des Porzellans das allerwichtigste sein
dürfte, ja wohl den eigentlichen Grundcharakter seiner
ganzen plastischen, ja selbst seiner koloristischen Er-
scheinung bewirkt: das Prinzip der Vermeidung aller
Regelmäßigkeit, der gebundenen Formen, die Bevor-
zugung des Weichen, Unbestimmten, die schließlich
r
\
fit?.\ ifQri
1 J 1... v ■ l O V» 1
UHRÄACI
W. SCHMARJE, PLAKETTE
selbst zum äußersten Gegenteil alles Regelmäßigen,
zur Launenhaftigkeit, zur Kaprice führt. Es ist die
letzte jener erwähnten vier Eigentümlichkeiten des
Porzellans, die sich hier auf Grund seiner technischen
Eigentümlichkeiten einstellt.
Diese neue und letzte Eigenart des Porzellans
führt zunächst dazu, die Kurve, die Biegung, die
Wölbung, als Grundlage aller keramischer Bildung
anzuerkennen. Das Porzellan haßt nichts so sehr
wie die gerade Linie, die ebene Fläche oder ihre
regelmäßigeren Verbindungen, den rechten Winkel,
das Rechteck usw. Es hat seine Laune an derartigen
Dingen immer nur zu sehr ausgelassen, wenn man
aus irgend welchen Rücksichten, etwa, wie es oft ge-
schehen, auf den allgemeinen Zeitstil, sie ihm mit
aller Gewalt hat aufzwängen wollen. Die einfachste
Mathematik und gerade diese
geht hierbei völlig zuschanden.
Das mathematische System aber
einer Kurve ohne weiteres zu
erkennen, ist, wenn man von den
ganz regelmäßigen Formen, wie
dem Kreise, absieht, durchaus
schwer. Es ist für das Auge,
das die kleinste Abweichung der
geraden Linie sofort erkennt, ziem-
lich einerlei, ob eine Kurve etwas
mehr nach links oder nach rechts
sich schwingt. Es ist daher auch
für die künstlerische Gestaltung
des Porzellans einerlei, ob in
einem solchen Fall durch den
Einfluß des Feuers die Intentionen
des Menschen ein wenig geändert
werden; im Gegenteil, die Natur-
kraft kann gerade hierdurch
sehr oft eine äußerst reizvolle
Pikanterie hinzutun: sie nimmt
dem menschlichen Produkt jene
starre Regelmäßigkeit, die ihm
nur zu leicht, namentlich wenn,
wie beim Porzellan, Mechanik
mitwirkt, anzuhaften pflegt, und
stellt so ein Mittelding zwi-
schen Natur- und Kunstprodukt her, das von bei-
den Teilen sich seine Reize leiht, um sie mit-
einander harmonisch zu verschmelzen. Diese ganze
Zwitterhaftigkeit des Porzellans aber muß von vorn-
herein bei seiner formalen Gestaltung aufs strengste
beachtet werden, soll diese Gestaltung zu Wirkungen
führen, die für das Porzellan eine wirkliche Be-
reicherung, nicht eine störende Zutat bedeuten.
Diesem Grundcharakter des Porzellans kommt
aber auch die Grundtechnik seines plastischen Ge-
staltens, sein Aufdrehen auf der Töpferscheibe, aufs
glücklichste entgegen. Die unbewaffnete, weich ar-
beitende Hand des Menschen und die zähe Kraft des
Materials führen von selber hier zu weichen, mathe-
matisch unbestimmbaren, ineinander überfließenden
Formen, die für die Einwirkungen des Brandes die
beste Widerstandskraft besitzen. Scharfe Profile ver-
227
der Schwerkraft in bedeutend stärkerem Maße aus-
gesetzt zu sein als andere keramische Tone. Man
vermeidet diese verderblichen Einwirkungen dadurch,
daß man die bei der Bearbeitung der ungebrannten
Masse anzuwendenden Rücksichten auf die Schwer-
kraft im Hinblick auf den Brand noch so weit ver-
stärkt, wie es dieser auf Grund von Erfahrungen
unbedingt verlangt. Dadurch aber treiben diese
beiden Hemmnisse den plastischen Grundstil des
Porzellans von vornherein auf gleiche Bahnen, was
seiner Einheitlichkeit nur zugute kommen muß.
Weit gefährlicher, weil weit weniger leicht zu be-
rechnen und deshalb zu entkräftigen, sind die gleich-
zeitigen Einwirkungen des Schwindens der Masse.
Sie erfolgen zwar, wenn die Masse vorher gut durch-
gearbeitet, das heißt homogen ist, überall nach gleichen
Gesetzen. Doch, auch wenn sich
alle Teile eines Porzellans gleich-
mäßig verkürzen, es ändern sich
hierbei doch alle Abstände der
einzelnen Teile und ihre Verhält-
nisse untereinander: alles gerät
ins Schwanken, ein allgemeines
Hin- und Hergezerre entsteht. Es
ist ein richtiges Arbeiten der
Natur, das niemals mit der Re-
gelmäßigkeit menschlicher Tätig-
keit vor sich zu gehen pflegt,
und es erhebt sich so überall
die Gefahr des Sichverbiegens,
des Zerreißens und des Platzens.
Das ganze keramische Produkt
kann zuschanden, kann zur Kari-
katur werden, wenn man die
Einwirkung des Schwindens auf
das betreffende Stück Porzellan
auf Grund reichlicher Erfahrung
nicht einigermaßen vorher zu
berechnen und darnach die Ge-
staltung desselben einzurichten
weiß.
Diese vorsorgenden Berechnun-
gen aber sind es, die der plasti-
schen Gestaltung des Porzellans die
Grundprinzipien geben, die seine formale künstlerische
Erscheinung fast ganz bedingen. Zunächst zwar
führen auch diese wieder, wie alle bisherigen Hemm-
nisse, zur Vereinfachung und Einschränkungen in den
Maßen; bei weniger großen, einfacheren Stücken kann
man naturgemäß die Einwirkungen des Brandes
leichter berechnen als bei großen. Das hat einerseits
wieder die Delikatesse zur Folge, andererseits die Ein-
schränkung des plastischen Elements, für das das ko-
loristische dann Ersatz schaffen muß. Doch hier tritt
nun dasjenige plastische Prinzip auf, das für den
plastischen Stil des Porzellans das allerwichtigste sein
dürfte, ja wohl den eigentlichen Grundcharakter seiner
ganzen plastischen, ja selbst seiner koloristischen Er-
scheinung bewirkt: das Prinzip der Vermeidung aller
Regelmäßigkeit, der gebundenen Formen, die Bevor-
zugung des Weichen, Unbestimmten, die schließlich
r
\
fit?.\ ifQri
1 J 1... v ■ l O V» 1
UHRÄACI
W. SCHMARJE, PLAKETTE
selbst zum äußersten Gegenteil alles Regelmäßigen,
zur Launenhaftigkeit, zur Kaprice führt. Es ist die
letzte jener erwähnten vier Eigentümlichkeiten des
Porzellans, die sich hier auf Grund seiner technischen
Eigentümlichkeiten einstellt.
Diese neue und letzte Eigenart des Porzellans
führt zunächst dazu, die Kurve, die Biegung, die
Wölbung, als Grundlage aller keramischer Bildung
anzuerkennen. Das Porzellan haßt nichts so sehr
wie die gerade Linie, die ebene Fläche oder ihre
regelmäßigeren Verbindungen, den rechten Winkel,
das Rechteck usw. Es hat seine Laune an derartigen
Dingen immer nur zu sehr ausgelassen, wenn man
aus irgend welchen Rücksichten, etwa, wie es oft ge-
schehen, auf den allgemeinen Zeitstil, sie ihm mit
aller Gewalt hat aufzwängen wollen. Die einfachste
Mathematik und gerade diese
geht hierbei völlig zuschanden.
Das mathematische System aber
einer Kurve ohne weiteres zu
erkennen, ist, wenn man von den
ganz regelmäßigen Formen, wie
dem Kreise, absieht, durchaus
schwer. Es ist für das Auge,
das die kleinste Abweichung der
geraden Linie sofort erkennt, ziem-
lich einerlei, ob eine Kurve etwas
mehr nach links oder nach rechts
sich schwingt. Es ist daher auch
für die künstlerische Gestaltung
des Porzellans einerlei, ob in
einem solchen Fall durch den
Einfluß des Feuers die Intentionen
des Menschen ein wenig geändert
werden; im Gegenteil, die Natur-
kraft kann gerade hierdurch
sehr oft eine äußerst reizvolle
Pikanterie hinzutun: sie nimmt
dem menschlichen Produkt jene
starre Regelmäßigkeit, die ihm
nur zu leicht, namentlich wenn,
wie beim Porzellan, Mechanik
mitwirkt, anzuhaften pflegt, und
stellt so ein Mittelding zwi-
schen Natur- und Kunstprodukt her, das von bei-
den Teilen sich seine Reize leiht, um sie mit-
einander harmonisch zu verschmelzen. Diese ganze
Zwitterhaftigkeit des Porzellans aber muß von vorn-
herein bei seiner formalen Gestaltung aufs strengste
beachtet werden, soll diese Gestaltung zu Wirkungen
führen, die für das Porzellan eine wirkliche Be-
reicherung, nicht eine störende Zutat bedeuten.
Diesem Grundcharakter des Porzellans kommt
aber auch die Grundtechnik seines plastischen Ge-
staltens, sein Aufdrehen auf der Töpferscheibe, aufs
glücklichste entgegen. Die unbewaffnete, weich ar-
beitende Hand des Menschen und die zähe Kraft des
Materials führen von selber hier zu weichen, mathe-
matisch unbestimmbaren, ineinander überfließenden
Formen, die für die Einwirkungen des Brandes die
beste Widerstandskraft besitzen. Scharfe Profile ver-