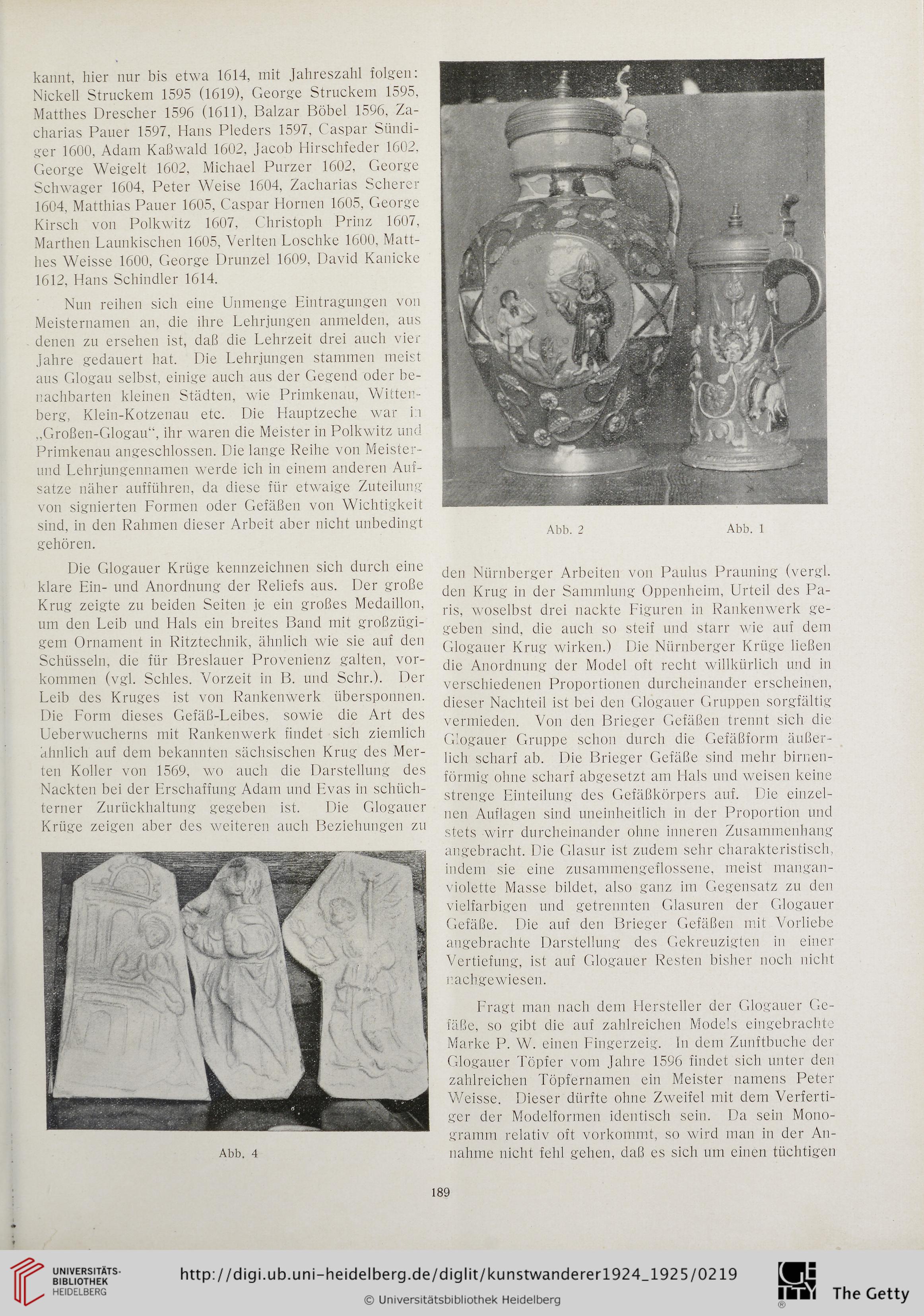kamit, hier nur bis etwa 1614, mit Jahreszahl folgen:
Nickell Struckem 1595 (1619), George Struckem 1595,
Matthes Drescher 1596 (1611), Balzar Böbel 1596, Za-
charias Pauer 1597, Hans Pleders 1597, Caspar Sündi-
ger 1600, Adam Kaßwald 1602, Jacob Hirschfeder 1602,
George Weigelt 1602, Michael Purzer 1602, George
Schwager 1604, Peter Weise 1604, Zacharias Scherer
1604, Matthias Pauer 1605, Caspar Hornen 1605, George
Kirsch von Polkwitz 1607, Ghristoph Prinz 1607,
Marthen Launkischen 1605, Verlten Loschke 1600, Matt-
hes Weisse 1600, George Drunzel 1609, David Kanicke
1612, Hans Schindler 1614.
Nun reihen sich eine Unmenge Eintragungen von
Meisternamen an, die ihre Lehrjungen anmelden, aus
denen zu ersehen ist, daß die Lehrzeit drei auch vier
Jahre gedauert hat. Die Lehrjungen stammen meist
aus Glogau selbst, einige auch aus der Gegend oder be-
nachbarten kleinen Städten, wie Primkenau, Witten-
berg, Klein-Kotzenau etc. Die Hauptzeche war i:i
„Großen-Glogau“, ihr waren die Meister in Polkwitz und
Primkenau angeschlossen. Die lange Reihe von Meister-
und Lehrjungennamen werde ich in einem anderen Auf-
satze näher aufführen, da diese für etwaige Zuteilung
von signierten Formen oder Gefäßen von Wichtigkeit
sind, in den Rahmen dieser Arbeit aber nicht unbedingt
gehören.
Die Glogauer Krüge kennzeichnen sich durch eine
klare Ein- und Anordnung der Reliefs aus. Der große
Krug zeigte zu beiden Seiten je ein großes Medaillon,
um den Leib und Hals ein breites Band mit großzügi-
gem Ornament in Ritztechnik, ähnlich wie sie auf den
Schüsseln, die für Breslauer Provenienz galten, vor-
kommen (vgl. Schles. Vorzeit in B. und Schr.). Der
Leib des Kruges ist von Rankenwerk übersponnen.
Die Form dieses Gefäß-Leibes, sowie die Art des
Ueberwucherns mit Rankenwerk findet sich ziemlich
ühnlich auf dem bekannten sächsischen Krug des Mer-
ten Koller von 1569, wo auch die Darstellung des
Nackten bei der Erschaffung Adam und Evas in schüch-
terner Zurückhaltung gegeben ist. Die Glogauer
Krüge zeigen aber des weiteren auch Beziehungen zu
Abb. 4
Abb. 2 Abb. 1
den Niirnberger Arbeiten von Paulus Prauning (vergl.
den Krug in der Sammlung Oppenheim, Urteil des Pa-
ris, woselbst drei nackte Figuren in Rankenwerk ge-
geben sind, die auch so steif und starr wie auf dem
Glogauer Krug wirken.) IJie Niirnberger Krüge ließen
die Anordnung der Model oft recht willkürlich und in
verschiedenen Proportionen durcheinander erscheinen,
dieser Nachteil ist bei den Glogauer Gruppen sorgfältig
vermieden. Von den Brieger Gefäßen trennt sich die
Giogauer Gruppe schon durcli die Gefäßform äußer-
lich scharf ab. Die Brieger Gefäße sind melir birnen-
förmig ohne scharf abgesetzt am Hals und weisen keine
strenge Einteilung des Gefäßkörpers auf. Die einzel-
nen Auflagen sind uneinheitlich in der Proportion und
stets wirr durcheinander ohne inneren Zusammenhang
angebracht. Die Glasur ist zudem sehr charakteristisch,
indem sie eine zusammengeflossene, meist mangan-
violette Masse bildet, also ganz im Gegensatz zu den
vielfarbigen und getrennten Glasuren der Glogauer
Gefäße. Die auf den Brieger Gefäßen mit Vorliebe
angebrachte Darstellung des Gekreuzigten in einer
Vertiefung, ist auf Glogauer Resten bisher noch nicht
r.achgewiesen.
Fragt man nach dem Hersteller der Glogauer Ge-
fäße, so gibt die auf zahlreichen Models eingebrachte
Marke P. W. einen Eingerzeig. In dem Zunftbuche der
Glogauer Töpfer vom Jahre 1596 findet sich unter den
zahlreichen Töpfernamen ein Meister namens Peter
Weisse. Dieser diirfte ohne Zweifel mit dem Verferti-
ger der Modelformen identisch sein. Da sein Mono-
gramm relativ oft vorkommt, so wird man in der An-
nahme niclit fehl gelien, daß es sicli um einen tüchtigen
189
Nickell Struckem 1595 (1619), George Struckem 1595,
Matthes Drescher 1596 (1611), Balzar Böbel 1596, Za-
charias Pauer 1597, Hans Pleders 1597, Caspar Sündi-
ger 1600, Adam Kaßwald 1602, Jacob Hirschfeder 1602,
George Weigelt 1602, Michael Purzer 1602, George
Schwager 1604, Peter Weise 1604, Zacharias Scherer
1604, Matthias Pauer 1605, Caspar Hornen 1605, George
Kirsch von Polkwitz 1607, Ghristoph Prinz 1607,
Marthen Launkischen 1605, Verlten Loschke 1600, Matt-
hes Weisse 1600, George Drunzel 1609, David Kanicke
1612, Hans Schindler 1614.
Nun reihen sich eine Unmenge Eintragungen von
Meisternamen an, die ihre Lehrjungen anmelden, aus
denen zu ersehen ist, daß die Lehrzeit drei auch vier
Jahre gedauert hat. Die Lehrjungen stammen meist
aus Glogau selbst, einige auch aus der Gegend oder be-
nachbarten kleinen Städten, wie Primkenau, Witten-
berg, Klein-Kotzenau etc. Die Hauptzeche war i:i
„Großen-Glogau“, ihr waren die Meister in Polkwitz und
Primkenau angeschlossen. Die lange Reihe von Meister-
und Lehrjungennamen werde ich in einem anderen Auf-
satze näher aufführen, da diese für etwaige Zuteilung
von signierten Formen oder Gefäßen von Wichtigkeit
sind, in den Rahmen dieser Arbeit aber nicht unbedingt
gehören.
Die Glogauer Krüge kennzeichnen sich durch eine
klare Ein- und Anordnung der Reliefs aus. Der große
Krug zeigte zu beiden Seiten je ein großes Medaillon,
um den Leib und Hals ein breites Band mit großzügi-
gem Ornament in Ritztechnik, ähnlich wie sie auf den
Schüsseln, die für Breslauer Provenienz galten, vor-
kommen (vgl. Schles. Vorzeit in B. und Schr.). Der
Leib des Kruges ist von Rankenwerk übersponnen.
Die Form dieses Gefäß-Leibes, sowie die Art des
Ueberwucherns mit Rankenwerk findet sich ziemlich
ühnlich auf dem bekannten sächsischen Krug des Mer-
ten Koller von 1569, wo auch die Darstellung des
Nackten bei der Erschaffung Adam und Evas in schüch-
terner Zurückhaltung gegeben ist. Die Glogauer
Krüge zeigen aber des weiteren auch Beziehungen zu
Abb. 4
Abb. 2 Abb. 1
den Niirnberger Arbeiten von Paulus Prauning (vergl.
den Krug in der Sammlung Oppenheim, Urteil des Pa-
ris, woselbst drei nackte Figuren in Rankenwerk ge-
geben sind, die auch so steif und starr wie auf dem
Glogauer Krug wirken.) IJie Niirnberger Krüge ließen
die Anordnung der Model oft recht willkürlich und in
verschiedenen Proportionen durcheinander erscheinen,
dieser Nachteil ist bei den Glogauer Gruppen sorgfältig
vermieden. Von den Brieger Gefäßen trennt sich die
Giogauer Gruppe schon durcli die Gefäßform äußer-
lich scharf ab. Die Brieger Gefäße sind melir birnen-
förmig ohne scharf abgesetzt am Hals und weisen keine
strenge Einteilung des Gefäßkörpers auf. Die einzel-
nen Auflagen sind uneinheitlich in der Proportion und
stets wirr durcheinander ohne inneren Zusammenhang
angebracht. Die Glasur ist zudem sehr charakteristisch,
indem sie eine zusammengeflossene, meist mangan-
violette Masse bildet, also ganz im Gegensatz zu den
vielfarbigen und getrennten Glasuren der Glogauer
Gefäße. Die auf den Brieger Gefäßen mit Vorliebe
angebrachte Darstellung des Gekreuzigten in einer
Vertiefung, ist auf Glogauer Resten bisher noch nicht
r.achgewiesen.
Fragt man nach dem Hersteller der Glogauer Ge-
fäße, so gibt die auf zahlreichen Models eingebrachte
Marke P. W. einen Eingerzeig. In dem Zunftbuche der
Glogauer Töpfer vom Jahre 1596 findet sich unter den
zahlreichen Töpfernamen ein Meister namens Peter
Weisse. Dieser diirfte ohne Zweifel mit dem Verferti-
ger der Modelformen identisch sein. Da sein Mono-
gramm relativ oft vorkommt, so wird man in der An-
nahme niclit fehl gelien, daß es sicli um einen tüchtigen
189