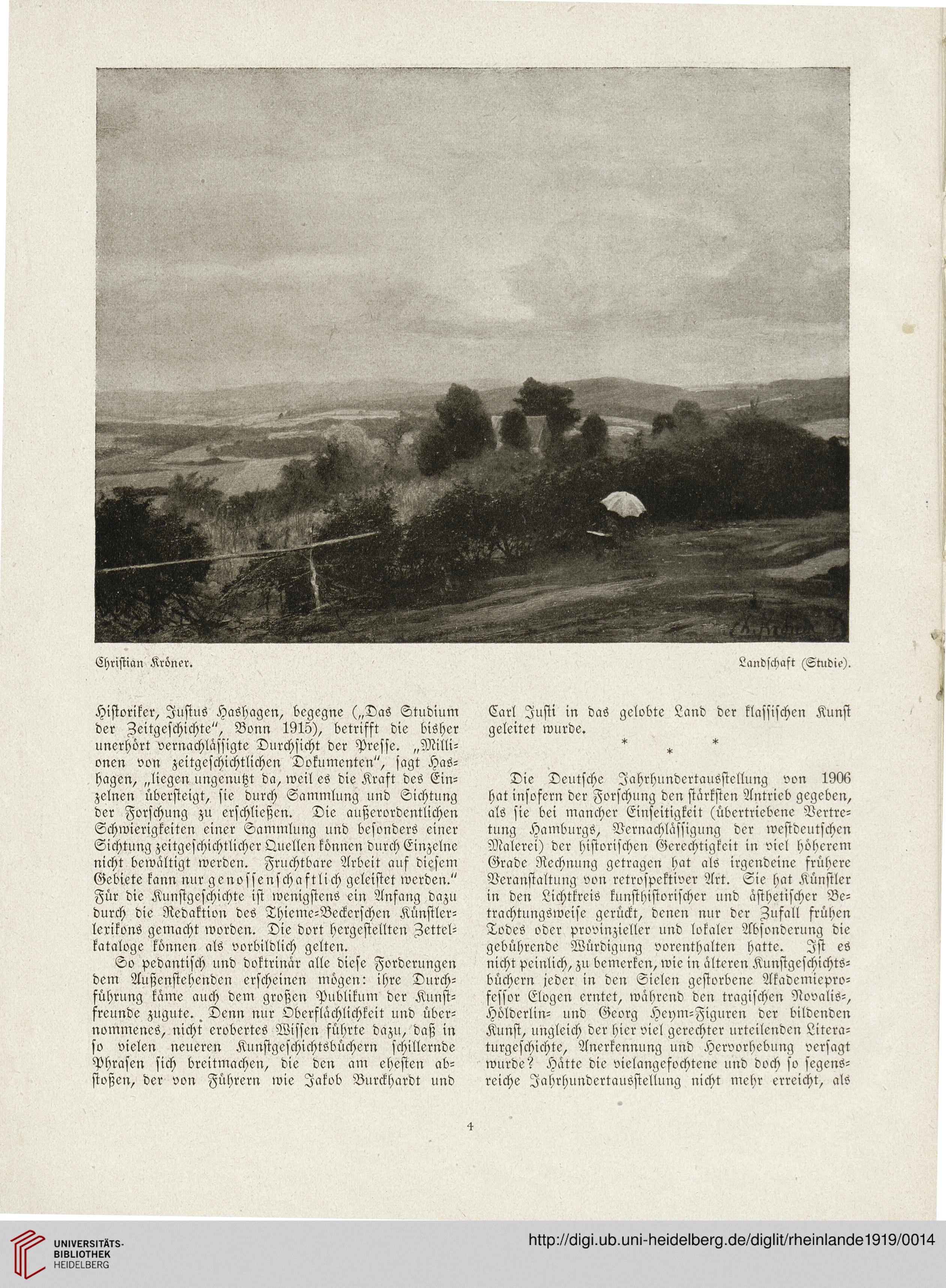Christian Kröner.
Landschaft (Studie).
Historiker, Justus Hashagen, begegne („Das Studium
der Zeitgeschichte", Bonn 1915), betrifft die bisher
unerhört vernachlassigte Durchsicht der Presse. „Milli-
onen von zeitgeschichtlichen Dokumenten", sagt Has-
hagen, „liegen ungenutzt da, weil es die Kraft des Ein-
zelnen übersteigt, sie durch Samntlung und Sichtung
der Forschung zu erschließen. Die außerordentlichen
Schwierigkeiten einer Sanimlung und besonders einer
Sichtung zeitgeschichtlicher Quellen können durch Einzelne
nicht bewaltigt werden. Fruchtbare Arbeit auf diesem
Gebiete kann nur genossenschaftlich geleistet werden."
Für die Kunstgeschichte ist wenigstcns ein Anfang dazu
durch die Redaktion des Thieme-Beckerschen Künstler-
lerikons gemacht worden. Die dort hergestellten Aettel-
kataloge können als vorbildlich gelten.
So pedantisch und doktrinär alle diese Forderungen
dem Außenstehenden erscheinen mögen: ihre Durch-
führung kame auch dem großen Publikum der Kunst-
freunde zugute., Denn nur Oberflächlichkeit und über-
nommenes, nicht erobertes Wissen führte dazu, daß in
so vielen neueren Kunstgeschichtsbüchern schillernde
Phrasen sich breitmachen, die den am ehesten ab-
stoßen, der von Führern wie Jakob Burckhardt und
Carl Justi in das gelobte Land der klassischen Kunst
geleitet wurde.
4- 4-
4-
Die Deutsche Jahrhundertausstellung von 1906
hat insofcrn der Forschung den stärksten Antrieb gegeben,
als sie bei mancher Einseitigkeit (übertriebene Vertre-
tung Hamburgs, Vernachlässigung der westdeutschen
Malerei) der historischen Gerechtigkeit in vicl höherem
Grade Rechnung getragen hat als irgendeine frühere
Veranstaltung von retrospektiver Art. Sie hat Künstler
in den Lichtkreis kunsthistorischer und ästhetischer Be-
trachtungswcise gerückt, denen nur der Aufall frühen
Todes oder provinzieller und lokaler Abfonderung die
gebührende Würdigung vorenthalten hatte. Jst es
nicht peinlich, zu bemerken, wie in älteren Kunstgeschichts-
büchern jeder in den Sielen gestorbene Akademiepro-
fessor Elogen erntet, während den tragischen Novalis-,
Hölderlin- und Georg Heym-Figuren der bildenden
Kunst, ungleich der hier viel gerechter urteilenden Litera-
turgeschichte, Anerkennung und Hervorhebung versagt
wurde? Hätte dic vielangefochtene und doch so segens-
reiche Jahrhundertausstellung nicht mehr erreicht, als
Landschaft (Studie).
Historiker, Justus Hashagen, begegne („Das Studium
der Zeitgeschichte", Bonn 1915), betrifft die bisher
unerhört vernachlassigte Durchsicht der Presse. „Milli-
onen von zeitgeschichtlichen Dokumenten", sagt Has-
hagen, „liegen ungenutzt da, weil es die Kraft des Ein-
zelnen übersteigt, sie durch Samntlung und Sichtung
der Forschung zu erschließen. Die außerordentlichen
Schwierigkeiten einer Sanimlung und besonders einer
Sichtung zeitgeschichtlicher Quellen können durch Einzelne
nicht bewaltigt werden. Fruchtbare Arbeit auf diesem
Gebiete kann nur genossenschaftlich geleistet werden."
Für die Kunstgeschichte ist wenigstcns ein Anfang dazu
durch die Redaktion des Thieme-Beckerschen Künstler-
lerikons gemacht worden. Die dort hergestellten Aettel-
kataloge können als vorbildlich gelten.
So pedantisch und doktrinär alle diese Forderungen
dem Außenstehenden erscheinen mögen: ihre Durch-
führung kame auch dem großen Publikum der Kunst-
freunde zugute., Denn nur Oberflächlichkeit und über-
nommenes, nicht erobertes Wissen führte dazu, daß in
so vielen neueren Kunstgeschichtsbüchern schillernde
Phrasen sich breitmachen, die den am ehesten ab-
stoßen, der von Führern wie Jakob Burckhardt und
Carl Justi in das gelobte Land der klassischen Kunst
geleitet wurde.
4- 4-
4-
Die Deutsche Jahrhundertausstellung von 1906
hat insofcrn der Forschung den stärksten Antrieb gegeben,
als sie bei mancher Einseitigkeit (übertriebene Vertre-
tung Hamburgs, Vernachlässigung der westdeutschen
Malerei) der historischen Gerechtigkeit in vicl höherem
Grade Rechnung getragen hat als irgendeine frühere
Veranstaltung von retrospektiver Art. Sie hat Künstler
in den Lichtkreis kunsthistorischer und ästhetischer Be-
trachtungswcise gerückt, denen nur der Aufall frühen
Todes oder provinzieller und lokaler Abfonderung die
gebührende Würdigung vorenthalten hatte. Jst es
nicht peinlich, zu bemerken, wie in älteren Kunstgeschichts-
büchern jeder in den Sielen gestorbene Akademiepro-
fessor Elogen erntet, während den tragischen Novalis-,
Hölderlin- und Georg Heym-Figuren der bildenden
Kunst, ungleich der hier viel gerechter urteilenden Litera-
turgeschichte, Anerkennung und Hervorhebung versagt
wurde? Hätte dic vielangefochtene und doch so segens-
reiche Jahrhundertausstellung nicht mehr erreicht, als