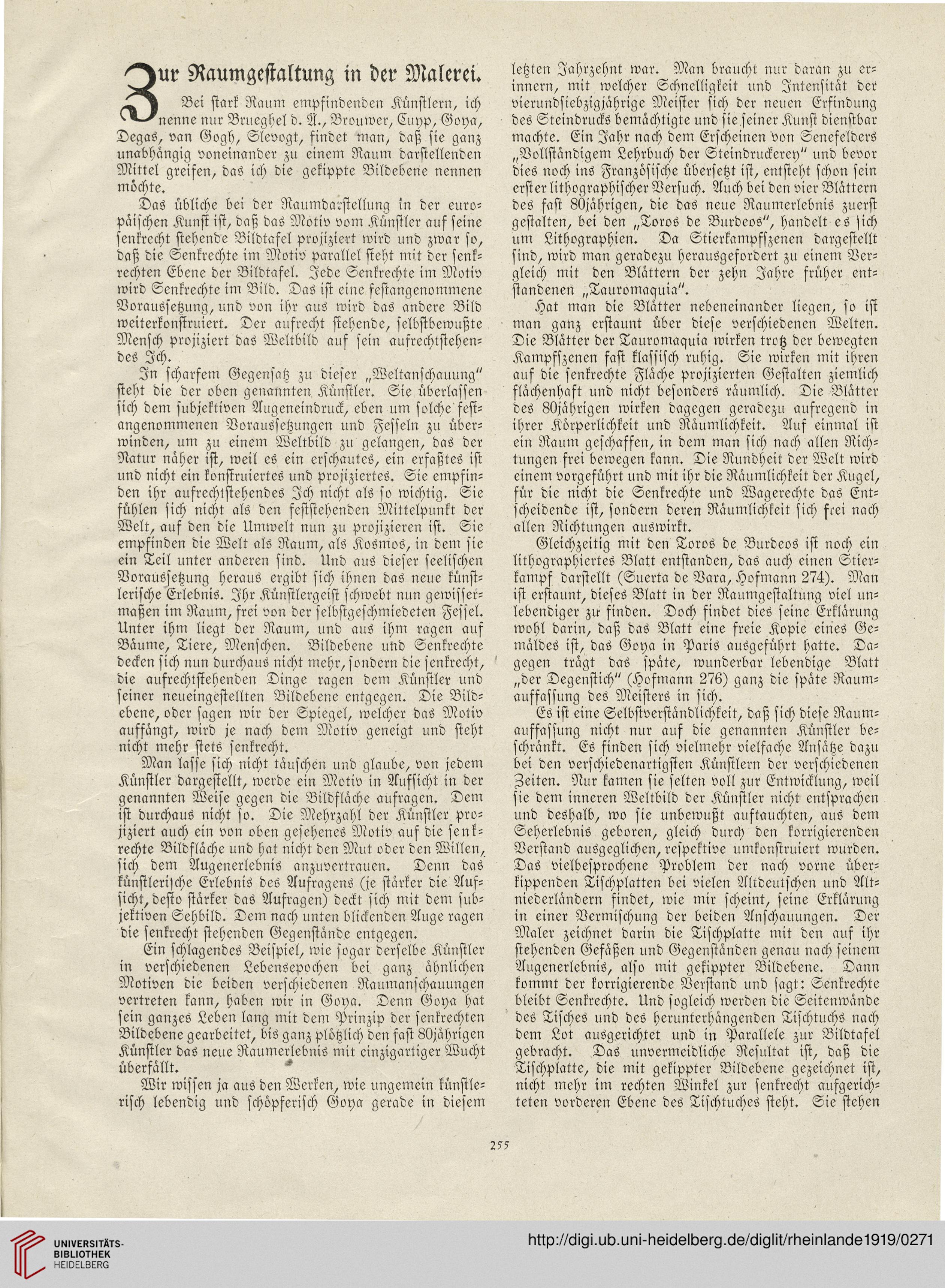ur Raumgestaltung in der Malerei»
Bei stark Raum empfindenden Künstlern, ich
nenne nur Brueghel d. Ä., Brouwer, Cuyp, Goya,
Degas, van Gogh, Slevogt, findet man, daß sie ganz
unabhängig voneinander zu einem Raum darstellenden
Mittel greifen, das ich die gekippte Bildebenc nennen
möchte.
Das übliche bei der Raumdarstellung in der euro-
paischen Kunst ist, daß das Motiv vom Künstler auf seine
senkrecht stehende Bildtafel projiziert wird und zwar so,
daß die Senkrechte im Motiv parallel stcht mit der senk-
rechten Ebene der Bildtafel. Jede Senkrechte im Motiv
wird Senkrechte im Bild. Das ist eine festangenommene
Voraussetzung, und von ihr aus wird das andere Bild
weiterkonstruiert. Der aufrecht siehende, selbstbewußte
Mensch projiziert das Weltbild auf sein aufrechtstehen-
des Jch.
Jn scharfem Gegensatz zu dieser „Weltanschauung"
steht die der oben genannten Künstler. Sie überlassen
sich dem subjektiven Augeneindruck, eben um solche sest-
angenommenen Voraussetzungen und Fesseln zu über-
winden, um zu einem Weltbild zu gelangen, das der
Natur näher ist, weil es ein erschautes, ein erfaßtes ist
und nicht ein konstruiertes und projiziertes. Sie empfin-
den ihr aufrechlstehendes Jch nicht als so wichtig. Sie
fühlen sich nicht als den feststehenden Mittelpunkt der
Welt, auf den die Umwelt nun zu projizieren ist. Sie
empfinden die Welt als Raum, als Kosmos, in dem sie
ein Teil unter anderen sind. Und aus dieser seelischen
Voraussetzung heraus ergibt sich ihnen das neue künst-
lerische Erlebnis. Jhr Künstlergeist schwebt nun gewisser-
maßen im Raum, frei von der selbstgeschmiedeten Fessel.
Unter ihm liegt der Raum, und aus ihm ragen auf
Baume, Tiere, Menschen. Bildebene und Senkrechte
decken sich nun durchaus nicht mehr, sondern die senkrecht,
die aufrechtstehenden Dinge ragen dem Künstler und
seiner neueingestellten Bildebene entgegen. Die Bild-
ebene, oder sagen wir der Spiegel, welcher das Motiv
auffängt, wird je nach dem Motiv geneigt und steht
nicht mehr stets senkrecht.
Man lasse sich nicht täuschen und glaube, von jedem
Künstler dargestellt, werde ein Motiv in Aufsicht in der
genannten Weise gegen die Bildfläche aufragen. Dem
ist durchaus nicht so. Die Mehrzahl der Künstler pro-
jiziert auch ein von oben gesehenes Motiv auf die senk-
rechte Bildfläche und hat nicht den Mut oder den Willcn,
sich dem Augenerlebnis anzuvertrauen. Denn das
künstlerilche Erlebnis des Aufragens (je stärker die Auf-
sicht, desto stärker das Aufragen) deckt sich mit dem sub-
jektiven Sehbild. Dem nach unten blickenden Auge ragen
die senkrecht stehenden Gegenstände entgegen.
Ein schlagendes Beispiel, wie sogar derselbe Künstler
in verschiedenen Lebensepochen bei ganz ähnlichen
Motiven die beiden verschiedenen Raumanschauungen
vertreten kann, haben wir in Goya. Denn Goya hat
sein ganzeü Leben lang mit dem Prinzip der senkrechten
Bildebene gearbeitet, bis ganz plötzlich den fast 80jährigen
Künstler das neue Raumerlebnis nrit cinzigartiger Wucht
überfallt.
Wir wissen ja aus den Werken, wie ungemein künstle-
risch lebendig und schöpferisch Goya gerade in diesem
letzten Jahrzehnt war. Man braucht nur daran zu er-
innern, mit welcher Schnclligkeit und Jntensität dcr
vierundsiebzigjährige Meister sich der neuen Erfindung
des Steindrucks bemächtigte und sie seiner Kunst dienstbar
machte. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Senefelders
„Vollständigem Lehrbuch der Steindruckerey" und bevor
dies noch ins Französische übersetzt ist, entsteht schon sein
ersterlithographischer Versuch. Auch bei den vier Blättern
des fast 80jährigen, die das neue Raumerlebnis zuerst
gestalten, bei den „Toros de Burdeos", handelt es sich
um Lithographien. Da Stierkampfszenen dargestellt
sind, wird man geradezu herausgefordert zu einem Ver-
gleich mit den Blättern der zehn Jahre früher ent-
stnndenen „Tauromaquia".
Hat man die Blätter nebeneinander liegen, so isi
man ganz erstaunt über diese verschiedencn Welten.
Die Blätter der Tauromaquia wirken trctz der bewegten
Kampfszenen fast klassisch ruhig. Sie wirken mit ihren
auf die senkrechte Fläche projizierten Gestalten ziemlich
flächenhaft und nicht besonders räumlich. Die Blätter
des 80jährigen wirken dagegen geradezu aufregend in
ihrer Körperlichkeit und Iiäumlichkeit. Auf einmal ist
ein Raum geschafsen, in dem man sich nach allen Rich-
tungen frei bewegen kann. Die Rundheit der Welt wird
einem vorgeführt und mit ihr die Räumlichkeit der Kugel,
sür die nicht die Senkrechte und Wagerechte das Ent-
scheidende ist, sondern deren Räumlichkeit sich fcei nach
allen Richtungen auswirkt.
Gleichzeitig mit den Toros de Burdeos ist noch ein
lithographiertes Blatt entstanden, das auch einen Sticr-
kampf darstellt (Suerta de Vara, Hofmann 274). Man
ist erstaunt, dieses Blatt in der Raumgestaltung viel un-
lebendiger zu finden. Doch findet dies seine Erklärung
wohl darin, daß das Blatt eine freie Kopie eines Ge-
mäldes ist, das Goya in Paris ausgeführt hatte. Da-
gegen trägt das späte, wunderbar lebendige Blatt
„der Degenstich" (Hofmann 276) ganz die späte Raum-
auffassung des Meisters in sich.
Eö ist eine Selbstverständlichkeit, daß sich diese Raum-
auffassung nicht nur auf die genannten Künstler be-
schränkt. Es finden sich vielmehr vielfache Ansätze dazu
bei den verschiedenartigsten Künstlern der verschiedenen
Aeiten. Nur kamen sie selten voll zur Entwicklung, weil
sie dem inneren Weltbild der Künstler nicht entsprachen
und deshalb, wo sie unbewußt auftauchten, aus dem
Seherlebnis geboren, gleich durch den korrigiercnden
Verstand ausgeglichen, respektive umkonstruiert wurden.
Das vielbesprochene Problem der nach vorne über-
kippenden Tischplatten bei vielen Altdeutschen und Alt-
nicderländern findet, wie mir scheint, seine Erklärung
in einer Vermischung der beiden Anschauungen. Der
Maler zeichnet darin die Tischplatte mit den auf ihr
stehenden Gefäßen und Gegenständen genau nach seinem
Augenerlebnis, also mit gekippter Bildebene. Dann
kommt der korrigierende Verstand und sagt: Senkrechte
bleibt Senkrechte. Und sogleich werden die Seitenwände
des Tisches und des herunterhängenden Tischtuchs nach
dem Lot ausgerichtet und in Parallele zur Bildtafel
gebracht. Das unvermeidliche Resultat ist, daß die
Tischplatte, die mit gekippter Bildebene gezeichnet ist,
nicht mehr im rechten Winkel zur senkrecht aufgerich-
teten vorderen Ebene des Tischtuches steht. Sie stehen
255
Bei stark Raum empfindenden Künstlern, ich
nenne nur Brueghel d. Ä., Brouwer, Cuyp, Goya,
Degas, van Gogh, Slevogt, findet man, daß sie ganz
unabhängig voneinander zu einem Raum darstellenden
Mittel greifen, das ich die gekippte Bildebenc nennen
möchte.
Das übliche bei der Raumdarstellung in der euro-
paischen Kunst ist, daß das Motiv vom Künstler auf seine
senkrecht stehende Bildtafel projiziert wird und zwar so,
daß die Senkrechte im Motiv parallel stcht mit der senk-
rechten Ebene der Bildtafel. Jede Senkrechte im Motiv
wird Senkrechte im Bild. Das ist eine festangenommene
Voraussetzung, und von ihr aus wird das andere Bild
weiterkonstruiert. Der aufrecht siehende, selbstbewußte
Mensch projiziert das Weltbild auf sein aufrechtstehen-
des Jch.
Jn scharfem Gegensatz zu dieser „Weltanschauung"
steht die der oben genannten Künstler. Sie überlassen
sich dem subjektiven Augeneindruck, eben um solche sest-
angenommenen Voraussetzungen und Fesseln zu über-
winden, um zu einem Weltbild zu gelangen, das der
Natur näher ist, weil es ein erschautes, ein erfaßtes ist
und nicht ein konstruiertes und projiziertes. Sie empfin-
den ihr aufrechlstehendes Jch nicht als so wichtig. Sie
fühlen sich nicht als den feststehenden Mittelpunkt der
Welt, auf den die Umwelt nun zu projizieren ist. Sie
empfinden die Welt als Raum, als Kosmos, in dem sie
ein Teil unter anderen sind. Und aus dieser seelischen
Voraussetzung heraus ergibt sich ihnen das neue künst-
lerische Erlebnis. Jhr Künstlergeist schwebt nun gewisser-
maßen im Raum, frei von der selbstgeschmiedeten Fessel.
Unter ihm liegt der Raum, und aus ihm ragen auf
Baume, Tiere, Menschen. Bildebene und Senkrechte
decken sich nun durchaus nicht mehr, sondern die senkrecht,
die aufrechtstehenden Dinge ragen dem Künstler und
seiner neueingestellten Bildebene entgegen. Die Bild-
ebene, oder sagen wir der Spiegel, welcher das Motiv
auffängt, wird je nach dem Motiv geneigt und steht
nicht mehr stets senkrecht.
Man lasse sich nicht täuschen und glaube, von jedem
Künstler dargestellt, werde ein Motiv in Aufsicht in der
genannten Weise gegen die Bildfläche aufragen. Dem
ist durchaus nicht so. Die Mehrzahl der Künstler pro-
jiziert auch ein von oben gesehenes Motiv auf die senk-
rechte Bildfläche und hat nicht den Mut oder den Willcn,
sich dem Augenerlebnis anzuvertrauen. Denn das
künstlerilche Erlebnis des Aufragens (je stärker die Auf-
sicht, desto stärker das Aufragen) deckt sich mit dem sub-
jektiven Sehbild. Dem nach unten blickenden Auge ragen
die senkrecht stehenden Gegenstände entgegen.
Ein schlagendes Beispiel, wie sogar derselbe Künstler
in verschiedenen Lebensepochen bei ganz ähnlichen
Motiven die beiden verschiedenen Raumanschauungen
vertreten kann, haben wir in Goya. Denn Goya hat
sein ganzeü Leben lang mit dem Prinzip der senkrechten
Bildebene gearbeitet, bis ganz plötzlich den fast 80jährigen
Künstler das neue Raumerlebnis nrit cinzigartiger Wucht
überfallt.
Wir wissen ja aus den Werken, wie ungemein künstle-
risch lebendig und schöpferisch Goya gerade in diesem
letzten Jahrzehnt war. Man braucht nur daran zu er-
innern, mit welcher Schnclligkeit und Jntensität dcr
vierundsiebzigjährige Meister sich der neuen Erfindung
des Steindrucks bemächtigte und sie seiner Kunst dienstbar
machte. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Senefelders
„Vollständigem Lehrbuch der Steindruckerey" und bevor
dies noch ins Französische übersetzt ist, entsteht schon sein
ersterlithographischer Versuch. Auch bei den vier Blättern
des fast 80jährigen, die das neue Raumerlebnis zuerst
gestalten, bei den „Toros de Burdeos", handelt es sich
um Lithographien. Da Stierkampfszenen dargestellt
sind, wird man geradezu herausgefordert zu einem Ver-
gleich mit den Blättern der zehn Jahre früher ent-
stnndenen „Tauromaquia".
Hat man die Blätter nebeneinander liegen, so isi
man ganz erstaunt über diese verschiedencn Welten.
Die Blätter der Tauromaquia wirken trctz der bewegten
Kampfszenen fast klassisch ruhig. Sie wirken mit ihren
auf die senkrechte Fläche projizierten Gestalten ziemlich
flächenhaft und nicht besonders räumlich. Die Blätter
des 80jährigen wirken dagegen geradezu aufregend in
ihrer Körperlichkeit und Iiäumlichkeit. Auf einmal ist
ein Raum geschafsen, in dem man sich nach allen Rich-
tungen frei bewegen kann. Die Rundheit der Welt wird
einem vorgeführt und mit ihr die Räumlichkeit der Kugel,
sür die nicht die Senkrechte und Wagerechte das Ent-
scheidende ist, sondern deren Räumlichkeit sich fcei nach
allen Richtungen auswirkt.
Gleichzeitig mit den Toros de Burdeos ist noch ein
lithographiertes Blatt entstanden, das auch einen Sticr-
kampf darstellt (Suerta de Vara, Hofmann 274). Man
ist erstaunt, dieses Blatt in der Raumgestaltung viel un-
lebendiger zu finden. Doch findet dies seine Erklärung
wohl darin, daß das Blatt eine freie Kopie eines Ge-
mäldes ist, das Goya in Paris ausgeführt hatte. Da-
gegen trägt das späte, wunderbar lebendige Blatt
„der Degenstich" (Hofmann 276) ganz die späte Raum-
auffassung des Meisters in sich.
Eö ist eine Selbstverständlichkeit, daß sich diese Raum-
auffassung nicht nur auf die genannten Künstler be-
schränkt. Es finden sich vielmehr vielfache Ansätze dazu
bei den verschiedenartigsten Künstlern der verschiedenen
Aeiten. Nur kamen sie selten voll zur Entwicklung, weil
sie dem inneren Weltbild der Künstler nicht entsprachen
und deshalb, wo sie unbewußt auftauchten, aus dem
Seherlebnis geboren, gleich durch den korrigiercnden
Verstand ausgeglichen, respektive umkonstruiert wurden.
Das vielbesprochene Problem der nach vorne über-
kippenden Tischplatten bei vielen Altdeutschen und Alt-
nicderländern findet, wie mir scheint, seine Erklärung
in einer Vermischung der beiden Anschauungen. Der
Maler zeichnet darin die Tischplatte mit den auf ihr
stehenden Gefäßen und Gegenständen genau nach seinem
Augenerlebnis, also mit gekippter Bildebene. Dann
kommt der korrigierende Verstand und sagt: Senkrechte
bleibt Senkrechte. Und sogleich werden die Seitenwände
des Tisches und des herunterhängenden Tischtuchs nach
dem Lot ausgerichtet und in Parallele zur Bildtafel
gebracht. Das unvermeidliche Resultat ist, daß die
Tischplatte, die mit gekippter Bildebene gezeichnet ist,
nicht mehr im rechten Winkel zur senkrecht aufgerich-
teten vorderen Ebene des Tischtuches steht. Sie stehen
255