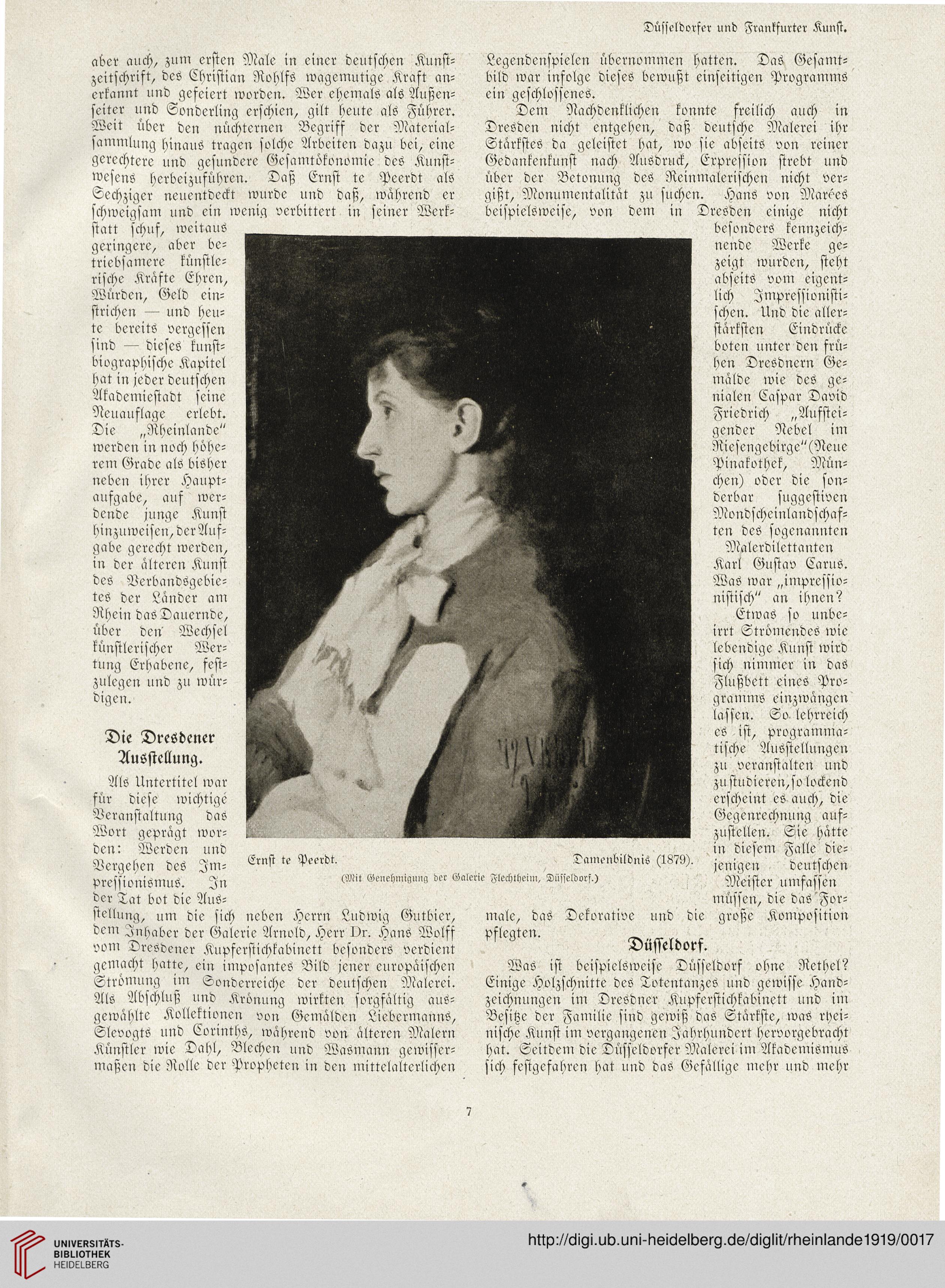Düsseldorfer und Frankfurtcr Kunst.
aber auch, zum ersten Male in eincr deutschen Kunst-
zeitschrift, des Christian Rohlfs wagemutige Kraft an-
erkannt und gefeiert worden. Wer ehemals als Außen-
seiter tind Sonderling crschien, gilt heute als Führer.
Weit über den nüchterncn Begriff der Material-
sammlung hinaris tragen solche Arbeiten dazu bei, eine
gerechtere und gesundere Gesamtökonomie des Kunst-
wesens herbeizuführen. Daß Ernst te Peerdt als
Sechziger neuentdeckt wurde und daß, wahrend er
schweigsam cind cin wenig verbittert in seiner Werk-
statt schuf, weitaus
geringere, aber be-
triebsamere künstle-
rische Krafte Ehren,
Würden, Geld ein-
strichen — und heu-
te bercits vergessen
sind — dieses kunst-
biographische Kapitel
hat in jeder deutschen
Akademiestadt seine
Neuauflage erlebt.
Die „Rheinlande"
werden in noch höhe-
rem Grade als bisher
neben ihrer Haupt-
aufgabe, auf wer-
dende junge Kunst
hinzuwcisen,derAuf-
gabe gerecht werden,
in der alteren Kunst
des Verbandsgebie-
tes der Lander am
Rhein das Dauernde,
über den Wechsel
künstlerischer Wer-
tung Erhabene, fest-
zulegen und zu wür-
digen.
Die Dresdener
Ausstellung.
Als Untertitel war
für diese wichtige
Veranstaltung das
Wort gepragt wor-
den: Werden und
Vergehen des Jm-
pressionismus. Jn
der Tat bot die Ar>s-
stellung, um die sich neben Hcrrn Ludwig Gutbier,
deni Inhaber der Galeric Arnold, Herr Dr. Hans Wolff
vom Dresdcner Kupferstichkabinett bcsonders verdient
gcmacht hatte, ein imposantes Bild jener europaischen
Strömung im Sonderrciche der deutschen Malerei.
Als Abschluß mrd Krönung wirkten sorgfältig aus-
gewählte Kollektionen von Gemälden Liebermanns,
Slevogts und Corinths, ivahrend von älteren Malern
Künstler wie Dahl, Blechen und Wasmann gewisscr-
maßen die Rolle der Propheten in den mittelalterlichen
Ernst te Peerdt.
(Mit Genehmigung der Galerie Flechtheim, Dnsseldorf.)
Legendenspielen übernommen hatten. Das Gesamt-
bild war infolge dieses bewußt einscitigen Programnis
ein geschlossenes.
Dem Nachdenklichen konnte freilich auch in
Dresden nicht cntgehen, daß deutsche Malerei ihr
Stärkstes da geleistct hat, wo sie abseits von reiner
Gedankenkunst nach Ausdruck, Erpression strebt und
über der Betonung des Reinmalerischen nicht ver-
gißt, Monumentalitat zu suchen. Hans von Marees
beispielswcise, von dem in Dresden einige nicht
besonders kennzeich-
nende Werke ge-
zeigt wurdcn, steht
abseits vom eigent-
lich Jmpressionisti-
schen. Und die aller-
stärksten Eindrücke
boten unter den frü-
hen Dresdnern Ge-
mälde wie des ge-
nialen Caspar David
Friedrich „Aufstei-
gendcr Nebel im
Riesengebirge"(Neue
Pinakothek, Mün-
chen) oder die son-
derbar suggestiven
Mondscheinlandschaf-
ten des sogenannten
Malerdilettanten
Karl Gustav Carus.
Was war „impressio-
nistisch" an ihnen?
Etwas so unbe-
irrt Strömendes wie
lebendige Kunst wird
sich ninnner in das
Flußbett eincs Pro-
gramms einzwängcn
lassen. So lehrrcich
es ist, programma-
tische Ausstellungen
zu veranstalten und
zustudieren,so lockend
erscheint es auch, die
Gegenrechnung auf-
zustellen. Sie hätte
in diescnl Falle die-
jenigen deutschen
Meister umfassen
müssen, die das For-
male, das Dekorative und die große Komposition
""°"°°" D«Md°U.
Waü ist beispielswcise Düsseldorf ohne Rethel?
Einige Holzschnitte des Totentanzes und gewissc Hand-
zcichnungen im Dresdner Kupferstichkabinett und im
Besitze der Familie sind gewiß das Stärkste, was rhei-
nische Kunst im vergangencn Jahrhundcrt hervorgebracht
hat. Seitdem die Düsscldorfer Malerei im Akademismus
sich festgcfahren hat und das Gefällige mehr und mehr
daim'nbildnis (1879).
aber auch, zum ersten Male in eincr deutschen Kunst-
zeitschrift, des Christian Rohlfs wagemutige Kraft an-
erkannt und gefeiert worden. Wer ehemals als Außen-
seiter tind Sonderling crschien, gilt heute als Führer.
Weit über den nüchterncn Begriff der Material-
sammlung hinaris tragen solche Arbeiten dazu bei, eine
gerechtere und gesundere Gesamtökonomie des Kunst-
wesens herbeizuführen. Daß Ernst te Peerdt als
Sechziger neuentdeckt wurde und daß, wahrend er
schweigsam cind cin wenig verbittert in seiner Werk-
statt schuf, weitaus
geringere, aber be-
triebsamere künstle-
rische Krafte Ehren,
Würden, Geld ein-
strichen — und heu-
te bercits vergessen
sind — dieses kunst-
biographische Kapitel
hat in jeder deutschen
Akademiestadt seine
Neuauflage erlebt.
Die „Rheinlande"
werden in noch höhe-
rem Grade als bisher
neben ihrer Haupt-
aufgabe, auf wer-
dende junge Kunst
hinzuwcisen,derAuf-
gabe gerecht werden,
in der alteren Kunst
des Verbandsgebie-
tes der Lander am
Rhein das Dauernde,
über den Wechsel
künstlerischer Wer-
tung Erhabene, fest-
zulegen und zu wür-
digen.
Die Dresdener
Ausstellung.
Als Untertitel war
für diese wichtige
Veranstaltung das
Wort gepragt wor-
den: Werden und
Vergehen des Jm-
pressionismus. Jn
der Tat bot die Ar>s-
stellung, um die sich neben Hcrrn Ludwig Gutbier,
deni Inhaber der Galeric Arnold, Herr Dr. Hans Wolff
vom Dresdcner Kupferstichkabinett bcsonders verdient
gcmacht hatte, ein imposantes Bild jener europaischen
Strömung im Sonderrciche der deutschen Malerei.
Als Abschluß mrd Krönung wirkten sorgfältig aus-
gewählte Kollektionen von Gemälden Liebermanns,
Slevogts und Corinths, ivahrend von älteren Malern
Künstler wie Dahl, Blechen und Wasmann gewisscr-
maßen die Rolle der Propheten in den mittelalterlichen
Ernst te Peerdt.
(Mit Genehmigung der Galerie Flechtheim, Dnsseldorf.)
Legendenspielen übernommen hatten. Das Gesamt-
bild war infolge dieses bewußt einscitigen Programnis
ein geschlossenes.
Dem Nachdenklichen konnte freilich auch in
Dresden nicht cntgehen, daß deutsche Malerei ihr
Stärkstes da geleistct hat, wo sie abseits von reiner
Gedankenkunst nach Ausdruck, Erpression strebt und
über der Betonung des Reinmalerischen nicht ver-
gißt, Monumentalitat zu suchen. Hans von Marees
beispielswcise, von dem in Dresden einige nicht
besonders kennzeich-
nende Werke ge-
zeigt wurdcn, steht
abseits vom eigent-
lich Jmpressionisti-
schen. Und die aller-
stärksten Eindrücke
boten unter den frü-
hen Dresdnern Ge-
mälde wie des ge-
nialen Caspar David
Friedrich „Aufstei-
gendcr Nebel im
Riesengebirge"(Neue
Pinakothek, Mün-
chen) oder die son-
derbar suggestiven
Mondscheinlandschaf-
ten des sogenannten
Malerdilettanten
Karl Gustav Carus.
Was war „impressio-
nistisch" an ihnen?
Etwas so unbe-
irrt Strömendes wie
lebendige Kunst wird
sich ninnner in das
Flußbett eincs Pro-
gramms einzwängcn
lassen. So lehrrcich
es ist, programma-
tische Ausstellungen
zu veranstalten und
zustudieren,so lockend
erscheint es auch, die
Gegenrechnung auf-
zustellen. Sie hätte
in diescnl Falle die-
jenigen deutschen
Meister umfassen
müssen, die das For-
male, das Dekorative und die große Komposition
""°"°°" D«Md°U.
Waü ist beispielswcise Düsseldorf ohne Rethel?
Einige Holzschnitte des Totentanzes und gewissc Hand-
zcichnungen im Dresdner Kupferstichkabinett und im
Besitze der Familie sind gewiß das Stärkste, was rhei-
nische Kunst im vergangencn Jahrhundcrt hervorgebracht
hat. Seitdem die Düsscldorfer Malerei im Akademismus
sich festgcfahren hat und das Gefällige mehr und mehr
daim'nbildnis (1879).