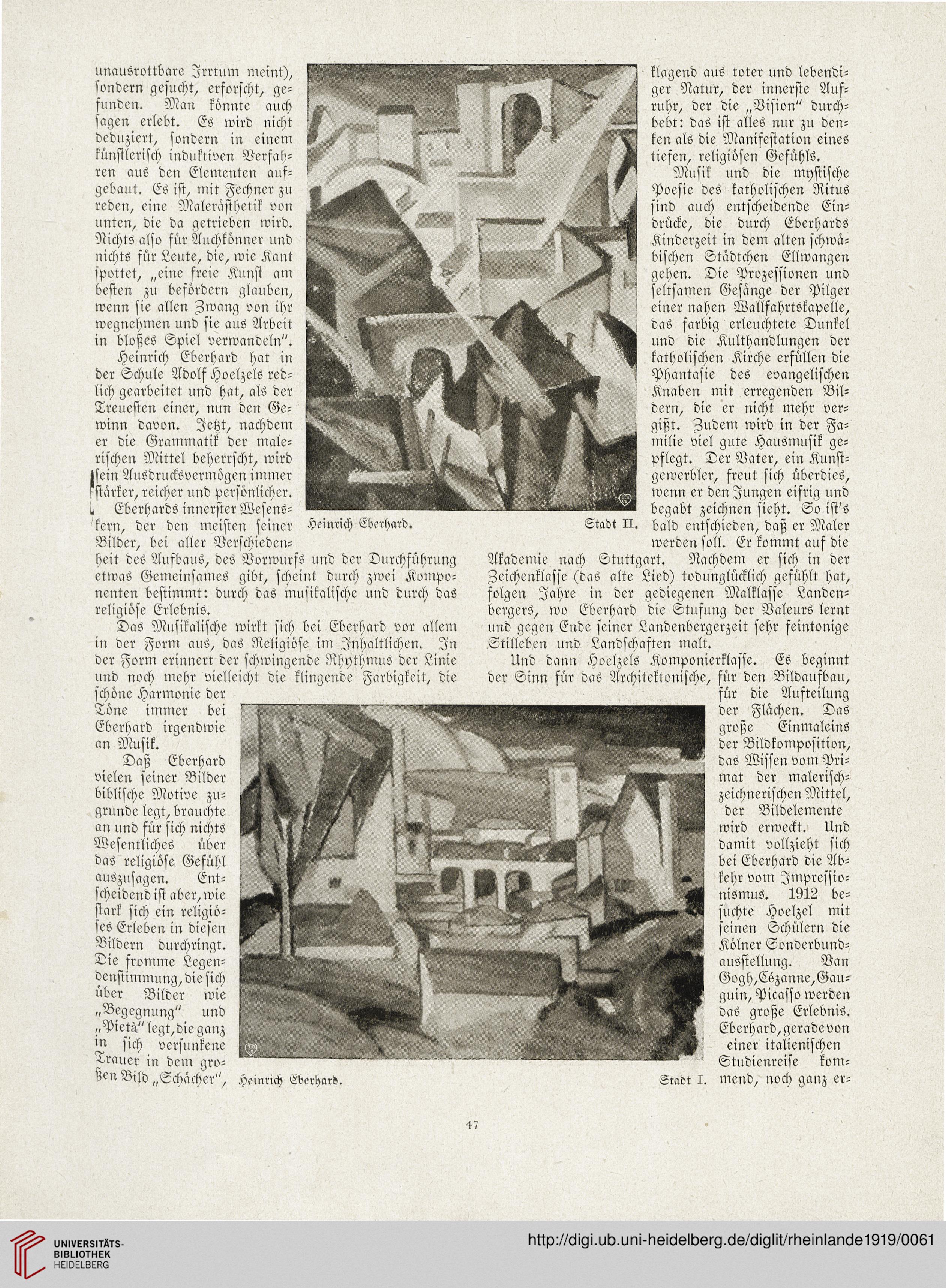unausrottbare Jrrtum meint),
sondern gesucht, ersorscht, ge-
funden. Man könnte auch
sagen erlebt. Es wird nicht
deduziert, sondern in einem
künstlerisch induktiven Versah-
ren aus den Elemcnten auf-
gebaut. Es ist, mit Fechner zu
reden, eine Malerasthetik von
unten, die da getrieben wird.
Nichts also für Auchkönner und
nichts für Leute, die, wie Kant
spottet, „eine freie Kunst am
besten zu befördern glauben,
wenn sie allen Awang von ihr
wegnehmen und sie aus Arbeit
in bloßes Spiel verwandeln".
Heinrich Eberhard hat in
der Schule Adolf Hoelzels red-
lich gearbeitet und hat, als der
Treuesten einer, nun den Ge-
winn davon. Jetzt, nachdem
er die Grammatik der male-
rischen Mittel beherrscht, wird
tsein Ausdrcicksvermögen immcr
'stärker, reicher und persönlicher.
^ Ebcrhards innerstcr Wesens-
kern, der den meisten seincr Heimich Cberhard.
Bilder, bei aller Berschieden-
heit des Aufbaus, des Borwurfs und der Durchführung
etwas Gemeinsames gibt, scheint durch zwci Kompo-
nenten bestimnct: durch das musikalische rnrd durch das
religiöse Erlebnis.
Das Musikalische wirkt sich bei Eberhard vor allem
in der Form aus, das Religiöse im Jnhaltlichen. Jn
der Form erinnert der schwingende Rhythmus der Linie
und noch mehr vielleicht die klingende Farbigkeit, die
schöne Harmonic der
Töne immer bci
Eberhard irgendwie
an Musik.
Daß Eberhard
vielen seiner Bilder
biblische Motive zu-
grunde legt, brauchte
an und für sich nichts
Wesentliches über
das religiöse Gefühl
auszusagen. Ent-
scheidendist aber,wie
stark sich ein religiö-
ses Erlebcn in diesen
Bildern durchringt.
Die fromme Legen-
denstimmung,diesich
über Bilder wie
„Begegnung" und
„Piets," legt,dieganz
ur sich versunkene
).rauer in dem gro-
ßen Bild „Schacher", Heinrich Cberharb.
klagend aus toter und lebendi-
ger Natur, der innerste Auf-
ruhr, der die „Vision" durch-
bebt: das ist alles nur zu den-
ken als die Manifestation eines
tiefen, religiösen Gefühls.
Musik und die mystische
Poesie des katholischen Ritus
sind auch entscheidende Ein-
drücke, die durch Eberhards
Kinderzeit in dem alten schwa-
bischen Städtchen Ellwangen
gehen. Die Prozessionen und
seltsamen Gesänge der Pilger
einer nahen Wallfahrtskapelle,
das farbig erleuchtete Dunkel
und die Kulthandlungen der
katholischen Kirche erfüllen die
Phantasie des evangelischen
Knaben mit erregenden Bil-
dern, die er nicht mehr ver-
gißt. Audem wird in der Fa-
milie vicl gute Hausmusik ge-
pflegt. Der Vater, ein Kunst-
gewerbler, freut sich überdies,
wenn er den Jungen eifrig und
begabt zeichnen sicht. So ist'S
Stadt II. bald entschieden, daß er Malcr
werden soll. Er kommt auf die
Akademie nach Stuttgart. Nachdem er sich in der
Aeichenklasse (das alte Lied) todunglücklich gefühlt hat,
folgen Jahre in der gediegencn Malklasse Landen-
bergers, wo Eberhard die Stufung der Valecirs lernt
und gegen Endc sciner Landenbergerzeit sehr feintonige
Stilleben und Landschaften malt.
Und dann Hoelzels Komponierklasse. Es beginnt
der Sinn für das Architektonische, für den Bildaufbau,
für die Aufteilung
der Flächen. Das
große Einmaleins
der Bildkomposition,
das Wissen vom Pri-
mat der malerisch-
zeichnerischen Mittel,
der Bildelemente
wird erweckt. Und
damit vollzieht sich
bei Eberhard die Ab-
kehr vom Jmpressio-
nismus. 1912 be-
suchte Hoelzel mit
feinen Schülern die
Kölner Sonderbund-
ausstellung. Van
Gogh,Cszanne,Gau-
guin, Picasso werden
das große Erlebnis.
Eberhard, gerade von
einer italienischen
Studienreise kom-
Stadt i. mend, noch ganz er-
47
sondern gesucht, ersorscht, ge-
funden. Man könnte auch
sagen erlebt. Es wird nicht
deduziert, sondern in einem
künstlerisch induktiven Versah-
ren aus den Elemcnten auf-
gebaut. Es ist, mit Fechner zu
reden, eine Malerasthetik von
unten, die da getrieben wird.
Nichts also für Auchkönner und
nichts für Leute, die, wie Kant
spottet, „eine freie Kunst am
besten zu befördern glauben,
wenn sie allen Awang von ihr
wegnehmen und sie aus Arbeit
in bloßes Spiel verwandeln".
Heinrich Eberhard hat in
der Schule Adolf Hoelzels red-
lich gearbeitet und hat, als der
Treuesten einer, nun den Ge-
winn davon. Jetzt, nachdem
er die Grammatik der male-
rischen Mittel beherrscht, wird
tsein Ausdrcicksvermögen immcr
'stärker, reicher und persönlicher.
^ Ebcrhards innerstcr Wesens-
kern, der den meisten seincr Heimich Cberhard.
Bilder, bei aller Berschieden-
heit des Aufbaus, des Borwurfs und der Durchführung
etwas Gemeinsames gibt, scheint durch zwci Kompo-
nenten bestimnct: durch das musikalische rnrd durch das
religiöse Erlebnis.
Das Musikalische wirkt sich bei Eberhard vor allem
in der Form aus, das Religiöse im Jnhaltlichen. Jn
der Form erinnert der schwingende Rhythmus der Linie
und noch mehr vielleicht die klingende Farbigkeit, die
schöne Harmonic der
Töne immer bci
Eberhard irgendwie
an Musik.
Daß Eberhard
vielen seiner Bilder
biblische Motive zu-
grunde legt, brauchte
an und für sich nichts
Wesentliches über
das religiöse Gefühl
auszusagen. Ent-
scheidendist aber,wie
stark sich ein religiö-
ses Erlebcn in diesen
Bildern durchringt.
Die fromme Legen-
denstimmung,diesich
über Bilder wie
„Begegnung" und
„Piets," legt,dieganz
ur sich versunkene
).rauer in dem gro-
ßen Bild „Schacher", Heinrich Cberharb.
klagend aus toter und lebendi-
ger Natur, der innerste Auf-
ruhr, der die „Vision" durch-
bebt: das ist alles nur zu den-
ken als die Manifestation eines
tiefen, religiösen Gefühls.
Musik und die mystische
Poesie des katholischen Ritus
sind auch entscheidende Ein-
drücke, die durch Eberhards
Kinderzeit in dem alten schwa-
bischen Städtchen Ellwangen
gehen. Die Prozessionen und
seltsamen Gesänge der Pilger
einer nahen Wallfahrtskapelle,
das farbig erleuchtete Dunkel
und die Kulthandlungen der
katholischen Kirche erfüllen die
Phantasie des evangelischen
Knaben mit erregenden Bil-
dern, die er nicht mehr ver-
gißt. Audem wird in der Fa-
milie vicl gute Hausmusik ge-
pflegt. Der Vater, ein Kunst-
gewerbler, freut sich überdies,
wenn er den Jungen eifrig und
begabt zeichnen sicht. So ist'S
Stadt II. bald entschieden, daß er Malcr
werden soll. Er kommt auf die
Akademie nach Stuttgart. Nachdem er sich in der
Aeichenklasse (das alte Lied) todunglücklich gefühlt hat,
folgen Jahre in der gediegencn Malklasse Landen-
bergers, wo Eberhard die Stufung der Valecirs lernt
und gegen Endc sciner Landenbergerzeit sehr feintonige
Stilleben und Landschaften malt.
Und dann Hoelzels Komponierklasse. Es beginnt
der Sinn für das Architektonische, für den Bildaufbau,
für die Aufteilung
der Flächen. Das
große Einmaleins
der Bildkomposition,
das Wissen vom Pri-
mat der malerisch-
zeichnerischen Mittel,
der Bildelemente
wird erweckt. Und
damit vollzieht sich
bei Eberhard die Ab-
kehr vom Jmpressio-
nismus. 1912 be-
suchte Hoelzel mit
feinen Schülern die
Kölner Sonderbund-
ausstellung. Van
Gogh,Cszanne,Gau-
guin, Picasso werden
das große Erlebnis.
Eberhard, gerade von
einer italienischen
Studienreise kom-
Stadt i. mend, noch ganz er-
47