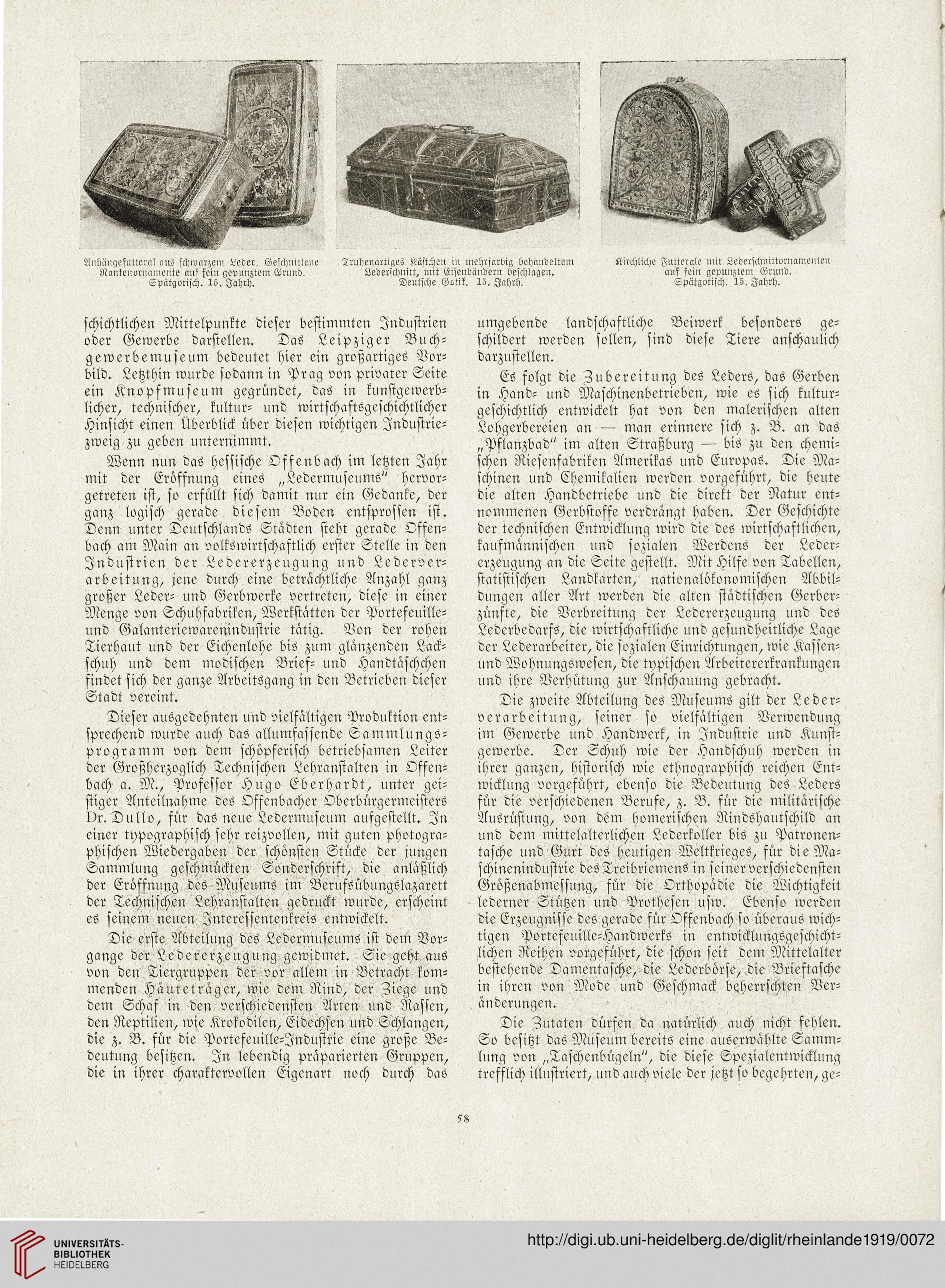§
Anhäiigefutteral aus schwarzem Leder. Geschmtteue Truhenartiges Kästchen in inehrfarbig behandeltem Kirchliche Futterale mit Lederschnittornamenten
Nankenornamente auf fein gepunztem Grund. Lederschnitt, mit Eisenbändern beschlagen. auf fein gepunztem Grund.
Spätgotisch. 15. Jahrh. Deutsche Gotik. 15. Jahrh. Spätgotisch. 15. Jahrh.
schichtlichen Mittelpunkte dieser bestimmten Jndustrien
oder Gewerbe darstellen. Das Leipziger Brich-
gewerbemuseum bedeutet hier ein großartiges Vor-
bild. Letzthin wurde sodann in Prag von privater Seite
ein Knopfmuseum gegründet, das in kunstgewerb-
licher, technischer, kultur- und wirtschastsgeschichtlicher
Hinsicht einen Uberblick über diesen wichtigen Jndustrie-
zweig zu geben unternimmt.
Wenn nun das hessische Osfenbach im letzten Jahr
mit der Eröfsnung eines „Ledermuseums" hervor-
getreten ist, so erfüllt sich damit nur ein Gedanke, der
ganz logisch gerade diesem Boden entsprossen ist.
Denn unter Deutschlands Stadten steht gerade Offen-
bach am Main an volkswirtschaftlich erster Stelle in den
Jndustrien der Ledcrerzeugung und Lederver-
arbeitung, jene durch eine betrachtliche Anzahl ganz
großer Leder- und Gerbwerke vertreten, diese in einer
Menge von Schuhfabrikcn, Werkstatten der Portefeuille-
und Galanteriewarenindustrie tatig. Von der rohen
Tierhaut und der Eichenlohe bis zum glanzenden Lack-
schuh und dem modischen Brief- und Handtaschchen
sindet sich der ganze Arbeitsgang in den Betrieben dieser
Stadt vereint.
Dieser ausgedehnten und vielfältigen Produktion ent-
sprechend wurde auch das allumfassende Sammlungs-
programm von dcm schöpferisch betriebsanien Leiter
der Großherzoglich Technischen Lehranstalten in Offen-
bach a. M., Professor Hugo Eberhardt, unter gei-
stiger Anteilnahme des Ofscnbachcr Oberbürgermeisters
Dr. Dullo, für das ncue Ledermuseum aufgestellt. Jn
einer typographisch sehr reizvollen, mit guten photogra-
phischen Wiedergaben der schönsten Stücke dcr jungen
Sammlung geschmückten Sonderschrift, die anläßlich
der Eröffnung des Museums im Berufsübungslazarett
der Technischcn Lehranstalten gedruckt wurde, erscheint
es seincm neucn Jnteressentenkreis entwickelt.
Die erste Abteilung des Ledermuseums ist dem Vor-
gange der Ledcrerzcugung gewidmet. Sie geht aus
von den Tiergruppen der vor allem in Betracht kom-
menden Häuteträger, wie dem Rind, der Aiege und
dem Schas in den verschiedensten Arten und Rassen,
den Reptilien, wie Krokodilen, Eidechsen und Schlangen,
die z. B. für die Portefeuille-Jndustrie eine große Be-
deutung besitzen. Jn lebendig präparierten Gruppen,
die in ihrer charaktcrvollen Eigenart noch durch das
umgebende landschaftliche Beiwerk besonders ge-
schildert werden sollen, sind diese Tiere anschaulich
darzustellen.
Es folgt die -Zubereitung des Leders, das Gerben
in Hand- und Maschinenbetrieben, wie es sich kultur-
geschichtlich entwickelt hat von den malerischen alten
Lohgerbereien an — man erinnere sich z. B. an das
„Pflanzbad" im alten Straßburg — bis zu den chemi-
schen Riesenfabriken Amerikas und Europas. Die Ma-
schinen und Chemikalien werdcn vorgeführt, die heute
die alten Handbetriebe und die direkt der Natur ent-
nonnnenen Gerbstoffe verdrangt haben. Der Geschichte
der technischen Entwicklung wird die des wirtschaftlichen,
kaufmännischen und sozialen Werdens der Leder-
erzeugung an die Seite gestellt. Mit Hilfe von Tabellen,
statistischen Landkarten, nationalökonomischen Abbil-
dungen aller Art werden die alten städtischen Gerber-
zünfte, die Verbreitung der Ledererzeugung und des
Lederbedarfs, die wirtschaftliche und gesundheitliche Lagc
der Lederarbeitcr, die sozialen Einrichtungen, wie Kassen-
und Wohnungswesen, die typischen Arbeitererkrankungen
und ihre Verhütung zur Anschauung gebracht.
Die zweite Abteilung des Museums gilt der Leder-
verarbeitung, seiner so vielfältigen Verwendung
im Gewerbe und Handwerk, in Jndustrie und Kunst-
gewerbe. Der Schuh wie der Handschuh werden in
ihrer ganzen, historisch wie ethnographisch reichen Ent-
wicklung vorgeführt, ebenso die Bedeutung des Leders
für die verschiedenen Berufe, z. B. für die militärische
Ausrüstung, von dem homerischen Rindshautschild an
und dem mittelalterlichen Lederkoller bis zu Patronen-
tasche und Gurt des heutigen Weltkrieges, für die Ma-
schinenindustrie desTreibriemens in seiner verschiedensten
Größenabmessung, für die Orthopädie die Wichtigkeit
lederner Stützen und Prothesen usw. Ebenso werden
die Erzeugnisse des gerade für Offenbach so überaus wich-
tigen Portefeuille-Handwerks in entwicklungsgeschicht-
lichen Reihen vorgeführt, dic schon seit dem Mittelalter
bestehende Damentasche, die Lederbörse, die Brieftasche
in ihren von Mode und Geschmack beherrschten Ver-
änderungen.
Die Autaten dürfen da natürlich auch nicht fehlen.
So besitzt das Museum bereits cine auserwählte Samm-
lung von „Taschenbügeln", die diese Spezialentwicklung
trefslich illustriert, und auch viele dcr jetzt so begehrten, ge-
58
Anhäiigefutteral aus schwarzem Leder. Geschmtteue Truhenartiges Kästchen in inehrfarbig behandeltem Kirchliche Futterale mit Lederschnittornamenten
Nankenornamente auf fein gepunztem Grund. Lederschnitt, mit Eisenbändern beschlagen. auf fein gepunztem Grund.
Spätgotisch. 15. Jahrh. Deutsche Gotik. 15. Jahrh. Spätgotisch. 15. Jahrh.
schichtlichen Mittelpunkte dieser bestimmten Jndustrien
oder Gewerbe darstellen. Das Leipziger Brich-
gewerbemuseum bedeutet hier ein großartiges Vor-
bild. Letzthin wurde sodann in Prag von privater Seite
ein Knopfmuseum gegründet, das in kunstgewerb-
licher, technischer, kultur- und wirtschastsgeschichtlicher
Hinsicht einen Uberblick über diesen wichtigen Jndustrie-
zweig zu geben unternimmt.
Wenn nun das hessische Osfenbach im letzten Jahr
mit der Eröfsnung eines „Ledermuseums" hervor-
getreten ist, so erfüllt sich damit nur ein Gedanke, der
ganz logisch gerade diesem Boden entsprossen ist.
Denn unter Deutschlands Stadten steht gerade Offen-
bach am Main an volkswirtschaftlich erster Stelle in den
Jndustrien der Ledcrerzeugung und Lederver-
arbeitung, jene durch eine betrachtliche Anzahl ganz
großer Leder- und Gerbwerke vertreten, diese in einer
Menge von Schuhfabrikcn, Werkstatten der Portefeuille-
und Galanteriewarenindustrie tatig. Von der rohen
Tierhaut und der Eichenlohe bis zum glanzenden Lack-
schuh und dem modischen Brief- und Handtaschchen
sindet sich der ganze Arbeitsgang in den Betrieben dieser
Stadt vereint.
Dieser ausgedehnten und vielfältigen Produktion ent-
sprechend wurde auch das allumfassende Sammlungs-
programm von dcm schöpferisch betriebsanien Leiter
der Großherzoglich Technischen Lehranstalten in Offen-
bach a. M., Professor Hugo Eberhardt, unter gei-
stiger Anteilnahme des Ofscnbachcr Oberbürgermeisters
Dr. Dullo, für das ncue Ledermuseum aufgestellt. Jn
einer typographisch sehr reizvollen, mit guten photogra-
phischen Wiedergaben der schönsten Stücke dcr jungen
Sammlung geschmückten Sonderschrift, die anläßlich
der Eröffnung des Museums im Berufsübungslazarett
der Technischcn Lehranstalten gedruckt wurde, erscheint
es seincm neucn Jnteressentenkreis entwickelt.
Die erste Abteilung des Ledermuseums ist dem Vor-
gange der Ledcrerzcugung gewidmet. Sie geht aus
von den Tiergruppen der vor allem in Betracht kom-
menden Häuteträger, wie dem Rind, der Aiege und
dem Schas in den verschiedensten Arten und Rassen,
den Reptilien, wie Krokodilen, Eidechsen und Schlangen,
die z. B. für die Portefeuille-Jndustrie eine große Be-
deutung besitzen. Jn lebendig präparierten Gruppen,
die in ihrer charaktcrvollen Eigenart noch durch das
umgebende landschaftliche Beiwerk besonders ge-
schildert werden sollen, sind diese Tiere anschaulich
darzustellen.
Es folgt die -Zubereitung des Leders, das Gerben
in Hand- und Maschinenbetrieben, wie es sich kultur-
geschichtlich entwickelt hat von den malerischen alten
Lohgerbereien an — man erinnere sich z. B. an das
„Pflanzbad" im alten Straßburg — bis zu den chemi-
schen Riesenfabriken Amerikas und Europas. Die Ma-
schinen und Chemikalien werdcn vorgeführt, die heute
die alten Handbetriebe und die direkt der Natur ent-
nonnnenen Gerbstoffe verdrangt haben. Der Geschichte
der technischen Entwicklung wird die des wirtschaftlichen,
kaufmännischen und sozialen Werdens der Leder-
erzeugung an die Seite gestellt. Mit Hilfe von Tabellen,
statistischen Landkarten, nationalökonomischen Abbil-
dungen aller Art werden die alten städtischen Gerber-
zünfte, die Verbreitung der Ledererzeugung und des
Lederbedarfs, die wirtschaftliche und gesundheitliche Lagc
der Lederarbeitcr, die sozialen Einrichtungen, wie Kassen-
und Wohnungswesen, die typischen Arbeitererkrankungen
und ihre Verhütung zur Anschauung gebracht.
Die zweite Abteilung des Museums gilt der Leder-
verarbeitung, seiner so vielfältigen Verwendung
im Gewerbe und Handwerk, in Jndustrie und Kunst-
gewerbe. Der Schuh wie der Handschuh werden in
ihrer ganzen, historisch wie ethnographisch reichen Ent-
wicklung vorgeführt, ebenso die Bedeutung des Leders
für die verschiedenen Berufe, z. B. für die militärische
Ausrüstung, von dem homerischen Rindshautschild an
und dem mittelalterlichen Lederkoller bis zu Patronen-
tasche und Gurt des heutigen Weltkrieges, für die Ma-
schinenindustrie desTreibriemens in seiner verschiedensten
Größenabmessung, für die Orthopädie die Wichtigkeit
lederner Stützen und Prothesen usw. Ebenso werden
die Erzeugnisse des gerade für Offenbach so überaus wich-
tigen Portefeuille-Handwerks in entwicklungsgeschicht-
lichen Reihen vorgeführt, dic schon seit dem Mittelalter
bestehende Damentasche, die Lederbörse, die Brieftasche
in ihren von Mode und Geschmack beherrschten Ver-
änderungen.
Die Autaten dürfen da natürlich auch nicht fehlen.
So besitzt das Museum bereits cine auserwählte Samm-
lung von „Taschenbügeln", die diese Spezialentwicklung
trefslich illustriert, und auch viele dcr jetzt so begehrten, ge-
58