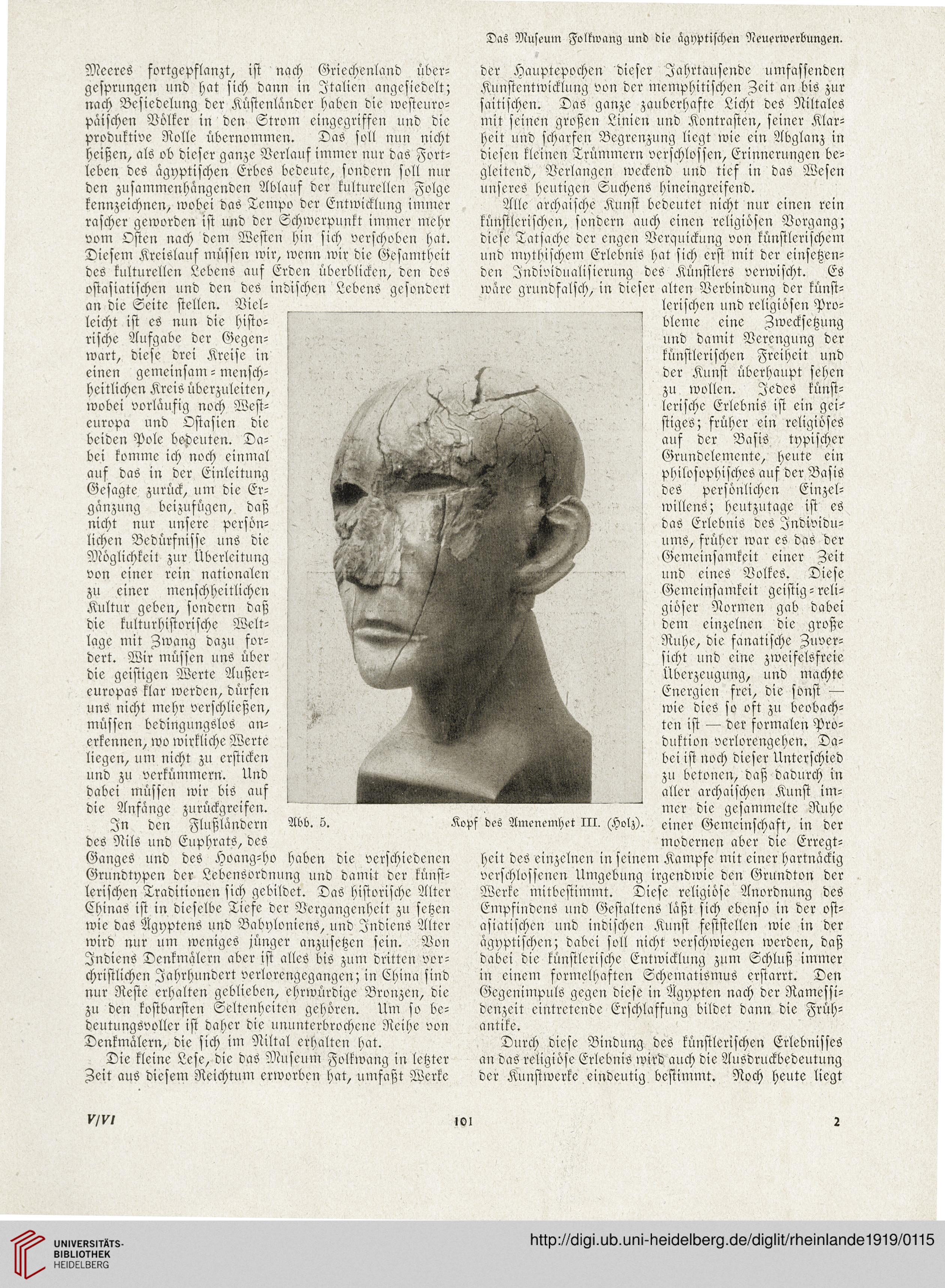Das Museum Folkwang und die ägyptischen Neuerwerbungen.
Meeres fortgepslanzt, ist nach Griechenland über-
gesprungen und hat sich dann in Jtalicn angesiedelt;
nach Besiedelung der Küstenländer haben dic westeuro-
paischen Bölker in dcn Stronr eingegriffen und die
produktive Rolle übernommen. Das soll nun nicht
heißen, als ob dieser ganze Verlauf immer nur das Fort-
leben des ägyptischen Erbcs bedeute, sondern soll nur
den zusammenhangenden Ablauf der kulturellen Folge
kennzeichnen, wobei das Tcmpo der Entwicklung immer
rascher geworden ist und der Schwerpunkt immer mehr
vom Osten nach dem Westen hin sich verschoben hat.
Diesem Kreislauf müssen wir, wenn wir die Gesamtheit
des kulturellen Lebens auf Erden überblicken, dcn dcs
ostasiatischen und den des indischen Lebens gcsondert
an die Seite stellen. Viel-
leicht ist es nun die histo-
rische Aufgabe der Gegen-
wart, diese drei Kreise in
einen gemeinsam - mcnsch-
hcitlichen Kreis überzuleiten,
wobei vorläufig noch West-
europa und Ostasien die
beiden Pole be-deuten. Da-
bei komme ich noch einmal
auf das in der Einleitung
Gesagte zurück, um die Er-
gänzung beizufügen, daß
nicht nur unsere persön-
lichen Bedürfnisse uns die
Möglichkcit zur Überleitung
von einer rein nationalcn
zu einer menschheitlichen
Kultur geben, sondern daß
die kulturhistorische Welt-
lage mit Awang dazu for-
dert. Wir müssen uns über
die geistigen Werte Außer-
europas klar werden, dürfcn
uns nicht mehr verschließen,
müssen bedingungslos an-
erkennen, wo wirkliche Werte
liegen, um nicht zu ersticken
und zu verkünmrern. Und
dabei müssen wir bis auf
die Anfänge zurückgreifen.
Jn den Flußländern
des Nils und Euphrats, des
Ganges und des Hoang-Ho haben die verschiedenen
Grundtypen der Lebensordnung und damit der künst-
lerischen Traditionen sich gebildet. Das historische Alter
Chinas ist in dieselbe Tiefe der Vergangenheit zu setzen
wic das Agyptens und Babyloniens, und Jndiens Alter
wird nur um weniges jünger anzusetzen sein. Von
Jndiens Denkmälern aber ist alles bis zum dritten vor-
christlichen Jahrhundert verlorengegangen; in China sind
nur Reste erhalten geblieben, ehrwürdige Bronzen, die
zu den kostbarsten Seltenheiten gehören. Um so be-
deutungsvoller ist daher die ununterbrochene Neihe von
Denkmälern, die sich im Niltal erhalten hat.
Die kleine Lese, die das Muscum Folkwang in letzter
Aeit aus diesem Reichtum erworben hat, umfaßt Werke
p'/p'/ IVI
der Hauptcpochen dieser Jahrtausende umfasscnden
Kunstentwicklung von der memphitischen Aeit an bis zur
saitischen. Das ganze zauberhafte Licht des Niltales
mit seinen großen Linien und Kontrasten, seiner Klar-
heit und scharfen Begrenzung licgt wie ein Abglanz in
diescn kleinen Trümmern verschlossen, Erinnerungen be-
glcitend, Verlangen weckend und tief in das Wesen
unseres heutigen Suchens hineingreifend.
Alle archaische Kunst bedeutet nicht nur einen rein
künstlerischen, sondern auch cinen religiösen Vorgang;
diese Tatsache der engen Verguickung von künstlerischem
und mythischem Erlebnis hat sich erst mit der einsetzen-
den Jndividualisierung des Künstlers verwischt. Es
wäre grundfalsch, in dieser alten Verbindung der künst-
lerischen und religiösen Pro-
bleme cine Awecksetzung
und damit Verengung der
künstlerischen Freiheit und
der Kunst überhaupt sehen
zu wollen. Jedes künst-
lerische Erlebnis ist ein gei--
stiges; früher ein religiöses
auf der Basis typischcr
Grundelemente, heute ein
philosophisches auf der Basis
des persönlichen Einzel-
willens; hcutzutage ist eö
das Erlebnis des Jndividu-
ums, früher war es das der
Gemeinsamkeit einer Aeit
und eines Volkes. Diese
Gememsamkeit geistig-reli-
giöser Normen gab dabei
dem einzelnen die große
Ruhe, die fanatische Auver-
sicht und eine zweifelsfreie
Uberzeugung, und niachte
Energien frei, die sonst —
wie dies so oft zu beobach-
ten ist — der formalen Pro-
duktion verlorengehen. Da-
bei ist noch dieser Unterschied
zu betonen, daß dadurch in
allcr archaischen Kunst im-
mer die gesammelte Ruhe
einer Gemeinschast, in der
moderncn aber die Erregt-
heit des einzelnen in seinem Kampfe mit eincr hartnäckig
verschlossenen Umgebung irgendwie den Grundton der
Werke mitbcstimmt. Diese religiöse Anordnung des
Empfindens und Gestaltens läßt sich ebenso in der ost-
asiatischen und indischen Kunst feststellen wie in der
ägyptischen; dabei soÜ nicht verschwicgen werden, daß
dabei die künstlcrische Entwicklung zuni Schluß immer
in einem formelhasten Schematismus erstarrt. Den
Gegenimpuls gegen diese in Agypten nach der Ramessi-
denzeit eintretende Erschlaffung bildet dann die Früh-
antike.
Durch diese Bindung des künstlerischen Erlebnisses
an das religiöse Erlebnis wird auch die Ausdruckbedeutung
der Kunstwcrke eindeutig bestimmt. Noch heute liegt
Abb. 5. Kopf des Amenemhet III. (Holz).
r
Meeres fortgepslanzt, ist nach Griechenland über-
gesprungen und hat sich dann in Jtalicn angesiedelt;
nach Besiedelung der Küstenländer haben dic westeuro-
paischen Bölker in dcn Stronr eingegriffen und die
produktive Rolle übernommen. Das soll nun nicht
heißen, als ob dieser ganze Verlauf immer nur das Fort-
leben des ägyptischen Erbcs bedeute, sondern soll nur
den zusammenhangenden Ablauf der kulturellen Folge
kennzeichnen, wobei das Tcmpo der Entwicklung immer
rascher geworden ist und der Schwerpunkt immer mehr
vom Osten nach dem Westen hin sich verschoben hat.
Diesem Kreislauf müssen wir, wenn wir die Gesamtheit
des kulturellen Lebens auf Erden überblicken, dcn dcs
ostasiatischen und den des indischen Lebens gcsondert
an die Seite stellen. Viel-
leicht ist es nun die histo-
rische Aufgabe der Gegen-
wart, diese drei Kreise in
einen gemeinsam - mcnsch-
hcitlichen Kreis überzuleiten,
wobei vorläufig noch West-
europa und Ostasien die
beiden Pole be-deuten. Da-
bei komme ich noch einmal
auf das in der Einleitung
Gesagte zurück, um die Er-
gänzung beizufügen, daß
nicht nur unsere persön-
lichen Bedürfnisse uns die
Möglichkcit zur Überleitung
von einer rein nationalcn
zu einer menschheitlichen
Kultur geben, sondern daß
die kulturhistorische Welt-
lage mit Awang dazu for-
dert. Wir müssen uns über
die geistigen Werte Außer-
europas klar werden, dürfcn
uns nicht mehr verschließen,
müssen bedingungslos an-
erkennen, wo wirkliche Werte
liegen, um nicht zu ersticken
und zu verkünmrern. Und
dabei müssen wir bis auf
die Anfänge zurückgreifen.
Jn den Flußländern
des Nils und Euphrats, des
Ganges und des Hoang-Ho haben die verschiedenen
Grundtypen der Lebensordnung und damit der künst-
lerischen Traditionen sich gebildet. Das historische Alter
Chinas ist in dieselbe Tiefe der Vergangenheit zu setzen
wic das Agyptens und Babyloniens, und Jndiens Alter
wird nur um weniges jünger anzusetzen sein. Von
Jndiens Denkmälern aber ist alles bis zum dritten vor-
christlichen Jahrhundert verlorengegangen; in China sind
nur Reste erhalten geblieben, ehrwürdige Bronzen, die
zu den kostbarsten Seltenheiten gehören. Um so be-
deutungsvoller ist daher die ununterbrochene Neihe von
Denkmälern, die sich im Niltal erhalten hat.
Die kleine Lese, die das Muscum Folkwang in letzter
Aeit aus diesem Reichtum erworben hat, umfaßt Werke
p'/p'/ IVI
der Hauptcpochen dieser Jahrtausende umfasscnden
Kunstentwicklung von der memphitischen Aeit an bis zur
saitischen. Das ganze zauberhafte Licht des Niltales
mit seinen großen Linien und Kontrasten, seiner Klar-
heit und scharfen Begrenzung licgt wie ein Abglanz in
diescn kleinen Trümmern verschlossen, Erinnerungen be-
glcitend, Verlangen weckend und tief in das Wesen
unseres heutigen Suchens hineingreifend.
Alle archaische Kunst bedeutet nicht nur einen rein
künstlerischen, sondern auch cinen religiösen Vorgang;
diese Tatsache der engen Verguickung von künstlerischem
und mythischem Erlebnis hat sich erst mit der einsetzen-
den Jndividualisierung des Künstlers verwischt. Es
wäre grundfalsch, in dieser alten Verbindung der künst-
lerischen und religiösen Pro-
bleme cine Awecksetzung
und damit Verengung der
künstlerischen Freiheit und
der Kunst überhaupt sehen
zu wollen. Jedes künst-
lerische Erlebnis ist ein gei--
stiges; früher ein religiöses
auf der Basis typischcr
Grundelemente, heute ein
philosophisches auf der Basis
des persönlichen Einzel-
willens; hcutzutage ist eö
das Erlebnis des Jndividu-
ums, früher war es das der
Gemeinsamkeit einer Aeit
und eines Volkes. Diese
Gememsamkeit geistig-reli-
giöser Normen gab dabei
dem einzelnen die große
Ruhe, die fanatische Auver-
sicht und eine zweifelsfreie
Uberzeugung, und niachte
Energien frei, die sonst —
wie dies so oft zu beobach-
ten ist — der formalen Pro-
duktion verlorengehen. Da-
bei ist noch dieser Unterschied
zu betonen, daß dadurch in
allcr archaischen Kunst im-
mer die gesammelte Ruhe
einer Gemeinschast, in der
moderncn aber die Erregt-
heit des einzelnen in seinem Kampfe mit eincr hartnäckig
verschlossenen Umgebung irgendwie den Grundton der
Werke mitbcstimmt. Diese religiöse Anordnung des
Empfindens und Gestaltens läßt sich ebenso in der ost-
asiatischen und indischen Kunst feststellen wie in der
ägyptischen; dabei soÜ nicht verschwicgen werden, daß
dabei die künstlcrische Entwicklung zuni Schluß immer
in einem formelhasten Schematismus erstarrt. Den
Gegenimpuls gegen diese in Agypten nach der Ramessi-
denzeit eintretende Erschlaffung bildet dann die Früh-
antike.
Durch diese Bindung des künstlerischen Erlebnisses
an das religiöse Erlebnis wird auch die Ausdruckbedeutung
der Kunstwcrke eindeutig bestimmt. Noch heute liegt
Abb. 5. Kopf des Amenemhet III. (Holz).
r