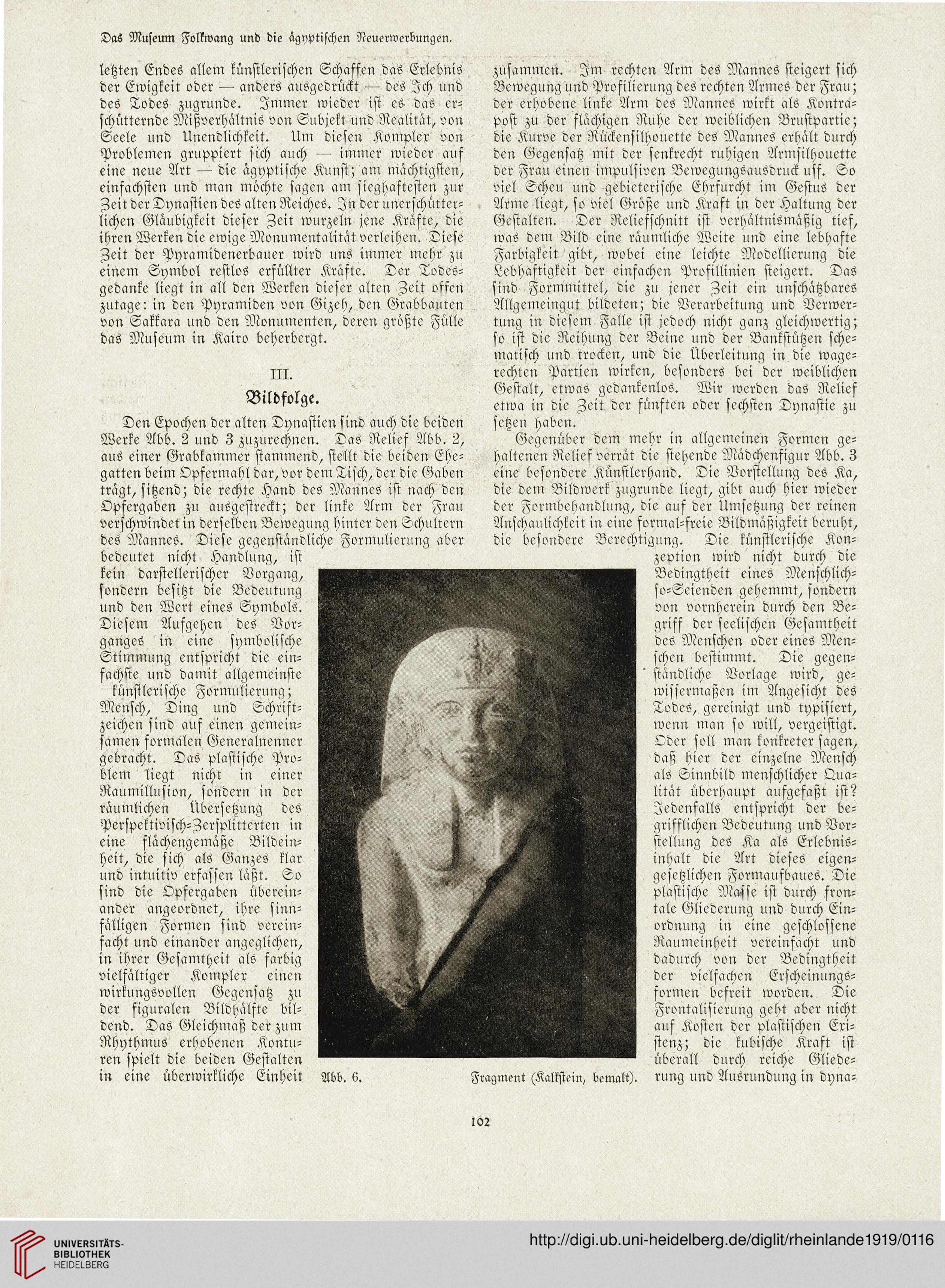Das Museum Folkwang und die ägyptischen Neuerwerbungen.
letztcn Endes allem künstlerischen Schaffen das ErlebniS
der Ewigkeit oder — anders ausgedrückt — des Jch und
des Todes zugrunde. Jmmer wieder ist es- das er-
schütternde Mißoerhältnis von Subjekt und Realitat, von
Seele und Unendlichkeit. Um diesen Kompler von
Problemen gruppiert sich auch — immer wieder auf
eine neue Art — die agyptische Kunst; am machtigstcn,
einfachsten und man möchte sagen am sieghaftesten zur
Aeit der Dynastien des alten Reiches. Jn dcr unerschütter-
lichen Glaubigkeit diescr Ieit wurzeln jene Kräfte, die
ihren Werken die ewige Monumentalität verleihen. Diese
Aeit der Pyramidenerbauer wird uns immer mehr zu
einem Symbol restlos erfüllter Kräfte. Der Todes-
gedanke liegt in all den Werken dieser alten Aeit offen
zutage: in den Pyramiden von Gizeh, den Grabbauten
von Sakkara cmd den Monumenten, deren größte Fülle
das Museum in Kairo beherbergt.
III.
Bildfolge.
Den Epochen der alten Dynastien sind auch die beiden
Werke Abb. 2 und 3 zuzurechnen. Das Relief Abb. 2,
aus einer Grabkammer stammend, ste'llt die beiden Ehe-
gattcn beim Opfermahl dar, vor dem Tisch, der die Gaben
trägt, sitzend; die rechte Hand des Mannes ist nach den
Opfergaben zu ausgestreckt; der linke Arm der Frau
verschwindet in derselben Bewegclng hinter den Schultcrn
des Mannes. Diese gegenstandliche Formulicrung aber
bedeutet nicht Handlung, ist
kein darstellerischer Borgang,
sondern besitzt die Bedeutung
und den Wert eines Symbols.
Diesem Aufgehen des Bor-
ganges in eine symbolische
Stimmung entspricht die ein-
fachste und damit allgemeinste
künstlerische Formulierung;
Mensch, Ding und Schrift-
zeichen sind auf einen gcmein-
samen formalen Generalnenner
gebracht. Das plastische Pro-
blem liegt nicht in einer
Raumillusion, sondern in der
räumlichen Übersetzung des
Perspektivisch-Aersplitterten in
eine flächengemäße Bildein-
heit, die sich als Ganzes klar
und intuitiv erfassen läßt. So
sind die Opfergaben überein-
ander angeordnet, ihre sinn-
fälligen Formen sind verein-
facht und einander angeglichen,
in ihrer Gesamtheit als farbig
vielfältiger Kompler einen
wirkungsvollen Gegensatz zu
der figuralen Bildhalfte bil-
dend. Das Gleichmaß der zum
Rhythmus erhobenen Kontu-
ren spielt die beiden Gestalten
in eine überwirkliche Einheit
zusammen. Im rechten Arm des Mannes steigert sich
Bewegung und Profilierung des rechten Armes der Frau;
der erhobene linke Arn: des Mannes wirkt als Kontra-
post zu der flachigen Ruhe der weiblichen Brr>stpartie;
die Kurve der Rückensilhouette des Mannes erhält durch
den Gegensatz mit der senkrecht ruhigen Armsilhouette
der Frau einen impulsiven Bewegungsausdruck usf. So
viel Scheu und gebieterische Ehrfurcht im Gestus der
Arme liegt, so viel Größe und Kraft in der Haltung der
Gestalten. Der Reliefschnitt ist verhältnismäßig tief,
was dem Bild eine räumliche Weite und eine lebhafte
FarbigkeiOgibt, wobei eine leichte Modellierung die
Lebhaftigkeit der einfachen Profillinien stcigert. Das
sind Formmittel, die zu jener Aeit ein unschätzbares
Allgemcingut bildeten; die Verarbeitung und Verwer-
tung in diesem Falle ist jedoch nicht ganz gleichwertig;
so ist die Reihung der Beine und der Bankstützen sche-
matisch und trocken, und die Überleitung in die wage-
rechten Partien wirken, besonders bei der weiblichen
Gestalt, etwas gedankenlos. Wir werden das Relief
etwa in die Aeit der fünften oder sechsten Dynastie zu
setzen haben.
Gegenüber dem mehr in allgemeinen Formen ge-
haltenen Relief verrät die stehende Mädchenfigur Abb. 3
eine besondere Künstlerhand. Die Vorstcllung des Ka,
die dem Bildwerk zugrunde liegt, gibt auch hier wieder
der Formbehandlung, die auf der ümsetzung der reinen
Anschaulichkeit in eine formal-freie Bildmäßigkeit beruht,
die besondere Berechtigung. Die künstlerische Kon-
zeption wird nicht durch die
Bedingtheit eines Menschlich-
so-Seienden gehemmt, sondern
von vornherein durch den Be-
griff der seelischen Gesamtheit
des Menschen oder eines Men-
schen bestimmt. Die gegen-
ständliche Vorlage wird, ge-
wisscrmaßen im Angesicht des
Todes, gereinigt und typisiert,
wenn man so will, vergeistigt.
Oder soll man konkreter sagen,
daß hier der einzelne Mensch
als Sinnbild menschlicher O.ua-
litat überhaupt aufgefaßt ist?
Jedenfalls entspricht der be-
grifflichen Bedeutung und Vor-
stellung des Ka als Erlebnis-
inhalt die Art dieses eigen-
gesetzlichcn Formaufbaues. Die
plastische Masse ist durch fron-
tale Gliederung und durch Ein-
ordnung in eine geschlossene
Raumeinheit vereinfacht und
dadurch von der Bedingtheit
der vielfachcn Erscheinungs-
formcn befreit worden. Die
Frontalisierung geht aber nicht
auf Kosten der plastischen Eri-
stenz; die kubische Kraft ist
überall durch reiche Gliede-
rung und Ausrundung in dyna-
Abb. 6. Fragment (Kalkstein, bemalt).
102
letztcn Endes allem künstlerischen Schaffen das ErlebniS
der Ewigkeit oder — anders ausgedrückt — des Jch und
des Todes zugrunde. Jmmer wieder ist es- das er-
schütternde Mißoerhältnis von Subjekt und Realitat, von
Seele und Unendlichkeit. Um diesen Kompler von
Problemen gruppiert sich auch — immer wieder auf
eine neue Art — die agyptische Kunst; am machtigstcn,
einfachsten und man möchte sagen am sieghaftesten zur
Aeit der Dynastien des alten Reiches. Jn dcr unerschütter-
lichen Glaubigkeit diescr Ieit wurzeln jene Kräfte, die
ihren Werken die ewige Monumentalität verleihen. Diese
Aeit der Pyramidenerbauer wird uns immer mehr zu
einem Symbol restlos erfüllter Kräfte. Der Todes-
gedanke liegt in all den Werken dieser alten Aeit offen
zutage: in den Pyramiden von Gizeh, den Grabbauten
von Sakkara cmd den Monumenten, deren größte Fülle
das Museum in Kairo beherbergt.
III.
Bildfolge.
Den Epochen der alten Dynastien sind auch die beiden
Werke Abb. 2 und 3 zuzurechnen. Das Relief Abb. 2,
aus einer Grabkammer stammend, ste'llt die beiden Ehe-
gattcn beim Opfermahl dar, vor dem Tisch, der die Gaben
trägt, sitzend; die rechte Hand des Mannes ist nach den
Opfergaben zu ausgestreckt; der linke Arm der Frau
verschwindet in derselben Bewegclng hinter den Schultcrn
des Mannes. Diese gegenstandliche Formulicrung aber
bedeutet nicht Handlung, ist
kein darstellerischer Borgang,
sondern besitzt die Bedeutung
und den Wert eines Symbols.
Diesem Aufgehen des Bor-
ganges in eine symbolische
Stimmung entspricht die ein-
fachste und damit allgemeinste
künstlerische Formulierung;
Mensch, Ding und Schrift-
zeichen sind auf einen gcmein-
samen formalen Generalnenner
gebracht. Das plastische Pro-
blem liegt nicht in einer
Raumillusion, sondern in der
räumlichen Übersetzung des
Perspektivisch-Aersplitterten in
eine flächengemäße Bildein-
heit, die sich als Ganzes klar
und intuitiv erfassen läßt. So
sind die Opfergaben überein-
ander angeordnet, ihre sinn-
fälligen Formen sind verein-
facht und einander angeglichen,
in ihrer Gesamtheit als farbig
vielfältiger Kompler einen
wirkungsvollen Gegensatz zu
der figuralen Bildhalfte bil-
dend. Das Gleichmaß der zum
Rhythmus erhobenen Kontu-
ren spielt die beiden Gestalten
in eine überwirkliche Einheit
zusammen. Im rechten Arm des Mannes steigert sich
Bewegung und Profilierung des rechten Armes der Frau;
der erhobene linke Arn: des Mannes wirkt als Kontra-
post zu der flachigen Ruhe der weiblichen Brr>stpartie;
die Kurve der Rückensilhouette des Mannes erhält durch
den Gegensatz mit der senkrecht ruhigen Armsilhouette
der Frau einen impulsiven Bewegungsausdruck usf. So
viel Scheu und gebieterische Ehrfurcht im Gestus der
Arme liegt, so viel Größe und Kraft in der Haltung der
Gestalten. Der Reliefschnitt ist verhältnismäßig tief,
was dem Bild eine räumliche Weite und eine lebhafte
FarbigkeiOgibt, wobei eine leichte Modellierung die
Lebhaftigkeit der einfachen Profillinien stcigert. Das
sind Formmittel, die zu jener Aeit ein unschätzbares
Allgemcingut bildeten; die Verarbeitung und Verwer-
tung in diesem Falle ist jedoch nicht ganz gleichwertig;
so ist die Reihung der Beine und der Bankstützen sche-
matisch und trocken, und die Überleitung in die wage-
rechten Partien wirken, besonders bei der weiblichen
Gestalt, etwas gedankenlos. Wir werden das Relief
etwa in die Aeit der fünften oder sechsten Dynastie zu
setzen haben.
Gegenüber dem mehr in allgemeinen Formen ge-
haltenen Relief verrät die stehende Mädchenfigur Abb. 3
eine besondere Künstlerhand. Die Vorstcllung des Ka,
die dem Bildwerk zugrunde liegt, gibt auch hier wieder
der Formbehandlung, die auf der ümsetzung der reinen
Anschaulichkeit in eine formal-freie Bildmäßigkeit beruht,
die besondere Berechtigung. Die künstlerische Kon-
zeption wird nicht durch die
Bedingtheit eines Menschlich-
so-Seienden gehemmt, sondern
von vornherein durch den Be-
griff der seelischen Gesamtheit
des Menschen oder eines Men-
schen bestimmt. Die gegen-
ständliche Vorlage wird, ge-
wisscrmaßen im Angesicht des
Todes, gereinigt und typisiert,
wenn man so will, vergeistigt.
Oder soll man konkreter sagen,
daß hier der einzelne Mensch
als Sinnbild menschlicher O.ua-
litat überhaupt aufgefaßt ist?
Jedenfalls entspricht der be-
grifflichen Bedeutung und Vor-
stellung des Ka als Erlebnis-
inhalt die Art dieses eigen-
gesetzlichcn Formaufbaues. Die
plastische Masse ist durch fron-
tale Gliederung und durch Ein-
ordnung in eine geschlossene
Raumeinheit vereinfacht und
dadurch von der Bedingtheit
der vielfachcn Erscheinungs-
formcn befreit worden. Die
Frontalisierung geht aber nicht
auf Kosten der plastischen Eri-
stenz; die kubische Kraft ist
überall durch reiche Gliede-
rung und Ausrundung in dyna-
Abb. 6. Fragment (Kalkstein, bemalt).
102