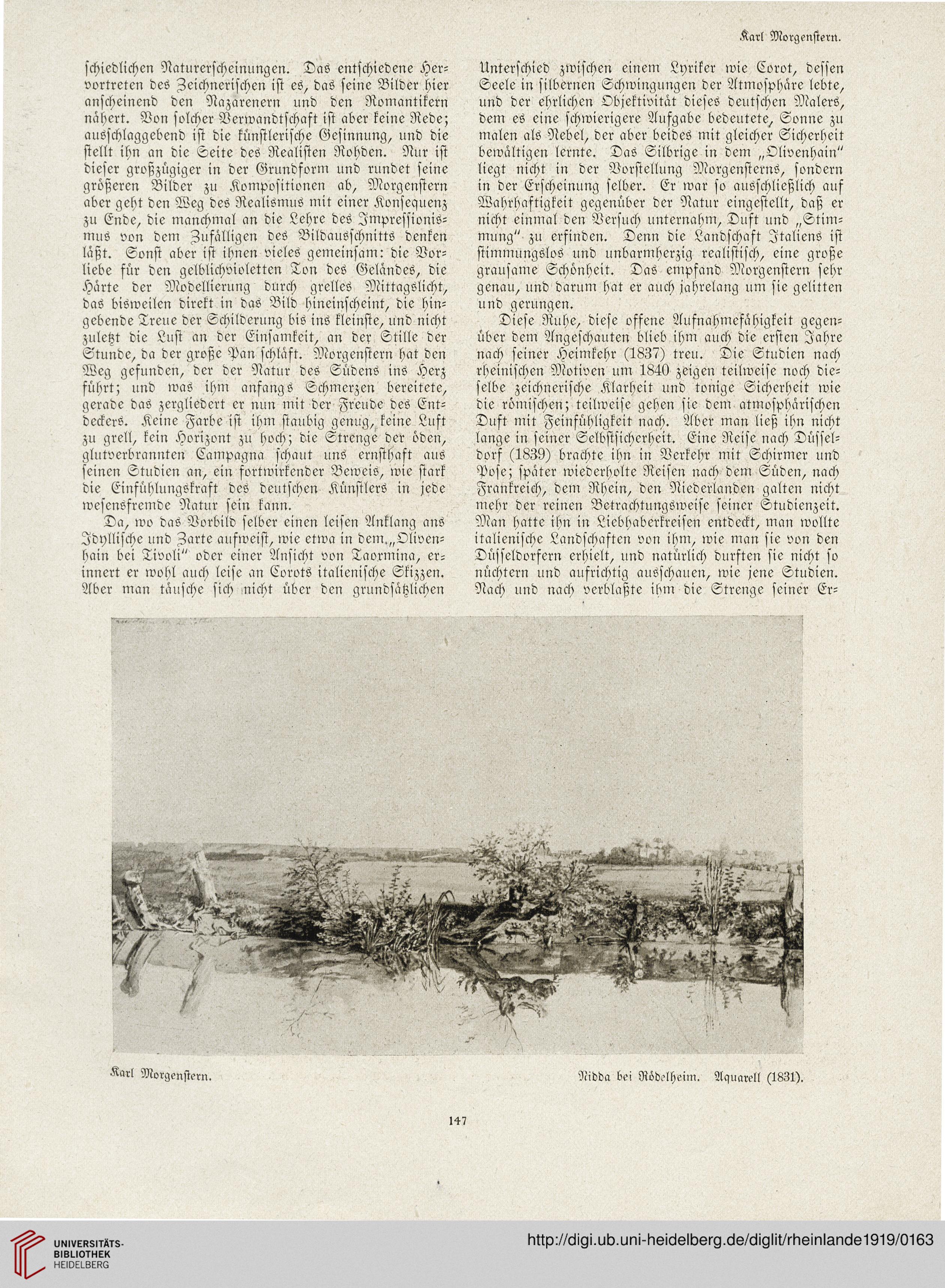Karl Morgenstern.
schiedlichen Naturerscheinungen. Das entschiedene Her-
vortreten des Zeichnerischen ist ech das seine Bilder hier
anscheinend den Nazarenern und den Romantikern
nähert. Bon solcher Verwandtschaft ist aber keine Rede;
ausschlaggebend ist die künstlerische Gesinnung, und die
stellt ihn an die Seite des Realisten Rohden. Nur ist
dieser großzügiger in der Grundform und rundet seine
größeren Bilder zu Kompositionen ab, Morgenstern
aber geht den Weg des Realismus mit einer K'onsequenz
zu Ende, die manchmal an die Lehre des Jmpressionis-
mus von dem Aufälligen des Bildausschnitts denken
läßt. Sonst aber ist ihnen vieles gemeinsam: die Vor-
liebe für den gelblichvioletten Ton des Geländes, die
Härte der Modellicrung durch grelles Mittagslicht,
das bisweilen direkt in das Bild hineinscheint, die hin-
gebende Treue der Schilderung bis ins kleinste, und nicht
zuletzt die Lust an der Einsamkeit, an der Stille der
Stunde, da der große Pan schläft. Morgenstern hat dcn
Weg gefunden, der der Natur des Südens ins Herz
führt; und was ihm anfangs Schmerzen bereitete,
gerade das zergliedert er nun mit der Freude des Ent-
deckers. Keine Farbe ist ihm staubig genug, keine Luft
zu grell, kein Horizont zu hoch; die Strenge der öden,
glutverbrannten Campagna schaut uns ernsthaft aus
seinen Studien an, ein fortwirkender Beweis, wie stark
die Einfühlungskraft des deutschen Künstlers in jcde
wesensfremde Natur sein kann.
Da, wo das Vorbild selber einen leisen Anklang ans
Jdyllische und Aarte aufweist, wie etwa in dem,„Oliven-
hain bei Tivoli" oder einer Ansicht von Taormina, er-
innert er wohl auch leise an Corots italienische Skizzen.
Aber man täusche sich nicht über den grundsätzlichen
Unterschied zwüschen einem Lyriker wie Corot, dessen
Seele in silbernen Schwingungen der Atmosphare lebte,
und der ehrlichen Objektivitat dieses deutschen Malers,
dem es eine schwierigere Aufgabe bedeutete, Sonne zu
malen als Nebel, der aber beides mit gleicher Sicherheit
bewältigen lernte. Das Silbrige in dem „Olivenhain"
liegt nicht in der Vorstellung Morgensterns, sondern
in der Erscheinung selber. Er war so ausschließlich auf
Wahrhaftigkeit gegenüber der Natur eingestellt, daß er
nicht einmal den Versuch unternahm, Duft und „Stim-
mung" zu erfinden. Denn die Landschaft Jtaliens ist
stimmungslos und unbarmherzig realistisch, eine große
grausame Schönheit. Das empfand Morgenstern sehr
genau, und darum hat er auch jahrelang um sie gelitten
und gerungen.
Diese Ruhe, diese offene Aufnahmcfähigkeit gegen-
über dem Angeschauten blieb ihm auch die ersten Jahre
nach seiner Heimkehr (1837) treu. Die Studien nach
rheinischen Motiven um 1840 zeigen teilwcise noch die-
selbe zeichnerische Klarheit und tonige Sicherheit wie
die römischen; teilweise gehen sie dem atmosphärischen
Duft mit Feinfühligkeit nach. Aber man ließ ihn nicht
lange in seiner Selbstsicherheit. Eine Reise nach Düssel-
dorf (1839) brachte ihn in Verkehr mit Schirmer und
Pose; später wiederholte Reisen nach dem Süden, nach
Frankreich, dem Rhein, den Niederlanden galten nicht
mehr der rcinen Betrachtungsweise seincr Studienzeit.
Man hatte ihn in Liebhaberkreisen entdeckt, man wollte
italienische Landschaften von ihm, wie man sie von den
Düsseldorfern erhielt, und natürlich durften sie nicht so
nüchtern und aufrichtig ausschauen, wie jene Studien.
Nach und nach verblaßte ihm die Strenge seincr Er-
Karl Morgenstern. Nidda bei Rödelheim, Aquarell (1831).
147
schiedlichen Naturerscheinungen. Das entschiedene Her-
vortreten des Zeichnerischen ist ech das seine Bilder hier
anscheinend den Nazarenern und den Romantikern
nähert. Bon solcher Verwandtschaft ist aber keine Rede;
ausschlaggebend ist die künstlerische Gesinnung, und die
stellt ihn an die Seite des Realisten Rohden. Nur ist
dieser großzügiger in der Grundform und rundet seine
größeren Bilder zu Kompositionen ab, Morgenstern
aber geht den Weg des Realismus mit einer K'onsequenz
zu Ende, die manchmal an die Lehre des Jmpressionis-
mus von dem Aufälligen des Bildausschnitts denken
läßt. Sonst aber ist ihnen vieles gemeinsam: die Vor-
liebe für den gelblichvioletten Ton des Geländes, die
Härte der Modellicrung durch grelles Mittagslicht,
das bisweilen direkt in das Bild hineinscheint, die hin-
gebende Treue der Schilderung bis ins kleinste, und nicht
zuletzt die Lust an der Einsamkeit, an der Stille der
Stunde, da der große Pan schläft. Morgenstern hat dcn
Weg gefunden, der der Natur des Südens ins Herz
führt; und was ihm anfangs Schmerzen bereitete,
gerade das zergliedert er nun mit der Freude des Ent-
deckers. Keine Farbe ist ihm staubig genug, keine Luft
zu grell, kein Horizont zu hoch; die Strenge der öden,
glutverbrannten Campagna schaut uns ernsthaft aus
seinen Studien an, ein fortwirkender Beweis, wie stark
die Einfühlungskraft des deutschen Künstlers in jcde
wesensfremde Natur sein kann.
Da, wo das Vorbild selber einen leisen Anklang ans
Jdyllische und Aarte aufweist, wie etwa in dem,„Oliven-
hain bei Tivoli" oder einer Ansicht von Taormina, er-
innert er wohl auch leise an Corots italienische Skizzen.
Aber man täusche sich nicht über den grundsätzlichen
Unterschied zwüschen einem Lyriker wie Corot, dessen
Seele in silbernen Schwingungen der Atmosphare lebte,
und der ehrlichen Objektivitat dieses deutschen Malers,
dem es eine schwierigere Aufgabe bedeutete, Sonne zu
malen als Nebel, der aber beides mit gleicher Sicherheit
bewältigen lernte. Das Silbrige in dem „Olivenhain"
liegt nicht in der Vorstellung Morgensterns, sondern
in der Erscheinung selber. Er war so ausschließlich auf
Wahrhaftigkeit gegenüber der Natur eingestellt, daß er
nicht einmal den Versuch unternahm, Duft und „Stim-
mung" zu erfinden. Denn die Landschaft Jtaliens ist
stimmungslos und unbarmherzig realistisch, eine große
grausame Schönheit. Das empfand Morgenstern sehr
genau, und darum hat er auch jahrelang um sie gelitten
und gerungen.
Diese Ruhe, diese offene Aufnahmcfähigkeit gegen-
über dem Angeschauten blieb ihm auch die ersten Jahre
nach seiner Heimkehr (1837) treu. Die Studien nach
rheinischen Motiven um 1840 zeigen teilwcise noch die-
selbe zeichnerische Klarheit und tonige Sicherheit wie
die römischen; teilweise gehen sie dem atmosphärischen
Duft mit Feinfühligkeit nach. Aber man ließ ihn nicht
lange in seiner Selbstsicherheit. Eine Reise nach Düssel-
dorf (1839) brachte ihn in Verkehr mit Schirmer und
Pose; später wiederholte Reisen nach dem Süden, nach
Frankreich, dem Rhein, den Niederlanden galten nicht
mehr der rcinen Betrachtungsweise seincr Studienzeit.
Man hatte ihn in Liebhaberkreisen entdeckt, man wollte
italienische Landschaften von ihm, wie man sie von den
Düsseldorfern erhielt, und natürlich durften sie nicht so
nüchtern und aufrichtig ausschauen, wie jene Studien.
Nach und nach verblaßte ihm die Strenge seincr Er-
Karl Morgenstern. Nidda bei Rödelheim, Aquarell (1831).
147