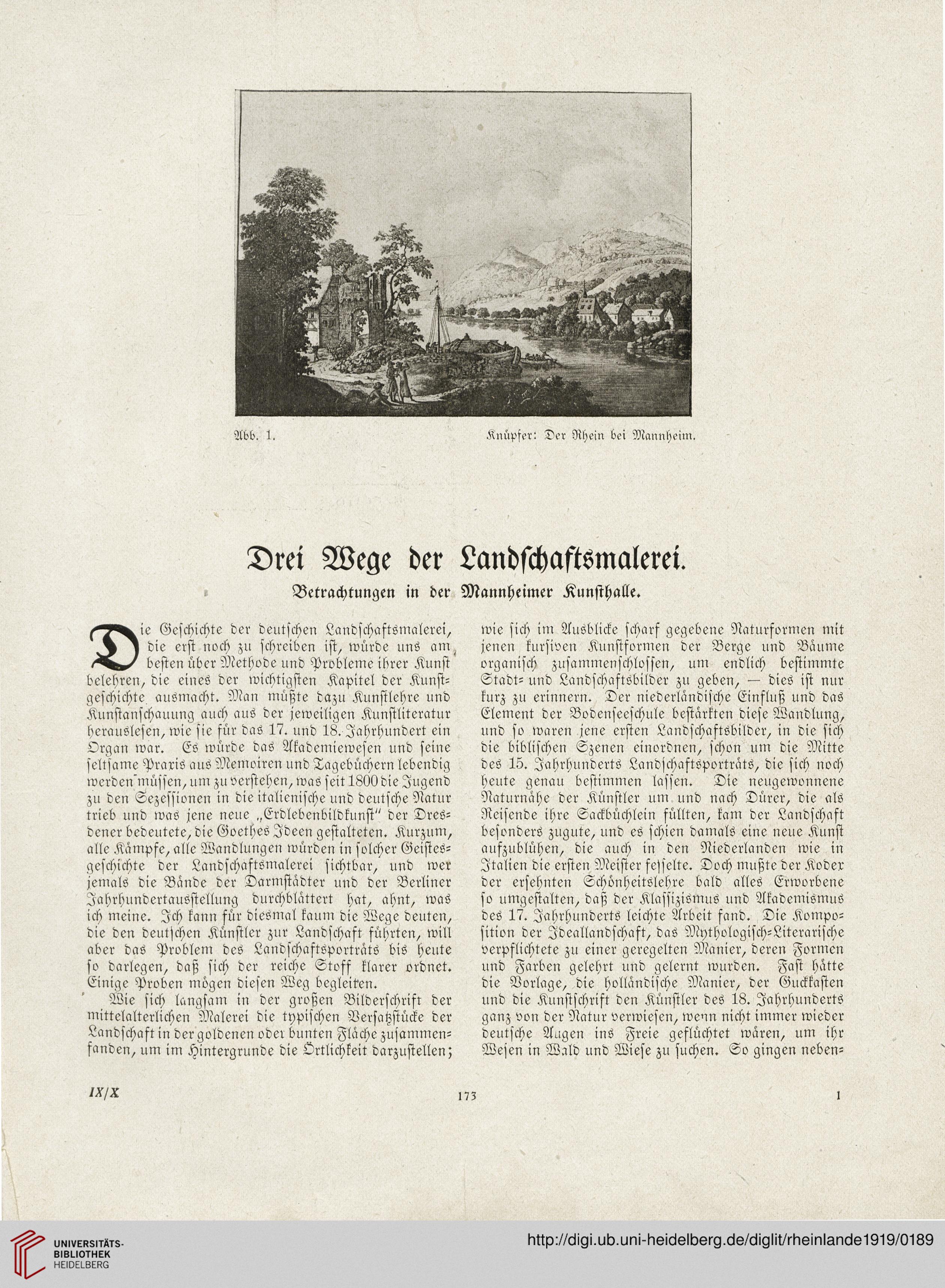Abb. 1. Knüpfer: Der Rhein bei Mannheim.
Drei Wege der Landschaftsmalerei.
Betrachtungen in der Mannheimer Kunsthalle.
ie Geschichte der deutschen Landschaftsmalerei,
die erst noch zu schreiben ist, würde uns am,
besten übcr Methode und Probleme ibrer Kunst
belehren, die eines der wichtigsten Kapitel der Kunst-
geschichte ausmacht. Man müßte dazu Kunstlehre und
Kunstanschauung auch aus der jewciligen Kunstliteratur
herauslesen, wic sie für das 17. und 18. Jahrhundert ein
Organ war. Es würde das Akademiewesen und seine
seltsame Praris aus Memoiren und Tagebüchern lebendig
werden'müssen, um zu verstehen, was seit 1800 die Jugend
zu den Sezessionen in die italienische und deutsche Natur
trieb und was jene neue .,Erdlebenbildkunst" der DreS-
dener bedeutete, die Goethes Jdeen gestaltcten. Kurzum,
alle Kämpfe, alle Wandlungen würden in solcher Geistes-
geschichte der Landschaftsmalerei sichtbar, und wer
jemals die Bande der Darmstadter und der Berliner
Jahrhundertausstellung durchblattert hat, ahnt, was
ich meine. Jch kann für diesmal kaum die Wege deuten,
die den deutschcn Künstler zur Landschaft führten, will
aber das Problem des Landschaftsporträts bis heute
so darlegen, daß sich der reiche Stoff klarer ordnet.
Einige Proben mögen diesen Weg begleiken.
Wie sich langsam in der großen Bilderschrift der
niittelalterlichen Malerei die typischen Versatzstücke der
Landschaft in der goldenen oder bunten Fläche zusammen-
fanden, um im Hintergrunde die Ortlichkeit darzustellen;
wie sich im Ausblicke scharf gegebene Naturformen mit
jenen kursiven Kunstformen der Berge und Baume
organisch zusammenschlossen, um endlich bestimmte
Stadt- und Landschaftsbilder zu geben, — dies ist nur
kurz zu erinnern. Der niederländische Einfluß und das
Element der Bodenseeschule bestärkten diese Wandlung,
und so waren jene ersten Landschaftsbilder, in die sich
die biblischen Szenen einordnen, schon um die Mitte
des 15. Jahrhunderts Landschaftsporträts, die sich noch
heute genau bestimmen lassen. Die neugewonnene
Naturnähe der Künstler um und nach Dürer, die als
Reisende ihre Sackbüchlein füllten, kam der Landschaft
besonders zugute, und es schien damals eine neue Kunst
aufzublühen, die auch in den Niederlanden wie in
Jtalien die ersten Meister fesselte. Doch mußte der Koder
der ersehnten Schönheitslehre bald alles Erworbene
so umgestalten, daß der Klassizismus und Akademismuö
des 17. Jahrhunderts leichte Arbeit fand. Die Kompo-
sition der Jdeallandschaft, das Mythologisch-Literarische
verpflichtete zu einer geregelten Manier, deren Formen
und Farben gelehrt und gelernt wurden. Fast hätte
die Vorlage, die holländische Manier, der Guckkasten
und die Kunstschrift den Künstler des 18. Jahrhunderts
ganz von der Natur verwiesen, wenn nicht immer wieder
deutsche Augen ins Freie geflüchtet waren, um ihr
Wesen in Wald und Wiese zu suchen. So gingen neben-
l
Drei Wege der Landschaftsmalerei.
Betrachtungen in der Mannheimer Kunsthalle.
ie Geschichte der deutschen Landschaftsmalerei,
die erst noch zu schreiben ist, würde uns am,
besten übcr Methode und Probleme ibrer Kunst
belehren, die eines der wichtigsten Kapitel der Kunst-
geschichte ausmacht. Man müßte dazu Kunstlehre und
Kunstanschauung auch aus der jewciligen Kunstliteratur
herauslesen, wic sie für das 17. und 18. Jahrhundert ein
Organ war. Es würde das Akademiewesen und seine
seltsame Praris aus Memoiren und Tagebüchern lebendig
werden'müssen, um zu verstehen, was seit 1800 die Jugend
zu den Sezessionen in die italienische und deutsche Natur
trieb und was jene neue .,Erdlebenbildkunst" der DreS-
dener bedeutete, die Goethes Jdeen gestaltcten. Kurzum,
alle Kämpfe, alle Wandlungen würden in solcher Geistes-
geschichte der Landschaftsmalerei sichtbar, und wer
jemals die Bande der Darmstadter und der Berliner
Jahrhundertausstellung durchblattert hat, ahnt, was
ich meine. Jch kann für diesmal kaum die Wege deuten,
die den deutschcn Künstler zur Landschaft führten, will
aber das Problem des Landschaftsporträts bis heute
so darlegen, daß sich der reiche Stoff klarer ordnet.
Einige Proben mögen diesen Weg begleiken.
Wie sich langsam in der großen Bilderschrift der
niittelalterlichen Malerei die typischen Versatzstücke der
Landschaft in der goldenen oder bunten Fläche zusammen-
fanden, um im Hintergrunde die Ortlichkeit darzustellen;
wie sich im Ausblicke scharf gegebene Naturformen mit
jenen kursiven Kunstformen der Berge und Baume
organisch zusammenschlossen, um endlich bestimmte
Stadt- und Landschaftsbilder zu geben, — dies ist nur
kurz zu erinnern. Der niederländische Einfluß und das
Element der Bodenseeschule bestärkten diese Wandlung,
und so waren jene ersten Landschaftsbilder, in die sich
die biblischen Szenen einordnen, schon um die Mitte
des 15. Jahrhunderts Landschaftsporträts, die sich noch
heute genau bestimmen lassen. Die neugewonnene
Naturnähe der Künstler um und nach Dürer, die als
Reisende ihre Sackbüchlein füllten, kam der Landschaft
besonders zugute, und es schien damals eine neue Kunst
aufzublühen, die auch in den Niederlanden wie in
Jtalien die ersten Meister fesselte. Doch mußte der Koder
der ersehnten Schönheitslehre bald alles Erworbene
so umgestalten, daß der Klassizismus und Akademismuö
des 17. Jahrhunderts leichte Arbeit fand. Die Kompo-
sition der Jdeallandschaft, das Mythologisch-Literarische
verpflichtete zu einer geregelten Manier, deren Formen
und Farben gelehrt und gelernt wurden. Fast hätte
die Vorlage, die holländische Manier, der Guckkasten
und die Kunstschrift den Künstler des 18. Jahrhunderts
ganz von der Natur verwiesen, wenn nicht immer wieder
deutsche Augen ins Freie geflüchtet waren, um ihr
Wesen in Wald und Wiese zu suchen. So gingen neben-
l