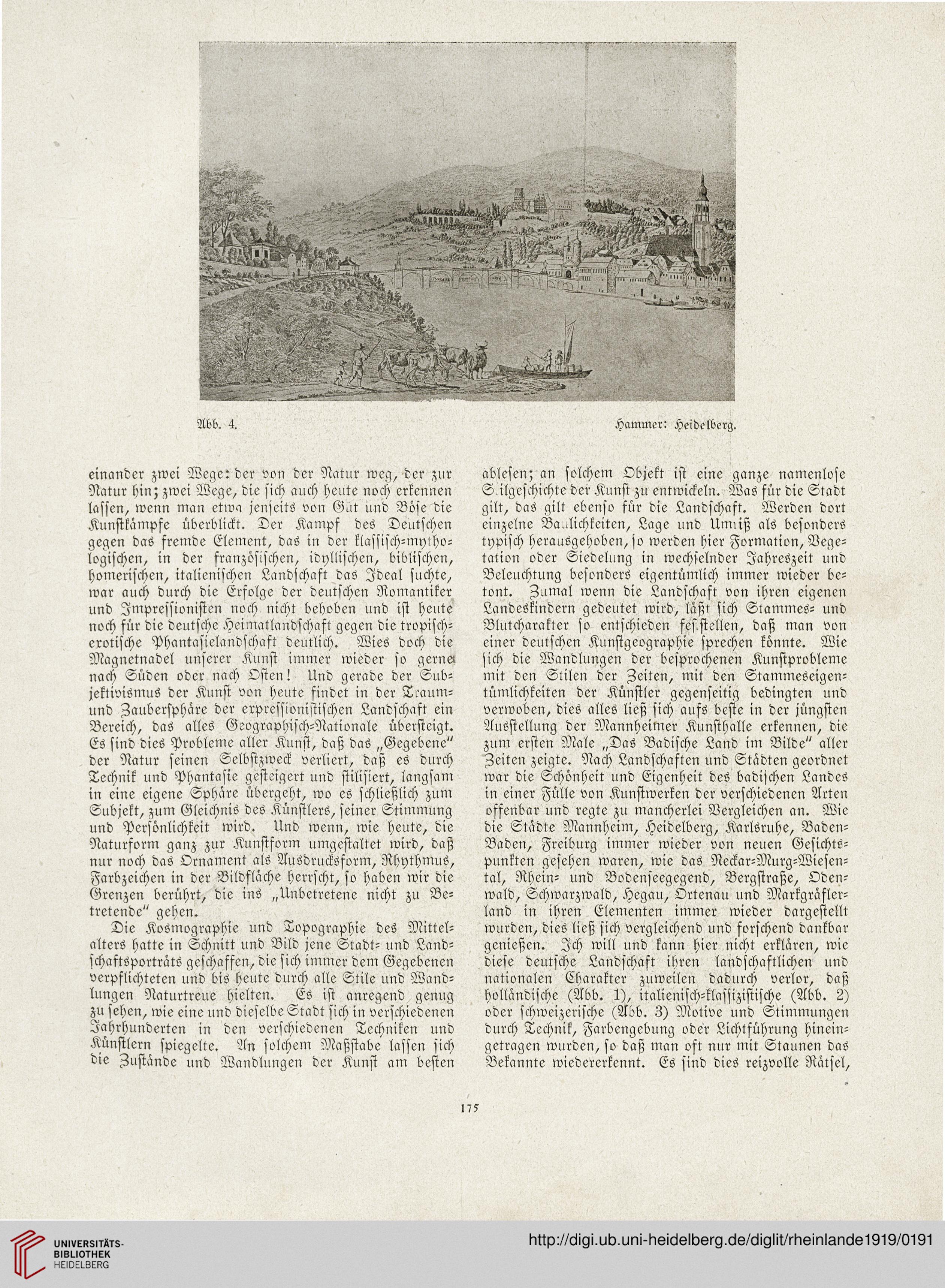Abb. 4. Harnmer: Heidclberg.
einander zwei Wege: der ven der Natur weg, der znr
Natur hin; zwei Wege, die sich auch heute noch erkennen
lassen, wenn man etwa jenseits von Gut und Böse die
Kunstkänrpfe überblickt. Der Kampf des Deutschen
gegen das fremde Element, das in der klassisch-mytho-
logischen, in der französischen, idyliischen, biblischen,
homerischen, italienischen Landschaft das Jdeal suchte,
war auch durch die Erfolge der deutschen Romantiker
und Jmpressionisten noch nicht behoben und ist heute
noch für die deutsche Heimatlandschaft gegen die tropisch-
erotische Phantasielandschaft deutlich. Wies doch die
Magnetnadel unserer Kunst immer wieder so gernet
nach Süden oder nach Osten! Und gerade der Sub-
jektivismus der Kunst von heute findet in der Tcaum-
und Aaubersphäre der erpressionistischen Landschaft ein
Bereich, das alles Geographisch-Nationale übersteigt.
Es sind dies Probleme aller Kunst, daß das „Gegebene"
der Natur seinen Selbstzweck verliert, daß es durch
Technik und Phantasie gesteigert und stilisiert, langsam
in eine eigene Sphäre übergeht, wo es schließlich zum
Subjekt, zum Gleichnis des Künstlers, seiner Stimmung
und Persönlichkeit wird. Und wenn, wie heute, die
Naturform ganz zur Kunstform umgestaltet wird, daß
nur noch das Ornament als Ausdrucksform, Rhythmus,
Farbzeichen in der Bildfläche herrscht, so haben wir die
Grenzen berührt, die ins „Unbetretene nicht zu Be-
tretende" gehen.
Die Kosmographie und Topographie des Mittel-
alters hatte in Schnitt und Bild jene Stadt- und Land-
schaftsporträts geschaffen, die sich immer dem Gegebenen
verpflichteten und bis heute durch alle Stile und Wand-
lungen Naturtreue hielten. Es ist anregend genug
zu sehen, wie eine und dieselbe Stadt sich in verschiedenen
Jahrhunderten in den verschiedenen Techniken und
Künstlern spiegelte. An solchem Maßstabe lassen sich
die Zustände und Wandlungen der Kunst am besten
ablesen; an solchem Objekt ist eine ganze namenlose
S.ilgeschichte der Kunst zu entwickeln. Was für die Stadt
gilt, das gilt ebenso für die Landschaft. Werden dort
einzelne Ba.ckichkeiten, Lage und Umnß als besonders
typisch herausgehoben, so werden hier Formation, Vege-
tation oder Siedelung in wechselnder Jahreszeit und
Beleuchtung besonders eigentünilich immer wieder be-
tont. Aumal wenn die Landschaft von ihren eigenen
Landeskindern gedeutet wird, läßt sich Slammes- und
Blutcharakter so entschieden fes.stellen, daß man von
einer deutschen Kunstgeographie sprechen könnte. Wie
sich die Wandlungen der besprochenen Kunstprobleme
mit den Slilen der Aeiten, mit den Stammeseigen-
tümlichkeiten der Künstler gegenseitig bedingten und
verwoben, dies alles ließ sich aufs beste in der jüngsten
Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle erkennen, die
zum ersten Male „Das Badische Land im Bilde" aller
Ieiten zeigte. Nach Landschaften und Städten geordnet
war die Schönheit und Eigenheit des badischen Landes
in einer Fülle von Kunstwerken der verschiedenen Artcn
offenbar und regte zu mancherlei Vergleichen an. Wie
die Städte Mannhcim, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-
Baden, Freiburg immer wieder von neuen Gesichts-
punkten gesehen waren, wie das Neckar-Murg-Wiesen-
tal, Rhein- und Bodenseegegend, Bergstraße, Oden-
wald, Schwarzwald, Hegau, Ortenau und Markgräfler-
land in ihren Elementen immer wieder dargestellt
wurden, dies ließ sich vergleichend und forschend dankbar
genießen. Jch will und kann hier nicht erklaren, wie
diese deutsche Landschaft ihren landschaftlichen und
nationalen Charakter zuweilen dadurch verlor, daß
holländische (Abb. 1), italienisch-klassizistische (Abb. 2)
oder schweizerische (Abb. 3) Motive und Stimmungcn
durch Technik, Farbengebung oder Lichtführung hinein-
getragen wurden, so daß man oft nur mit Staunen das
Bekannte wiedererkennt. Es sind dies reizvolle Rätsel,
>75
einander zwei Wege: der ven der Natur weg, der znr
Natur hin; zwei Wege, die sich auch heute noch erkennen
lassen, wenn man etwa jenseits von Gut und Böse die
Kunstkänrpfe überblickt. Der Kampf des Deutschen
gegen das fremde Element, das in der klassisch-mytho-
logischen, in der französischen, idyliischen, biblischen,
homerischen, italienischen Landschaft das Jdeal suchte,
war auch durch die Erfolge der deutschen Romantiker
und Jmpressionisten noch nicht behoben und ist heute
noch für die deutsche Heimatlandschaft gegen die tropisch-
erotische Phantasielandschaft deutlich. Wies doch die
Magnetnadel unserer Kunst immer wieder so gernet
nach Süden oder nach Osten! Und gerade der Sub-
jektivismus der Kunst von heute findet in der Tcaum-
und Aaubersphäre der erpressionistischen Landschaft ein
Bereich, das alles Geographisch-Nationale übersteigt.
Es sind dies Probleme aller Kunst, daß das „Gegebene"
der Natur seinen Selbstzweck verliert, daß es durch
Technik und Phantasie gesteigert und stilisiert, langsam
in eine eigene Sphäre übergeht, wo es schließlich zum
Subjekt, zum Gleichnis des Künstlers, seiner Stimmung
und Persönlichkeit wird. Und wenn, wie heute, die
Naturform ganz zur Kunstform umgestaltet wird, daß
nur noch das Ornament als Ausdrucksform, Rhythmus,
Farbzeichen in der Bildfläche herrscht, so haben wir die
Grenzen berührt, die ins „Unbetretene nicht zu Be-
tretende" gehen.
Die Kosmographie und Topographie des Mittel-
alters hatte in Schnitt und Bild jene Stadt- und Land-
schaftsporträts geschaffen, die sich immer dem Gegebenen
verpflichteten und bis heute durch alle Stile und Wand-
lungen Naturtreue hielten. Es ist anregend genug
zu sehen, wie eine und dieselbe Stadt sich in verschiedenen
Jahrhunderten in den verschiedenen Techniken und
Künstlern spiegelte. An solchem Maßstabe lassen sich
die Zustände und Wandlungen der Kunst am besten
ablesen; an solchem Objekt ist eine ganze namenlose
S.ilgeschichte der Kunst zu entwickeln. Was für die Stadt
gilt, das gilt ebenso für die Landschaft. Werden dort
einzelne Ba.ckichkeiten, Lage und Umnß als besonders
typisch herausgehoben, so werden hier Formation, Vege-
tation oder Siedelung in wechselnder Jahreszeit und
Beleuchtung besonders eigentünilich immer wieder be-
tont. Aumal wenn die Landschaft von ihren eigenen
Landeskindern gedeutet wird, läßt sich Slammes- und
Blutcharakter so entschieden fes.stellen, daß man von
einer deutschen Kunstgeographie sprechen könnte. Wie
sich die Wandlungen der besprochenen Kunstprobleme
mit den Slilen der Aeiten, mit den Stammeseigen-
tümlichkeiten der Künstler gegenseitig bedingten und
verwoben, dies alles ließ sich aufs beste in der jüngsten
Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle erkennen, die
zum ersten Male „Das Badische Land im Bilde" aller
Ieiten zeigte. Nach Landschaften und Städten geordnet
war die Schönheit und Eigenheit des badischen Landes
in einer Fülle von Kunstwerken der verschiedenen Artcn
offenbar und regte zu mancherlei Vergleichen an. Wie
die Städte Mannhcim, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-
Baden, Freiburg immer wieder von neuen Gesichts-
punkten gesehen waren, wie das Neckar-Murg-Wiesen-
tal, Rhein- und Bodenseegegend, Bergstraße, Oden-
wald, Schwarzwald, Hegau, Ortenau und Markgräfler-
land in ihren Elementen immer wieder dargestellt
wurden, dies ließ sich vergleichend und forschend dankbar
genießen. Jch will und kann hier nicht erklaren, wie
diese deutsche Landschaft ihren landschaftlichen und
nationalen Charakter zuweilen dadurch verlor, daß
holländische (Abb. 1), italienisch-klassizistische (Abb. 2)
oder schweizerische (Abb. 3) Motive und Stimmungcn
durch Technik, Farbengebung oder Lichtführung hinein-
getragen wurden, so daß man oft nur mit Staunen das
Bekannte wiedererkennt. Es sind dies reizvolle Rätsel,
>75