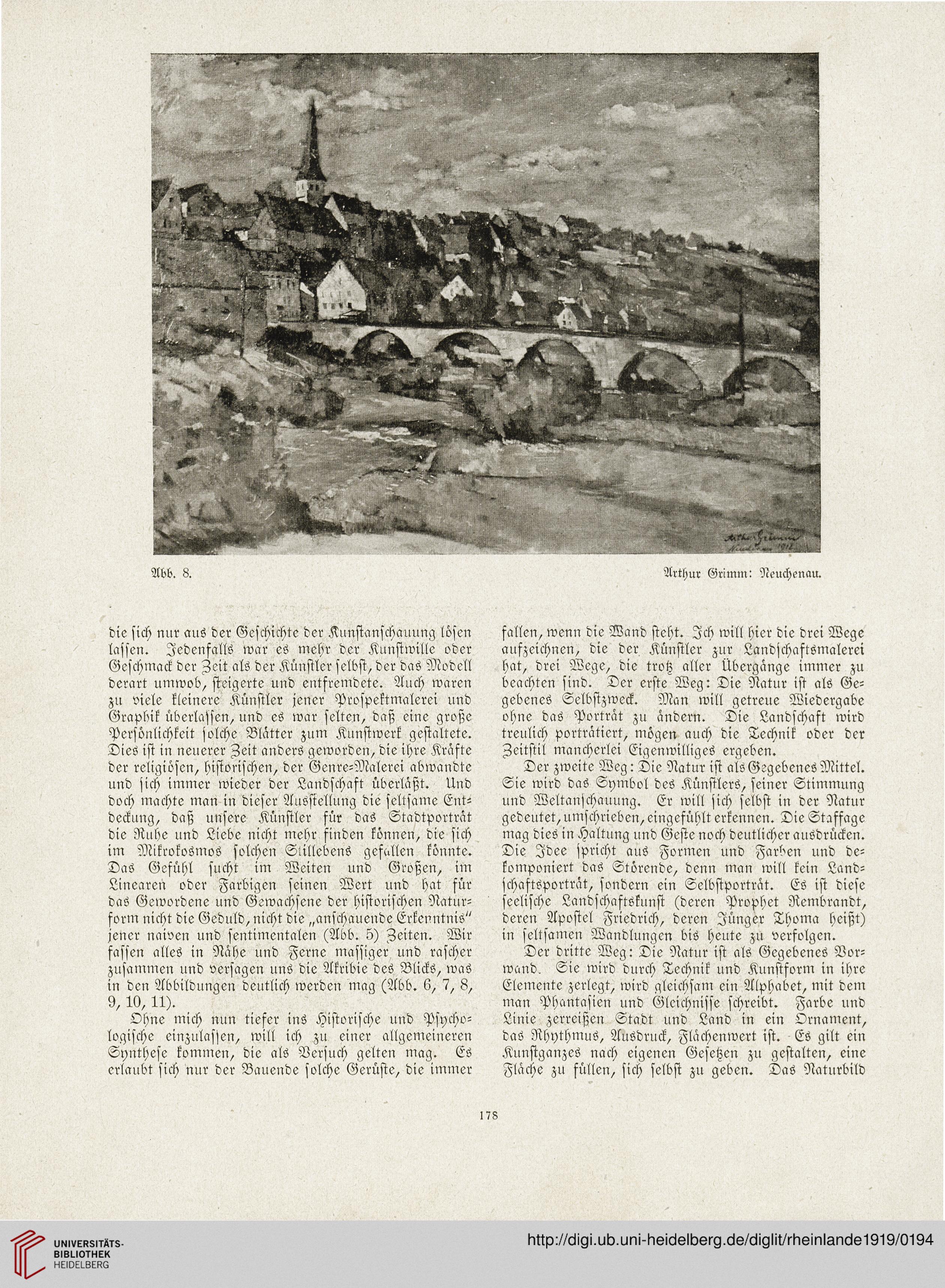Abb. 8.
Arthur Grimm: Neuchenau.
die sich nur aus der Geschichte der Kunstanschauung löscn
lassen. Jedenfalls war es mehr der Kunstwille oder
Geschmack der Aeit als der Künstlcr selbst, der das Modell
derart umwob, steigerte und entfremdete. Auch waren
zu viele kleinere Künstler jener Prospektmalerei und
Grapbik überlassen, und es war selten, daß cine große
Persönlichkeit solche Blatter zum Kunstwerk gestaltete.
Dies ist in neuerer Aeit anders geworden, die ihre Kräfte
der religiöscn, historischen, der Genre-Malerei abwandte
und sich iinmer wieder der Landschaft überlaßt. Und
doch machte man in dieser Ausstellung die scltsanie Ent-
deckung, daß unsere Künstler für das Stadtportrat
die Ruhe und Liebe nicht mehr finden können, die sich
im Mikcokosmos solchen Slillebens gefallen könnte.
Das Gefühl sucht im Weiten und Großen, im
Linearen oder Farbigen seinen Wert und hat für
das Gewordene und Gewachsene der historischen Natur-
form nicht die Geduld, nicht die „anschauende Erkenntnis"
jener naiven und sentimentalen (Abb. 5) Aeiten. Wir
fassen alles in Nahe und Ferne massiger und rascher
zusammen und versagen uns die Akribie des Blicks, was
in den Abbildungen deutlich werden mag (Abb. 6, 7, 8,
9,10,11).
Ohne mich nun tiefer ins Hiftorische und Psycho-
logische einzulassen, will ich zu einer allgemeineren
Synthese kommen, die als Versuch gelten mag. Es
erlaubt sich nur der Bauende solche Gerüste, die immer
fallen, wenn die Wand steht. Jch will hier die drei Wege
aufzeichnen, die der Künstler zur Landschaftsmalerei
hat, drei Wege, die trotz aller Übergänge immer zu
beachten sind. Der erste Weg: Die Natur ist als Ge-
gebenes Selbstzweck. Man will getreue Wiedergabe
ohne das Porträt zu ändern. Die Landschaft wird
treulich porträtiert, mögen auch die Technik oder der
Aeitstil mancherlei Eigenwilliges ergeben.
Der zweite Weg: Die Natur ist als Gsgebenes Mittel.
Sie wird das Symbol des Künstlers, seiner Stimmung
und Weltanschauung. Er will sich selbst in der Natur
gedeutet,umschrieben,eingefühlt erkennen. Die Staffage
mag dies in Haltung und Geste noch deutlicher ausdrücken.
Die Jdee spricht aus Formen und Farben und de-
komponiert das Störende, denn man will kein Land-
schaftsporträt, sondern ein Selbstporträt. Es ist diese
seelische Landschaftskunst (deren Prophet Rembrandt,
deren Apostel Friedrich, deren Jünger Thoma heißt)
in seltsamen Wandlungcn bis heute zu verfolgen.
Der dritte Weg: Die Natur ist als Gegebenes Vor-
wand. Sie wird durch Technik und Kunstform in ihre
Elemente zerlegt, wird gleichsam ein Alphabet, mit dem
man Phantasien und Gleichnisse schreibt. Farbe und
Linie zerreißen Stadt und Land in ein Ornament,
das Rhythmus, Ausdruck, Flächenwert ist. Es gilt ein
Kunstganzes nach eigenen Gesetzen zu gestalten, eine
Fläche zu füllen, sich selbst zu geben. Das Naturbild
>78
Arthur Grimm: Neuchenau.
die sich nur aus der Geschichte der Kunstanschauung löscn
lassen. Jedenfalls war es mehr der Kunstwille oder
Geschmack der Aeit als der Künstlcr selbst, der das Modell
derart umwob, steigerte und entfremdete. Auch waren
zu viele kleinere Künstler jener Prospektmalerei und
Grapbik überlassen, und es war selten, daß cine große
Persönlichkeit solche Blatter zum Kunstwerk gestaltete.
Dies ist in neuerer Aeit anders geworden, die ihre Kräfte
der religiöscn, historischen, der Genre-Malerei abwandte
und sich iinmer wieder der Landschaft überlaßt. Und
doch machte man in dieser Ausstellung die scltsanie Ent-
deckung, daß unsere Künstler für das Stadtportrat
die Ruhe und Liebe nicht mehr finden können, die sich
im Mikcokosmos solchen Slillebens gefallen könnte.
Das Gefühl sucht im Weiten und Großen, im
Linearen oder Farbigen seinen Wert und hat für
das Gewordene und Gewachsene der historischen Natur-
form nicht die Geduld, nicht die „anschauende Erkenntnis"
jener naiven und sentimentalen (Abb. 5) Aeiten. Wir
fassen alles in Nahe und Ferne massiger und rascher
zusammen und versagen uns die Akribie des Blicks, was
in den Abbildungen deutlich werden mag (Abb. 6, 7, 8,
9,10,11).
Ohne mich nun tiefer ins Hiftorische und Psycho-
logische einzulassen, will ich zu einer allgemeineren
Synthese kommen, die als Versuch gelten mag. Es
erlaubt sich nur der Bauende solche Gerüste, die immer
fallen, wenn die Wand steht. Jch will hier die drei Wege
aufzeichnen, die der Künstler zur Landschaftsmalerei
hat, drei Wege, die trotz aller Übergänge immer zu
beachten sind. Der erste Weg: Die Natur ist als Ge-
gebenes Selbstzweck. Man will getreue Wiedergabe
ohne das Porträt zu ändern. Die Landschaft wird
treulich porträtiert, mögen auch die Technik oder der
Aeitstil mancherlei Eigenwilliges ergeben.
Der zweite Weg: Die Natur ist als Gsgebenes Mittel.
Sie wird das Symbol des Künstlers, seiner Stimmung
und Weltanschauung. Er will sich selbst in der Natur
gedeutet,umschrieben,eingefühlt erkennen. Die Staffage
mag dies in Haltung und Geste noch deutlicher ausdrücken.
Die Jdee spricht aus Formen und Farben und de-
komponiert das Störende, denn man will kein Land-
schaftsporträt, sondern ein Selbstporträt. Es ist diese
seelische Landschaftskunst (deren Prophet Rembrandt,
deren Apostel Friedrich, deren Jünger Thoma heißt)
in seltsamen Wandlungcn bis heute zu verfolgen.
Der dritte Weg: Die Natur ist als Gegebenes Vor-
wand. Sie wird durch Technik und Kunstform in ihre
Elemente zerlegt, wird gleichsam ein Alphabet, mit dem
man Phantasien und Gleichnisse schreibt. Farbe und
Linie zerreißen Stadt und Land in ein Ornament,
das Rhythmus, Ausdruck, Flächenwert ist. Es gilt ein
Kunstganzes nach eigenen Gesetzen zu gestalten, eine
Fläche zu füllen, sich selbst zu geben. Das Naturbild
>78