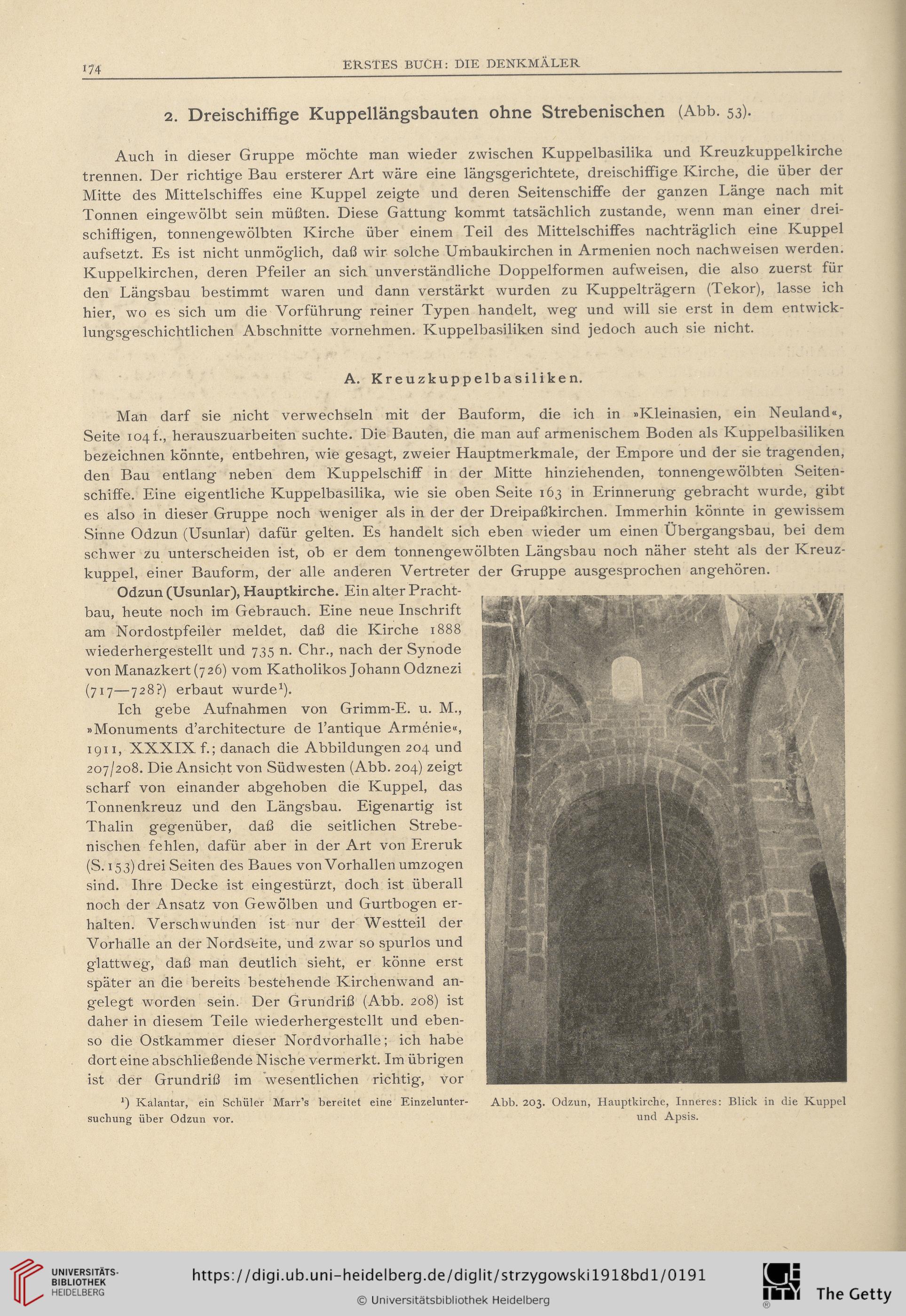174
ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER
2. Dreischiffige Kuppellängsbauten ohne Strebenischen (Abb. 53).
Auch in dieser Gruppe möchte man wieder zwischen Kuppelbasilika und Kreuzkuppelkirche
trennen. Der richtige Bau ersterer Art wäre eine längsgerichtete, dreischiffige Kirche, die über der
Mitte des Mittelschiffes eine Kuppel zeigte und deren Seitenschiffe der ganzen Länge nach mit
Tonnen eingewölbt sein müßten. Diese Gattung kommt tatsächlich zustande, wenn man einer drei-
schiffigen, tonnengewölbten Kirche über einem Teil des Mittelschiffes nachträglich eine Kuppel
aufsetzt. Es ist nicht unmöglich, daß wir solche Umbaukirchen in Armenien noch nachweisen werden.
Kuppelkirchen, deren Pfeiler an sich unverständliche Doppelformen aufweisen, die also zuerst für
den Längsbau bestimmt waren und dann verstärkt wurden zu Kuppelträgern (Tekor), lasse ich
hier, wo es sich um die Vorführung reiner Typen handelt, weg und will sie erst in dem entwick-
lungsgeschichtlichen Abschnitte vornehmen. Kuppelbasiliken sind jedoch auch sie nicht.
A. Kreuzkuppelbasiliken.
Man darf sie nicht verwechseln mit der Bauform, die ich in »Kleinasien, em Neuland«,
Seite 104 f., herauszuarbeiten suchte. Die Bauten, die man auf armenischem Boden als Kuppelbasiliken
bezeichnen könnte, entbehren, wie gesagt, zweier Hauptmerkmale, der Empore und der sie tragenden,
den Bau entlang neben dem Kuppelschiff in der Mitte hinziehenden, tonnengewölbten Seiten-
schiffe. Eine eigentliche Kuppelbasilika, wie sie oben Seite 163 in Erinnerung gebracht wurde, gibt
es also in dieser Gruppe noch weniger als in der der Dreipaßkirchen. Immerhin könnte in gewissem
Sinne Odzun (Usunlar) dafür gelten. Es handelt sich eben wieder um einen Übergangsbau, bei dem
schwer zu unterscheiden ist, ob er dem tonnengewölbten Längsbau noch näher steht als der Kreuz-
kuppel, einer Bauform, der alle anderen Vertreter
Odzun (Usunlar), Hauptkirche. Ein alter Pracht-
bau, heute noch im Gebrauch. Eine neue Inschrift
am Nordostpfeiler meldet, daß die Kirche 1888
wiederhergestellt und 735 n. Chr., nach der Synode
von Manazkert (726) vom Katholikos Johann Odznezi
(717—728?) erbaut wurde1).
Ich gebe Aufnahmen von Grimm-E. u. M.,
»Monuments d’architecture de l’antique Armenie«,
1911, XXXIX f.; danach die Abbildungen 204 und
207/208. Die Ansicht von Südwesten (Abb. 204) zeigt
scharf von einander abgehoben die Kuppel, das
Tonnenkreuz und den Längsbau. Eigenartig ist
Thalin gegenüber, daß die seitlichen Strebe-
nischen fehlen, dafür aber in der Art von Ereruk
(S. 15 3) drei Seiten des Baues von Vorhallen umzogen
sind. Ihre Decke ist eingestürzt, doch ist überall
noch der Ansatz von Gewölben und Gurtbogen er-
halten. Verschwunden ist nur der Westteil der
Vorhalle an der Nordseite, und zwar so spurlos und
glattweg, daß man deutlich sieht, er könne erst
später an die bereits bestehende Kirchenwand an-
gelegt worden sein. Der Grundriß (Abb. 208) ist
daher in diesem Teile wiederhergestellt und eben-
so die Ostkammer dieser Nordvorhalle; ich habe
dort eine abschließende Nische vermerkt. Im übrigen
ist der Grundriß im wesentlichen richtig, vor
der Gruppe ausgesprochen angehören.
J) Kalantar, ein Schüler Marr’s bereitet eine Einzelunter-
suchung über Odzun vor.
Abb. 203. Odzun, Hauptkirche, Inneres: Blick in die Kuppel
und Apsis.
ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER
2. Dreischiffige Kuppellängsbauten ohne Strebenischen (Abb. 53).
Auch in dieser Gruppe möchte man wieder zwischen Kuppelbasilika und Kreuzkuppelkirche
trennen. Der richtige Bau ersterer Art wäre eine längsgerichtete, dreischiffige Kirche, die über der
Mitte des Mittelschiffes eine Kuppel zeigte und deren Seitenschiffe der ganzen Länge nach mit
Tonnen eingewölbt sein müßten. Diese Gattung kommt tatsächlich zustande, wenn man einer drei-
schiffigen, tonnengewölbten Kirche über einem Teil des Mittelschiffes nachträglich eine Kuppel
aufsetzt. Es ist nicht unmöglich, daß wir solche Umbaukirchen in Armenien noch nachweisen werden.
Kuppelkirchen, deren Pfeiler an sich unverständliche Doppelformen aufweisen, die also zuerst für
den Längsbau bestimmt waren und dann verstärkt wurden zu Kuppelträgern (Tekor), lasse ich
hier, wo es sich um die Vorführung reiner Typen handelt, weg und will sie erst in dem entwick-
lungsgeschichtlichen Abschnitte vornehmen. Kuppelbasiliken sind jedoch auch sie nicht.
A. Kreuzkuppelbasiliken.
Man darf sie nicht verwechseln mit der Bauform, die ich in »Kleinasien, em Neuland«,
Seite 104 f., herauszuarbeiten suchte. Die Bauten, die man auf armenischem Boden als Kuppelbasiliken
bezeichnen könnte, entbehren, wie gesagt, zweier Hauptmerkmale, der Empore und der sie tragenden,
den Bau entlang neben dem Kuppelschiff in der Mitte hinziehenden, tonnengewölbten Seiten-
schiffe. Eine eigentliche Kuppelbasilika, wie sie oben Seite 163 in Erinnerung gebracht wurde, gibt
es also in dieser Gruppe noch weniger als in der der Dreipaßkirchen. Immerhin könnte in gewissem
Sinne Odzun (Usunlar) dafür gelten. Es handelt sich eben wieder um einen Übergangsbau, bei dem
schwer zu unterscheiden ist, ob er dem tonnengewölbten Längsbau noch näher steht als der Kreuz-
kuppel, einer Bauform, der alle anderen Vertreter
Odzun (Usunlar), Hauptkirche. Ein alter Pracht-
bau, heute noch im Gebrauch. Eine neue Inschrift
am Nordostpfeiler meldet, daß die Kirche 1888
wiederhergestellt und 735 n. Chr., nach der Synode
von Manazkert (726) vom Katholikos Johann Odznezi
(717—728?) erbaut wurde1).
Ich gebe Aufnahmen von Grimm-E. u. M.,
»Monuments d’architecture de l’antique Armenie«,
1911, XXXIX f.; danach die Abbildungen 204 und
207/208. Die Ansicht von Südwesten (Abb. 204) zeigt
scharf von einander abgehoben die Kuppel, das
Tonnenkreuz und den Längsbau. Eigenartig ist
Thalin gegenüber, daß die seitlichen Strebe-
nischen fehlen, dafür aber in der Art von Ereruk
(S. 15 3) drei Seiten des Baues von Vorhallen umzogen
sind. Ihre Decke ist eingestürzt, doch ist überall
noch der Ansatz von Gewölben und Gurtbogen er-
halten. Verschwunden ist nur der Westteil der
Vorhalle an der Nordseite, und zwar so spurlos und
glattweg, daß man deutlich sieht, er könne erst
später an die bereits bestehende Kirchenwand an-
gelegt worden sein. Der Grundriß (Abb. 208) ist
daher in diesem Teile wiederhergestellt und eben-
so die Ostkammer dieser Nordvorhalle; ich habe
dort eine abschließende Nische vermerkt. Im übrigen
ist der Grundriß im wesentlichen richtig, vor
der Gruppe ausgesprochen angehören.
J) Kalantar, ein Schüler Marr’s bereitet eine Einzelunter-
suchung über Odzun vor.
Abb. 203. Odzun, Hauptkirche, Inneres: Blick in die Kuppel
und Apsis.