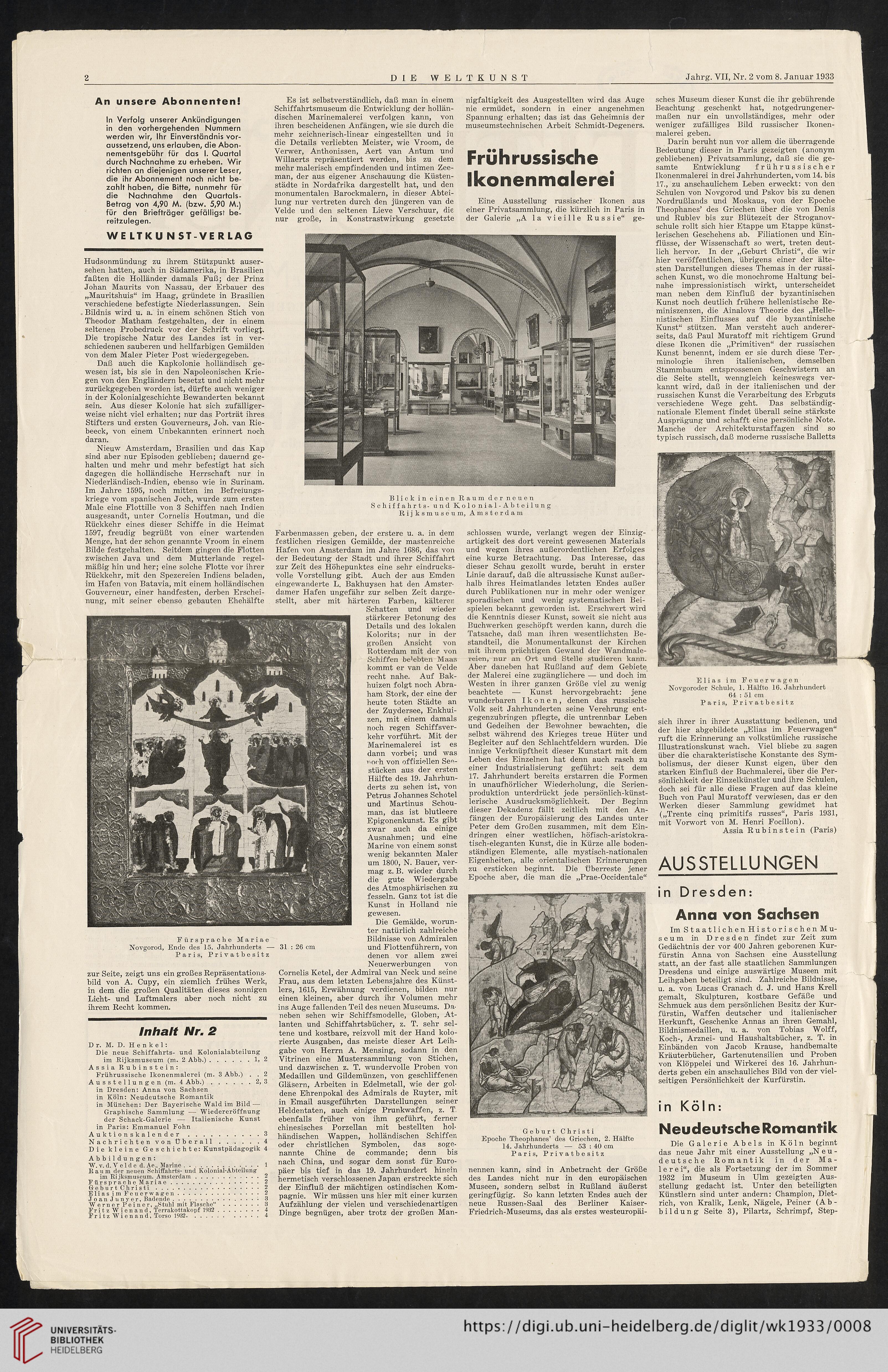2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 2 vom 8. Januar 1933
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigungen
in den vorhergehenden Nummern
werden wir, Ihr Einverständnis vor-
aussetzend, uns erlauben, die Abon-
nementsgebühr für das I. Quartal
durch Nachnahme zu erheben. Wir
richten an diejenigen unserer leser,
die ihr Abonnement noch nicht be-
zahlt haben, die Bitte, nunmehr für
die Nachnahme den Quartals-
Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)
für den Briefträger gefälligst be-
reitzulegen.
Es ist selbstverständlich, daß man in einem
Schiffahrtsmuseum die Entwicklung der hollän-
dischen Marinemalerei verfolgen kann, von
ihren bescheidenen Anfängen, wie sie durch die
mehr zeichnerisch-linear eingestellten und in
die Details verliebten Meister, wie Vroom, de
Verwer, Anthonissen, Aert van Antum und
Willaerts repräsentiert werden, bis zu dem
mehr malerisch empfindenden und intimen Zee-
man, der aus eigener Anschauung die Küsten-
städte in Nordafrika dargestellt hat, und den
monumentalen Barockmalern, in dieser Abtei-
lung nur vertreten durch den jüngeren van de
Velde und den seltenen Lieve Verschuur, die
nur große, in Konstrastwirkung gesetzte
nigfaltigkeit des Ausgestellten wird das Auge
nie ermüdet, sondern in einer angenehmen
Spannung erhalten; das ist das Geheimnis der
museumstechnischen Arbeit Schmidt-Degeners.
Früh russische
Ikonenmalerei
Eine Ausstellung russischer Ikonen aus
einer Privatsammlung, die kürzlich in Paris in
der Galerie „A la vieille Russie“ ge-
WE LTKU N ST-VE RLAG
Hudsonmündung zu ihrem Stützpunkt auser-
sehen hatten, auch in Südamerika, in Brasilien
faßten die Holländer damals Fuß; der Prinz
Johan Maurits von Nassau, der Erbauer des
„Mauritshuis“ im Haag, gründete in Brasilien
verschiedene befestigte Niederlassungen. Sein
Bildnis wird u. a. in einem schönen Stich von
Theodor Matham festgehalten, der in einem
seltenen Probedruck vor der Schrift vorliegt.
Die tropische Natur des Landes ist in ver-
schiedenen sauberen und hellfarbigen Gemälden
von dem Maiei- Pieter Post wiedergegeben.
Daß auch die Kapkolonie holländisch ge-
wesen ist, bis sie in den Napoleonischen Krie-
gen von den Engländern besetzt und nicht mehr
zurückgegeben worden ist, dürfte auch weniger
in der Kolonialgeschichte Bewanderten bekannt
sein. Aus dieser Kolonie hat sich zufälliger-
weise nicht viel erhalten; nur das Porträt ihres
Stifters und ersten Gouverneurs, Joh. van Rie-
beeck, von einem Unbekannten erinnert noch
daran.
Nieuw Amsterdam, Brasilien und das Kap
sind aber nur Episoden geblieben; dauernd ge-
halten und mehr und mehr befestigt hat sich
dagegen die holländische Herrschaft nur in
Niederländisch-Indien, ebenso wie in Surinam.
Im Jahre 1595, noch mitten im Befreiungs-
kriege vom spanischen Joch, wurde zum ersten
Male eine Flottille von 3 Schiffen nach Indien
ausgesandt, unter Cornelis Houtman, und die
Rückkehr eines dieser Schiffe in die Heimat
Blick in einen Raum der neuen
Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung
Rijksmuseum, Amsterdam
1597, freudig begrüßt von einer wartenden
Menge, hat der schon genannte Vroom in einem
Bilde festgehalten. Seitdem gingen die Flotten
zwischen Java und dem Mutterlande regel-
mäßig hin und her; eine solche Flotte vor ihrer
Rückkehr, mit den Spezereien Indiens beladen,
im Hafen von Batavia, mit einem holländischen
Gouverneur, einer handfesten, derben Erschei-
nung, mit seiner ebenso gebauten Ehehälfte
Farbenmassen geben, der erstere u. a. in dem
festlichen riesigen Gemälde, der mastenreiche
Hafen von Amsterdam im Jahre 1686, das von
der Bedeutung der Stadt und ihrer Schiffahrt
zur Zeit des Höhepunktes eine sehr eindrucks-
volle Vorstellung gibt. Auch der aus Emden
eingewanderte L. Bakhuysen hat den Amster-
damer Hafen ungefähr zur selben Zeit darge-
stellt, aber mit härteren Farben, kälteren
Schatten und wieder
stärkerer Betonung des
Details und des lokalen
Kolorits; nur in der
großen Ansicht von
Rotterdam mit der von
Schiffen belebten Maas
kommt er van de Velde
recht nahe. Auf Bak-
huizen folgt noch Abra-
ham Stork, der eine der
heute toten Städte an
der Zuydersee, Enkhui-
zen, mit einem damals
noch regen Schiffsver-
kehr vorführt. Mit der
Marinemalerei ist es
dann vorbei; und was
noch von offiziellen See-
stücken aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu sehen ist, von
Petrus Johannes Schotel
und Martinus Schou-
man, das ist blutleere
Epigonenkunst. Es gibt
zwar auch da einige
Ausnahmen; und eine
Marine von einem sonst
wenig bekannten Maler
um 1800, N. Bauer, ver-
mag z. B. wieder durch
die gute Wiedergabe
des Atmosphärischen zu
fesseln. Ganz tot ist die
Kunst in Holland nie
gewesen.
Die Gemälde, worun-
ter natürlich zahlreiche
Fürsprache Mariae
Novgorod, Ende des 15. Jahrhunderts -
Paris, Privatbesitz
zur Seite, zeigt uns ein großes Repräsentations-
bild von A. Cupy, ein ziemlich frühes Werk,
in dem die großen Qualitäten dieses sonnigen
Licht- und Luftmalers aber noch nicht zu
ihrem Recht kommen.
Inhalt Nr. 2
D r. M. D. Henkel:
Die neue Schiffahrts- und Kolonialabteilung
im Rijksmuseum (m. 2 Abb.).1, 2
Assia Rubinstein:
Frührussische Ikonenmalerei (m. 3 Abb.) . . 2
Ausstellungen (m. 4 Abb.).2, 3
in Dresden: Anna von Sachsen
in Köln: Neudeutsche Romantik
in München: Der Bayerische Wald im Bild —
Graphische Sammlung — Wiedereröffnung
der Schack-Galerie — Italienische Kunst
in Paris: Emmanuel Föhn
Auktionskalender.3
Nachrichten von Überall.4
Die kleine Geschichte: Kunstpädagogik 4
Abbildungen:
W. v. d. V e 1 d e d. Ae., Marine.1
Raum der neuen Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung
im Rijksmuseum. Amsterdam.2
Fürsprache Mariae.2
GeburtChristi.2
Elias im Fe u er wagen.2
JoanJunyer, Badende. 3
W e rn e r P e i n er, „Stuhl mit Flasche“ .3
Fritz. Wienand, Terrakottakopf 1932 .4
Fritz Wienand, Torso 1932 .4
Bildnisse von Admiralen
31 : 26 cm und Flottenführern, von
denen vor allem zwei
Neuerwerbungen von
Cornelis Ketel, der Admiral van Neck und seine
Frau, aus dem letzten Lebensjahre des Künst-
lers, 1615, Erwähnung verdienen, bilden nur
einen kleinen, aber durch ihr Volumen mehr
ins Auge fallenden Teil des neuen Museums. Da-
neben sehen wir Schiffsmodelle, Globen, At-
lanten und Schiffahrtsbücher, z. T. sehr sel-
tene und kostbare, reizvoll mit der Hand kolo-
rierte Ausgaben, das meiste dieser Art Leih-
gabe von Herrn A. Mensing, sodann in den
Vitrinen eine Mustersammlung von Stichen,
und dazwischen z. T. wundervolle Proben von
Medaillen und Gildemünzen, von geschliffenen
Gläsern, Arbeiten in Edelmetall, wie der gol-
dene Ehrenpokal des Admirals de Ruyter, mit
in Email ausgeführten Darstellungen seiner
Heldentaten, auch einige Prunkwaffen, z. T
ebenfalls früher von ihm geführt, ferner
chinesisches Porzellan mit bestellten hol-
händischen Wappen, holländischen Schiffen
oder christlichen Symbolen, das soge-
nannte Chine de commande; denn bis
nach China, und sogar dem sonst für Euro-
päer bis tief in das 19. Jahrhundert hinein
hermetisch verschlossenen Japan erstreckte sich
der Einfluß der mächtigen ostindischen Kom-
pagnie. Wir müssen uns hier mit einer kurzen
Aufzählung der vielen und verschiedenartigen
Dinge begnügen, aber trotz der großen Man-
schlossen wurde, verlangt wegen der Einzig-
artigkeit des dort vereint gewesenen Materials
und wegen ihres außerordentlichen Erfolges
eine kurze Betrachtung. Das Interesse, das
dieser Schau gezollt wurde, beruht in erster
Linie darauf, daß die altrussische Kunst außer-
halb ihres Heimatlandes letzten Endes außer
durch Publikationen nur in mehr oder weniger
sporadischen und wenig systematischen Bei-
spielen bekannt geworden ist. Erschwert wird
die Kenntnis dieser Kunst, soweit sie nicht aus
Buchwerken geschöpft werden kann, durch die
Tatsache, daß man ihren wesentlichsten Be-
standteil, die Monumentalkunst der Kirchen
mit ihrem prächtigen Gewand der Wandmale-
reien, nur an Ort und Stelle studieren kann.
Aber daneben hat Rußland auf dem Gebiete
der Malerei eine zugänglichere — und doch im
Westen in ihrer ganzen Größe viel zu wenig
beachtete — Kunst hervorgebracht: jene
wunderbaren Ikonen, denen das russische
Volk seit Jahrhunderten seine Verehrung ent-
gegenzubringen pflegte, die untrennbar Leben
und Gedeihen der Bewohner bewachten, die
selbst während des Krieges treue Hüter und
Begleiter auf den Schlachtfeldern wurden. Die
innige Verknüpftheit dieser Kunstart mit dem
Leben des Einzelnen hat denn auch rasch zu
einer Industrialisierung geführt: seit dem
17. Jahrhundert bereits erstarren die Formen
in unaufhörlicher Wiederholung, die Serien-
produktion unterdrückt jede persönlich-künst-
lerische Ausdrucksmöglichkeit. Der Beginn
dieser Dekadenz fällt zeitlich mit den An-
fängen der Europäisierung des Landes unter
Peter dem Großen zusammen, mit dem Ein-
dringen einer westlichen, höfisch-aristokra-
tisch-eleganten Kunst, die in Kürze alle boden-
ständigen Elemente, alle mystisch-nationalen
Eigenheiten, alle orientalischen Erinnerungen
zu ersticken beginnt. Die Überreste jener
Epoche aber, die man die „Prae-Occidentale“
Geburt Christi
Epoche Theophanes’ des Griechen, 2. Hälfte
14. Jahrhunderts •— 53 : 40 cm
Paris, Privatbesitz
nennen kann, sind in Anbetracht der Größe
des Landes nicht nur in den europäischen
Museen, sondern selbst in Rußland äußerst
geringfügig. So kann letzten Endes auch der
neue Russen-Saal des Berliner Kaiser-
Friedrich-Museums, das als erstes westeuropäi-
sches Museum dieser Kunst die ihr gebührende
Beachtung geschenkt hat, notgedrungener-
maßen nur ein unvollständiges, mehr oder
weniger zufälliges Bild russischer Ikonen-
malerei geben.
Darin beruht nun vor allem die überragende
Bedeutung dieser in Paris gezeigten (anonym
gebliebenen) Privatsammlung, daß sie die ge-
samte Entwicklung frührussischer
Ikonenmalerei in drei Jahrhunderten, vom 14. bis
17., zu anschaulichem Leben erweckt: von den
Schulen von Novgorod und Pskov bis zu denen
Nordrußlands und Moskaus, von der Epoche
Theophanes’ des Griechen über die von Denis
und Rublev bis zur Blütezeit der Stroganov-
schule rollt sich hier Etappe um Etappe künst-
lerischen Geschehens ab. Filiationen und Ein-
flüsse, der Wissenschaft so wert, treten deut-
lich hervor. In der „Geburt Christi“, die wir
hier veröffentlichen, übrigens einer der älte-
sten Darstellungen dieses Themas in der russi-
schen Kunst, wo die monochrome Haltung bei-
nahe impressionistisch wirkt, unterscheidet
man neben dem Einfluß der byzantinischen
Kunst noch deutlich frühere hellenistische Re-
miniszenzen, die Ainalovs Theorie des „Helle-
nistischen Einflusses auf die byzantinische
Kunst“ stützen. Man versteht auch anderer-
seits, daß Paul Muratoff mit richtigem Grund
diese Ikonen die „Primitiven“ der russischen
Kunst benennt, indem er sie durch diese Ter-
minologie ihren italienischen, demselben
Stammbaum entsprossenen Geschwistern an
die Seite stellt, wenngleich keineswegs ver-
kannt wird, daß in der italienischen und der
russischen Kunst die Verarbeitung des Erbguts
verschiedene Wege geht. Das selbständig-
nationale Element findet überall seine stärkste
Ausprägung und schafft eine persönliche Note.
Manche der Architekturstaffagen sind so
typisch russisch, daß moderne russische Balletts
Elias im Feuerwagen
Novgoroder Schule, 1. Hälfte 16. Jahrhundert
64 : 51 cm
Paris, Privatbesitz
sich ihrer in ihrer Ausstattung bedienen, und
der hier abgebildete „Elias im Feuerwagen“
ruft die Erinnerung an volkstümliche russische
Illustrationskunst wach. Viel bliebe zu sagen
über die charakteristische Konstante des Sym-
bolismus, der dieser Kunst eigen, über den
starken Einfluß der Buchmalerei, über die Per-
sönlichkeit der Einzelkünstler und ihre Schulen,
doch sei für alle diese Fragen auf das kleine
Buch von Paul Muratoff verwiesen, das er den
Werken dieser Sammlung gewidmet hat
(„Trente cinq primitifs russes“, Paris 1931,
mit Vorwort von M. Henri Focillon).
Assia Rubinstein (Paris)
AUSSTELLUNGEN
in Dresden:
Anna von Sachsen
Im Staatlichen Historischen Mu-
seum in Dresden findet zur Zeit zum
Gedächtnis der vor 400 Jahren geborenen Kur-
fürstin Anna von Sachsen eine Ausstellung
statt, an der fast alle staatlichen Sammlungen
Dresdens und einige auswärtige Museen mit
Leihgaben beteiligt sind. Zahlreiche Bildnisse,
u. a. von Lucas Cranach d. J. und Hans Krell
gemalt, Skulpturen, kostbare Gefäße und
Schmuck aus dem persönlichen Besitz der Kur-
fürstin, Waffen deutscher und italienischer
Herkunft, Geschenke Annas an ihren Gemahl,
Bildnismedaillen, u. a. von Tobias Wolff,
Koch-, Arznei- und Haushaltsbücher, z. T. in
Einbänden von Jacob Krause, handbemalte
Kräuterbücher, Gartenutensilien und Proben
von Klöppelei und Wirkerei des 16. Jahrhun-
derts geben ein anschauliches Bild von der viel-
seitigen Persönlichkeit der Kurfürstin.
in Köln:
Neudeutsche Romantik
Die Galerie Abels in Köln beginnt
das neue Jahr mit einer Ausstellung „Neu-
deutsche Romantik in der Ma-
lere i“, die als Fortsetzung der im Sommer
1932 im Museum in Ulm gezeigten Aus-
stellung gedacht ist. Unter den beteiligten
Künstlern sind unter andern: Champion, Diet-
rich, von Kralik, Lenk, Nägele, Peiner (Ab-
bildung Seite 3), Pilartz, Schrimpf, Step-
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 2 vom 8. Januar 1933
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigungen
in den vorhergehenden Nummern
werden wir, Ihr Einverständnis vor-
aussetzend, uns erlauben, die Abon-
nementsgebühr für das I. Quartal
durch Nachnahme zu erheben. Wir
richten an diejenigen unserer leser,
die ihr Abonnement noch nicht be-
zahlt haben, die Bitte, nunmehr für
die Nachnahme den Quartals-
Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)
für den Briefträger gefälligst be-
reitzulegen.
Es ist selbstverständlich, daß man in einem
Schiffahrtsmuseum die Entwicklung der hollän-
dischen Marinemalerei verfolgen kann, von
ihren bescheidenen Anfängen, wie sie durch die
mehr zeichnerisch-linear eingestellten und in
die Details verliebten Meister, wie Vroom, de
Verwer, Anthonissen, Aert van Antum und
Willaerts repräsentiert werden, bis zu dem
mehr malerisch empfindenden und intimen Zee-
man, der aus eigener Anschauung die Küsten-
städte in Nordafrika dargestellt hat, und den
monumentalen Barockmalern, in dieser Abtei-
lung nur vertreten durch den jüngeren van de
Velde und den seltenen Lieve Verschuur, die
nur große, in Konstrastwirkung gesetzte
nigfaltigkeit des Ausgestellten wird das Auge
nie ermüdet, sondern in einer angenehmen
Spannung erhalten; das ist das Geheimnis der
museumstechnischen Arbeit Schmidt-Degeners.
Früh russische
Ikonenmalerei
Eine Ausstellung russischer Ikonen aus
einer Privatsammlung, die kürzlich in Paris in
der Galerie „A la vieille Russie“ ge-
WE LTKU N ST-VE RLAG
Hudsonmündung zu ihrem Stützpunkt auser-
sehen hatten, auch in Südamerika, in Brasilien
faßten die Holländer damals Fuß; der Prinz
Johan Maurits von Nassau, der Erbauer des
„Mauritshuis“ im Haag, gründete in Brasilien
verschiedene befestigte Niederlassungen. Sein
Bildnis wird u. a. in einem schönen Stich von
Theodor Matham festgehalten, der in einem
seltenen Probedruck vor der Schrift vorliegt.
Die tropische Natur des Landes ist in ver-
schiedenen sauberen und hellfarbigen Gemälden
von dem Maiei- Pieter Post wiedergegeben.
Daß auch die Kapkolonie holländisch ge-
wesen ist, bis sie in den Napoleonischen Krie-
gen von den Engländern besetzt und nicht mehr
zurückgegeben worden ist, dürfte auch weniger
in der Kolonialgeschichte Bewanderten bekannt
sein. Aus dieser Kolonie hat sich zufälliger-
weise nicht viel erhalten; nur das Porträt ihres
Stifters und ersten Gouverneurs, Joh. van Rie-
beeck, von einem Unbekannten erinnert noch
daran.
Nieuw Amsterdam, Brasilien und das Kap
sind aber nur Episoden geblieben; dauernd ge-
halten und mehr und mehr befestigt hat sich
dagegen die holländische Herrschaft nur in
Niederländisch-Indien, ebenso wie in Surinam.
Im Jahre 1595, noch mitten im Befreiungs-
kriege vom spanischen Joch, wurde zum ersten
Male eine Flottille von 3 Schiffen nach Indien
ausgesandt, unter Cornelis Houtman, und die
Rückkehr eines dieser Schiffe in die Heimat
Blick in einen Raum der neuen
Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung
Rijksmuseum, Amsterdam
1597, freudig begrüßt von einer wartenden
Menge, hat der schon genannte Vroom in einem
Bilde festgehalten. Seitdem gingen die Flotten
zwischen Java und dem Mutterlande regel-
mäßig hin und her; eine solche Flotte vor ihrer
Rückkehr, mit den Spezereien Indiens beladen,
im Hafen von Batavia, mit einem holländischen
Gouverneur, einer handfesten, derben Erschei-
nung, mit seiner ebenso gebauten Ehehälfte
Farbenmassen geben, der erstere u. a. in dem
festlichen riesigen Gemälde, der mastenreiche
Hafen von Amsterdam im Jahre 1686, das von
der Bedeutung der Stadt und ihrer Schiffahrt
zur Zeit des Höhepunktes eine sehr eindrucks-
volle Vorstellung gibt. Auch der aus Emden
eingewanderte L. Bakhuysen hat den Amster-
damer Hafen ungefähr zur selben Zeit darge-
stellt, aber mit härteren Farben, kälteren
Schatten und wieder
stärkerer Betonung des
Details und des lokalen
Kolorits; nur in der
großen Ansicht von
Rotterdam mit der von
Schiffen belebten Maas
kommt er van de Velde
recht nahe. Auf Bak-
huizen folgt noch Abra-
ham Stork, der eine der
heute toten Städte an
der Zuydersee, Enkhui-
zen, mit einem damals
noch regen Schiffsver-
kehr vorführt. Mit der
Marinemalerei ist es
dann vorbei; und was
noch von offiziellen See-
stücken aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu sehen ist, von
Petrus Johannes Schotel
und Martinus Schou-
man, das ist blutleere
Epigonenkunst. Es gibt
zwar auch da einige
Ausnahmen; und eine
Marine von einem sonst
wenig bekannten Maler
um 1800, N. Bauer, ver-
mag z. B. wieder durch
die gute Wiedergabe
des Atmosphärischen zu
fesseln. Ganz tot ist die
Kunst in Holland nie
gewesen.
Die Gemälde, worun-
ter natürlich zahlreiche
Fürsprache Mariae
Novgorod, Ende des 15. Jahrhunderts -
Paris, Privatbesitz
zur Seite, zeigt uns ein großes Repräsentations-
bild von A. Cupy, ein ziemlich frühes Werk,
in dem die großen Qualitäten dieses sonnigen
Licht- und Luftmalers aber noch nicht zu
ihrem Recht kommen.
Inhalt Nr. 2
D r. M. D. Henkel:
Die neue Schiffahrts- und Kolonialabteilung
im Rijksmuseum (m. 2 Abb.).1, 2
Assia Rubinstein:
Frührussische Ikonenmalerei (m. 3 Abb.) . . 2
Ausstellungen (m. 4 Abb.).2, 3
in Dresden: Anna von Sachsen
in Köln: Neudeutsche Romantik
in München: Der Bayerische Wald im Bild —
Graphische Sammlung — Wiedereröffnung
der Schack-Galerie — Italienische Kunst
in Paris: Emmanuel Föhn
Auktionskalender.3
Nachrichten von Überall.4
Die kleine Geschichte: Kunstpädagogik 4
Abbildungen:
W. v. d. V e 1 d e d. Ae., Marine.1
Raum der neuen Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung
im Rijksmuseum. Amsterdam.2
Fürsprache Mariae.2
GeburtChristi.2
Elias im Fe u er wagen.2
JoanJunyer, Badende. 3
W e rn e r P e i n er, „Stuhl mit Flasche“ .3
Fritz. Wienand, Terrakottakopf 1932 .4
Fritz Wienand, Torso 1932 .4
Bildnisse von Admiralen
31 : 26 cm und Flottenführern, von
denen vor allem zwei
Neuerwerbungen von
Cornelis Ketel, der Admiral van Neck und seine
Frau, aus dem letzten Lebensjahre des Künst-
lers, 1615, Erwähnung verdienen, bilden nur
einen kleinen, aber durch ihr Volumen mehr
ins Auge fallenden Teil des neuen Museums. Da-
neben sehen wir Schiffsmodelle, Globen, At-
lanten und Schiffahrtsbücher, z. T. sehr sel-
tene und kostbare, reizvoll mit der Hand kolo-
rierte Ausgaben, das meiste dieser Art Leih-
gabe von Herrn A. Mensing, sodann in den
Vitrinen eine Mustersammlung von Stichen,
und dazwischen z. T. wundervolle Proben von
Medaillen und Gildemünzen, von geschliffenen
Gläsern, Arbeiten in Edelmetall, wie der gol-
dene Ehrenpokal des Admirals de Ruyter, mit
in Email ausgeführten Darstellungen seiner
Heldentaten, auch einige Prunkwaffen, z. T
ebenfalls früher von ihm geführt, ferner
chinesisches Porzellan mit bestellten hol-
händischen Wappen, holländischen Schiffen
oder christlichen Symbolen, das soge-
nannte Chine de commande; denn bis
nach China, und sogar dem sonst für Euro-
päer bis tief in das 19. Jahrhundert hinein
hermetisch verschlossenen Japan erstreckte sich
der Einfluß der mächtigen ostindischen Kom-
pagnie. Wir müssen uns hier mit einer kurzen
Aufzählung der vielen und verschiedenartigen
Dinge begnügen, aber trotz der großen Man-
schlossen wurde, verlangt wegen der Einzig-
artigkeit des dort vereint gewesenen Materials
und wegen ihres außerordentlichen Erfolges
eine kurze Betrachtung. Das Interesse, das
dieser Schau gezollt wurde, beruht in erster
Linie darauf, daß die altrussische Kunst außer-
halb ihres Heimatlandes letzten Endes außer
durch Publikationen nur in mehr oder weniger
sporadischen und wenig systematischen Bei-
spielen bekannt geworden ist. Erschwert wird
die Kenntnis dieser Kunst, soweit sie nicht aus
Buchwerken geschöpft werden kann, durch die
Tatsache, daß man ihren wesentlichsten Be-
standteil, die Monumentalkunst der Kirchen
mit ihrem prächtigen Gewand der Wandmale-
reien, nur an Ort und Stelle studieren kann.
Aber daneben hat Rußland auf dem Gebiete
der Malerei eine zugänglichere — und doch im
Westen in ihrer ganzen Größe viel zu wenig
beachtete — Kunst hervorgebracht: jene
wunderbaren Ikonen, denen das russische
Volk seit Jahrhunderten seine Verehrung ent-
gegenzubringen pflegte, die untrennbar Leben
und Gedeihen der Bewohner bewachten, die
selbst während des Krieges treue Hüter und
Begleiter auf den Schlachtfeldern wurden. Die
innige Verknüpftheit dieser Kunstart mit dem
Leben des Einzelnen hat denn auch rasch zu
einer Industrialisierung geführt: seit dem
17. Jahrhundert bereits erstarren die Formen
in unaufhörlicher Wiederholung, die Serien-
produktion unterdrückt jede persönlich-künst-
lerische Ausdrucksmöglichkeit. Der Beginn
dieser Dekadenz fällt zeitlich mit den An-
fängen der Europäisierung des Landes unter
Peter dem Großen zusammen, mit dem Ein-
dringen einer westlichen, höfisch-aristokra-
tisch-eleganten Kunst, die in Kürze alle boden-
ständigen Elemente, alle mystisch-nationalen
Eigenheiten, alle orientalischen Erinnerungen
zu ersticken beginnt. Die Überreste jener
Epoche aber, die man die „Prae-Occidentale“
Geburt Christi
Epoche Theophanes’ des Griechen, 2. Hälfte
14. Jahrhunderts •— 53 : 40 cm
Paris, Privatbesitz
nennen kann, sind in Anbetracht der Größe
des Landes nicht nur in den europäischen
Museen, sondern selbst in Rußland äußerst
geringfügig. So kann letzten Endes auch der
neue Russen-Saal des Berliner Kaiser-
Friedrich-Museums, das als erstes westeuropäi-
sches Museum dieser Kunst die ihr gebührende
Beachtung geschenkt hat, notgedrungener-
maßen nur ein unvollständiges, mehr oder
weniger zufälliges Bild russischer Ikonen-
malerei geben.
Darin beruht nun vor allem die überragende
Bedeutung dieser in Paris gezeigten (anonym
gebliebenen) Privatsammlung, daß sie die ge-
samte Entwicklung frührussischer
Ikonenmalerei in drei Jahrhunderten, vom 14. bis
17., zu anschaulichem Leben erweckt: von den
Schulen von Novgorod und Pskov bis zu denen
Nordrußlands und Moskaus, von der Epoche
Theophanes’ des Griechen über die von Denis
und Rublev bis zur Blütezeit der Stroganov-
schule rollt sich hier Etappe um Etappe künst-
lerischen Geschehens ab. Filiationen und Ein-
flüsse, der Wissenschaft so wert, treten deut-
lich hervor. In der „Geburt Christi“, die wir
hier veröffentlichen, übrigens einer der älte-
sten Darstellungen dieses Themas in der russi-
schen Kunst, wo die monochrome Haltung bei-
nahe impressionistisch wirkt, unterscheidet
man neben dem Einfluß der byzantinischen
Kunst noch deutlich frühere hellenistische Re-
miniszenzen, die Ainalovs Theorie des „Helle-
nistischen Einflusses auf die byzantinische
Kunst“ stützen. Man versteht auch anderer-
seits, daß Paul Muratoff mit richtigem Grund
diese Ikonen die „Primitiven“ der russischen
Kunst benennt, indem er sie durch diese Ter-
minologie ihren italienischen, demselben
Stammbaum entsprossenen Geschwistern an
die Seite stellt, wenngleich keineswegs ver-
kannt wird, daß in der italienischen und der
russischen Kunst die Verarbeitung des Erbguts
verschiedene Wege geht. Das selbständig-
nationale Element findet überall seine stärkste
Ausprägung und schafft eine persönliche Note.
Manche der Architekturstaffagen sind so
typisch russisch, daß moderne russische Balletts
Elias im Feuerwagen
Novgoroder Schule, 1. Hälfte 16. Jahrhundert
64 : 51 cm
Paris, Privatbesitz
sich ihrer in ihrer Ausstattung bedienen, und
der hier abgebildete „Elias im Feuerwagen“
ruft die Erinnerung an volkstümliche russische
Illustrationskunst wach. Viel bliebe zu sagen
über die charakteristische Konstante des Sym-
bolismus, der dieser Kunst eigen, über den
starken Einfluß der Buchmalerei, über die Per-
sönlichkeit der Einzelkünstler und ihre Schulen,
doch sei für alle diese Fragen auf das kleine
Buch von Paul Muratoff verwiesen, das er den
Werken dieser Sammlung gewidmet hat
(„Trente cinq primitifs russes“, Paris 1931,
mit Vorwort von M. Henri Focillon).
Assia Rubinstein (Paris)
AUSSTELLUNGEN
in Dresden:
Anna von Sachsen
Im Staatlichen Historischen Mu-
seum in Dresden findet zur Zeit zum
Gedächtnis der vor 400 Jahren geborenen Kur-
fürstin Anna von Sachsen eine Ausstellung
statt, an der fast alle staatlichen Sammlungen
Dresdens und einige auswärtige Museen mit
Leihgaben beteiligt sind. Zahlreiche Bildnisse,
u. a. von Lucas Cranach d. J. und Hans Krell
gemalt, Skulpturen, kostbare Gefäße und
Schmuck aus dem persönlichen Besitz der Kur-
fürstin, Waffen deutscher und italienischer
Herkunft, Geschenke Annas an ihren Gemahl,
Bildnismedaillen, u. a. von Tobias Wolff,
Koch-, Arznei- und Haushaltsbücher, z. T. in
Einbänden von Jacob Krause, handbemalte
Kräuterbücher, Gartenutensilien und Proben
von Klöppelei und Wirkerei des 16. Jahrhun-
derts geben ein anschauliches Bild von der viel-
seitigen Persönlichkeit der Kurfürstin.
in Köln:
Neudeutsche Romantik
Die Galerie Abels in Köln beginnt
das neue Jahr mit einer Ausstellung „Neu-
deutsche Romantik in der Ma-
lere i“, die als Fortsetzung der im Sommer
1932 im Museum in Ulm gezeigten Aus-
stellung gedacht ist. Unter den beteiligten
Künstlern sind unter andern: Champion, Diet-
rich, von Kralik, Lenk, Nägele, Peiner (Ab-
bildung Seite 3), Pilartz, Schrimpf, Step-