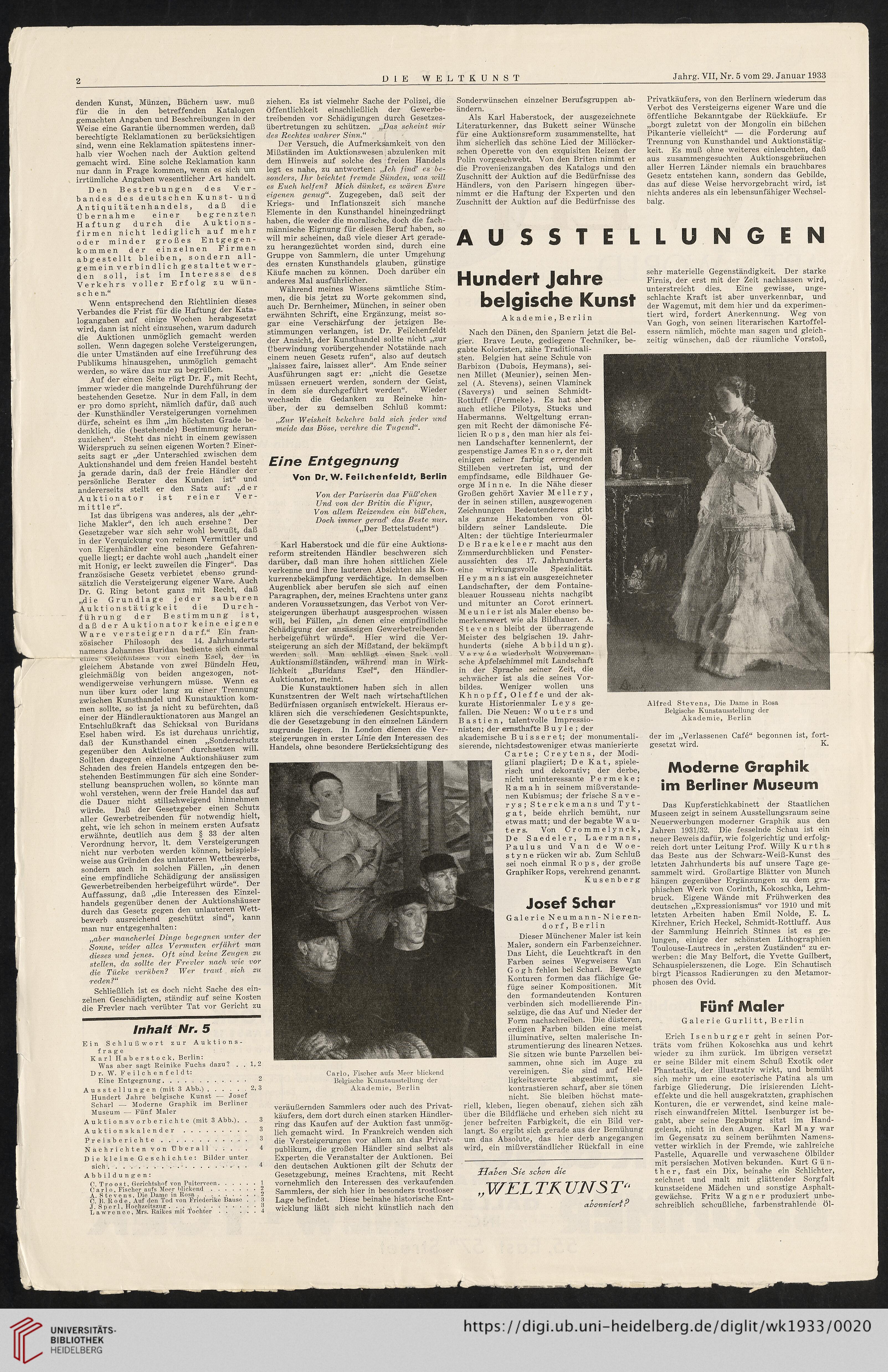2
ü 1 E W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933
denden Kunst, Münzen, Büchern usw. muß
für die in den betreffenden Katalogen
gemachten Angaben und Beschreibungen in der
Weise eine Garantie übernommen werden, daß
berechtigte Reklamationen zu berücksichtigen
sind, wenn eine Reklamation spätestens inner-
halb vier Wochen nach der Auktion geltend
gemacht wird. Eine solche Reklamation kann
nur dann in Frage kommen, wenn es sich um
irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.
Den Bestrebungen des Ver-
bandes des deutschen Kunst- und
Antiquitätenhandels, daß die
Übernahme einer begrenzten
Haftung durch die Auktions-
firmen nicht lediglich auf mehr
oder minder großes Entgegen-
kommen der einzelnen Firmen
abgestellt bleiben, sondern all-
gemein verbindlich gestaltet wer-
den soll, ist im Interesse des
Verkehrs voller Erfolg zu wün-
sche n.“
Wenn entsprechend den Richtlinien dieses
Verbandes die Frist für die Haftung der Kata-
logangaben auf einige Wochen herabgesetzt
wird, dann ist nicht einzusehen, warum dadurch
die Auktionen unmöglich gemacht werden
sollen. Wenn dagegen solche Versteigerungen,
die unter Umständen auf eine Irreführung des
Publikums hinausgehen, unmöglich gemacht
werden, so wäre das nur zu begrüßen.
Auf der einen Seite rügt Dr. F., mit Recht,
immer wieder die mangelnde Durchführung der
bestehenden Gesetze. Nur in dem Fall, in dem
er pro domo spricht, nämlich dafür, daß auch
der Kunsthändler Versteigerungen vornehmen
dürfe, scheint es ihm „im höchsten Grade be-
denklich, die (bestehende) Bestimmung heran-
zuziehen“. Steht das nicht in einem gewissen
Widerspruch zu seinen eigenen Worten? Einer-
seits sagt er „der Unterschied zwischen dem
Auktionshandel und dem freien Handel besteht
ja gerade darin, daß der freie Händler der
persönliche Berater des Kunden ist“ und
andererseits stellt er den Satz auf: „der
Auktionator ist reiner Ver-
mittler“.
Ist das übrigens was anderes, als der „ehr-
liche Makler“, den ich auch ersehne? Der
Gesetzgeber war sich sehr wohl bewußt, daß
in der Verquickung von reinem Vermittler und
von Eigenhändler eine besondere Gefahren-
quelle liegt; er dachte wohl auch „handelt einer
mit Honig, er leckt zuweilen die Finger“. Das
französische Gesetz verbietet ebenso grund-
sätzlich die Versteigerung eigener Ware. Auch
Dr. G. Ring betont ganz mit Recht, daß
„die Grundlage jeder sauberen
Au k t i o n s t ä t i g k e i t die Durch-
führung der Bestimmung ist,
daß der Auktionator keine eigene
Ware versteigern darf.“ Ein fran-
zösischer Philosoph des 14. Jahrhunderts
namens Johannes Buridan bediente sich einmal
eiiie» CHei^ftiilsseö von einem Esel, der in
gleichem Abstande von zwei Bündeln Heu,
gleichmäßig von beiden angezogen, not-
wendigerweise verhungern müsse. Wenn es
nun über kurz oder lang zu einer Trennung
zwischen Kunsthandel und Kunstauktion kom-
men sollte, so ist ja nicht zu befürchten, daß
einer der Händlerauktionatoren aus Mangel an
Entschlußkraft das Schicksal von Buridans
Esel haben wird. Es ist durchaus unrichtig,
daß der Kunsthandel einen „Sonderschutz
gegenüber den Auktionen“ durchsetzen will.
Sollten dagegen einzelne Auktionshäuser zum
Schaden des freien Handels entgegen den be-
stehenden Bestimmungen für sich eine Sonder-
stellung beanspruchen wollen, so könnte man
wohl verstehen, wenn der freie Handel das auf
die Dauer nicht stillschweigend hinnehmen
würde. Daß der Gesetzgeber einen Schutz
aller Gewerbetreibenden für notwendig hielt,
geht, wie ich schon in meinem ersten Aufsatz
erwähnte, deutlich aus dem § 33 der alten
Verordnung hervor, 1t. dem Versteigerungen
nicht nur verboten werden können, beispiels-
weise aus Gründen des unlauteren Wettbewerbs,
sondern auch in solchen Fällen, „in denen
eine empfindliche Schädigung der ansässigen
Gewerbetreibenden herbeigeführt würde“. Der
Auffassung, daß „die Interessen des Einzel-
handels gegenüber denen der Auktionshäuser
durch das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb ausreichend geschützt sind“, kann
man nur entgegenhalten:
„aber mancherlei Dinge begegnen unter der
Sonne, wider alles Vermuten erfährt man
dieses und jenes. Oft sind keine Zeugen zu
stellen, da sollte der Frevler nach wie vor
die Tücke verüben? Wer traut sich zu
reden?“
Schließlich ist es doch nicht Sache des ein-
zelnen Geschädigten, ständig auf seine Kosten
die Frevler nach verübter Tat vor Gericht zu
Inhalt Nr. 5
Ein Schlußwort zur Auktions-
frage
Karl Haberstock, Berlin:
Was aber sagt Reinike Fuchs dazu? . . 1, 2
Dr. W. Feilchenfeldt:
Eine Entgegnung. 2
Ausstellungen (mit 3 Abb.).2, 3
Hundert Jahre belgische Kunst — Josef
Schari — Moderne Graphik im Berliner
Museum — Fünf Maler
Auktions vorberichte (mit 3 Abb.). . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Preisberichte. . . . . . 3
Nachrichten von Überall . . . . . 4
Die kleine Geschichte: Bilder unter
sich. 4
Abbildungen:
C. Tro ost, Gerichtshof von Puiterveen.1
Carlo, Fischer aufs Meer blickend.2
A. Stevens, Die Dame in Rosa.2
C. B. Rode, Auf den Tod von Friederike Bause . . 3
J. Sperl, Hochzeitszug- . . ..3
L a wr e n c e, Mrs. Raikes mit Tochter.4
ziehen. Es ist vielmehr Sache der Polizei, die
Öffentlichkeit einschließlich der Gewerbe-
treibenden vor Schädigungen durch Gesetzes-
übertretungen zu schützen. „Das scheint mir
des Rechtes wahrer Sinn.“
Der Versuch, die Aufmerksamkeit von den
Mißständen im Auktionswesen abzulenken mit
dem Hinweis auf solche des freien Handels
legt es nahe, zu antworten: „Ich find’ es be-
sonders, Ihr beichtet fremde Sünden, was will
es Euch helfen? Mich dilnket, es wären Eure
eigenen genug“. Zugegeben, daß seit der
Kriegs- und Inflationszeit sich manche
Elemente in den Kunsthandel hineingedrängt
haben, die weder die moralische, doch die fach-
männische Eignung für diesen Beruf haben, so
will mir scheinen, daß viele dieser Art gerade-
zu herangezüchtet worden sind, durch eine
Gruppe von Sammlern, die unter Umgehung
des ernsten Kunsthandels glauben, günstige
Käufe machen zu können. Doch darüber ein
anderes Mal ausführlicher.
Während meines Wissens sämtliche Stim-
men, die bis jetzt zu Worte gekommen sind,
auch Dr. Bernheimer, München, in seiner oben
erwähnten Schrift, eine Ergänzung, meist so-
gar eine Verschärfung der jetzigen Be-
stimmungen verlangen, ist Dr. Feilchenfeldt
der Ansicht, der Kunsthandel sollte nicht „zur
Überwindung vorübergehender Notstände nach
einem neuen Gesetz rufen“, also auf deutsch
„laissez faire, laissez aller“. Am Ende seiner
Ausführungen sagt er: „nicht die Gesetze
müssen erneuert werden, sondern der Geist,
in dem sie durchgeführt werden“. Wieder
wechseln die Gedanken zu Reineke hin-
über, der zu demselben Schluß kommt:
„Zur Weisheit bekehre bald sich jeder und
meide das Böse, verehre die Tugend“.
Eine Entgegnung
Von Dr. W. Feilchenfeldt, Berlin
Von der Pariserin das Füß’chen
Und von der Britin die Figur,
Von allem Reizenden ein biß’chen,
Doch immer gerad’ das Beste nur.
(„Der Bettelstudent“)
Karl Haberstock und die für eine Auktions-
reform streitenden Händler beschweren sich
darüber, daß man ihre hohen sittlichen Ziele
verkenne und ihre lauteren Absichten als Kon-
kurrenzbekämpfung verdächtige. In demselben
Augenblick aber berufen sie sich auf einen
Paragraphen, der, meines Erachtens unter ganz
anderen Voraussetzungen, das Verbot von Ver-
steigerungen überhaupt ausgesprochen wissen
will, bei Fällen, „in denen eine empfindliche
Schädigung der ansässigen Gewerbetreibenden
herbeigeführt würde“. Hier wird die Ver-
steigerung an sich der Mißstand, der bekämpft
werden soll. Man schlägt einen Sack. voll
Auktionsmißständen, während man in Wirk-
lichkeit „Buridans Esel“, den Händler-
Auktionator, meint.
Die Kunstauktionen haben sich in allen
Kunstzentren der Welt nach wirtschaftlichen
Sonderwünschen einzelner Berufsgruppen ab-
ändern.
Als Karl Haberstock, der ausgezeichnete
Literaturkenner, das Bukett seiner Wünsche
für eine Auktionsreform zusammenstellte, hat
ihm sicherlich das schöne Lied der Millöcker-
sehen Operette von den exquisiten Reizen der
Polin vorgeschwebt. Von den Briten nimmt er
die Provenienzangaben des Katalogs und den
Zuschnitt der Auktion auf die Bedürfnisse des
Händlers, von den Parisern hingegen über-
nimmt er die Haftung der Experten und den
Zuschnitt der Auktion auf die Bedürfnisse des
Privatkäufers, von den Berlinern wiederum das
Verbot des Versteigerns eigener Ware und die
öffentliche Bekanntgabe der Rückkäufe. Er
„borgt zuletzt von der Mongolin ein bißchen
Pikanterie vielleicht“ — die Forderung auf
Trennung von Kunsthandel und Auktionstätig-
keit. Es muß ohne weiteres einleuchten, daß
aus zusammengesuchten Auktionsgebräuchen
aller Herren Länder niemals ein brauchbares
Gesetz entstehen kann, sondern das Gebilde,
das auf diese Weise hervorgebracht wird, ist
nichts anderes als ein lebensunfähiger Wechsel-
balg.
AUSSTELLUNGEN
Hundert Jahre
belgische Kunst
Akademie, Berlin
Nach den Dänen, den Spaniern jetzt die Bel-
gier. Brave Leute, gediegene Techniker, be-
sehr materielle Gegenständigkeit. Der starke
Firnis, der erst mit der Zeit nachlassen wird,
unterstreicht dies. Eine gewisse, unge-
schlachte Kraft ist aber unverkennbar, und
der Wagemut, mit dem hier und da experimen-
tiert wird, fordert Anerkennung. Weg von
Van Gogh, von seinen literarischen Kartoffel-
essern nämlich, möchte man sagen und gleich-
zeitig wünschen, daß der räumliche Vorstoß,
gabte Koloristen, zähe Traditionali-
sten. Belgien hat seine Schule von
Barbizon (Dubois, Heymans), sei-
nen Millet (Meunier), seinen Men-
zel (A. Stevens), seinen Vlaminck
(Saverys) und seinen Schmidt-
Rottluff (Permeke). Es hat aber
auch etliche Pilotys, Stucks und
Habermanns. Weltgeltung erran-
gen mit Recht der dämonische Fe-
licien R o p s , den man hier als fei-
nen Landschafter kennenlemt, der
gespenstige James E n s o r, der mit
einigen seiner farbig erregenden
Stilleben vertreten ist, und der
empfindsame, edle Bildhauer Ge-
orge Minne. In die Nähe dieser
Großen gehört Xavier M e 11 e r y ,
der in seinen stillen, ausgewogenen
Zeichnungen Bedeutenderes gibt
als ganze Hekatomben von Öl-
bildern seiner Landsleute. Die
Alten: der tüchtige Interieurmaler
De Braekeleer macht aus den
Zimmerdurchblicken und Fenster-
aussichten des 17. Jahrhunderts
eine wirkungsvolle Spezialität.
H e y m a n s ist ein ausgezeichneter
Landschafter, der dem Fontaine-
bleauer Rousseau nichts nachgibt
und mitunter an Corot erinnert.
M e u n i e r ist als Maler ebenso be-
merkenswert wie als Bildhauer. A.
Stevens bleibt der überragende
Meister des belgischen 19. Jahr-
hunderts (siehe Abbildung).
Verwes wiederholt Wouverman-
sche Apfelschimmel mit Landschaft
in der Sprache seiner Zeit, die
schwächer ist als die seines Vor-
bildes. Weniger wollen uns
Khnopff, Oleffe und der ak-
Bedürfnissen organisch entwickelt. Hieraus er-
klären sich die verschiedenen Gesichtspunkte,
die der Gesetzgebung in den einzelnen Ländern
zugrunde liegen. In London dienen die Ver-
steigerungen in erster Linie den Interessen des
Handels, ohne besondere Berücksichtigung des
kurate Historienmaler Leys ge-
fallen. Die Neuen: Wouters und
B a s t i e n , talentvolle Impressio-
nisten; der ernsthafte B u y 1 e ; der
akademische Buisseret; der monumentali-
sierende, nichtsdestoweniger etwas manierierte
Carte; Creytens, der Modi-
gliani plagiiert; De Kat, spiele-
risch und dekorativ; der derbe,
nicht uninteressante Permeke;
R a m a h in seinem mißverstande-
nen Kubismus; der frische Save-
rys; Sterckemans und T y t -
g a t, beide ehrlich bemüht, nur
etwas matt; und der begabte Wau-
ters. Von Crommelynck,
De Saedeler, Laermans,
Paulus und Van de Woe-
s t y n e rücken wir ab. Zum Schluß
sei noch einmal R o p s , der große
Graphiker Rops, verehrend genannt.
Kusenberg
Josef Schor
Galerie Neumann-Nieren-
dorf, Berlin
Dieser Münchener Maler ist kein
Maler, sondern ein Farbenzeichner.
Das Licht, die Leuchtkraft in den
Farben seines Wegweisers Van
Gogh fehlen bei Schari. Bewegte
Konturen formen das flächige Ge-
füge seiner Kompositionen. Mit
den formandeutenden Konturen
verbinden sich modellierende Pin-
selzüge, die das Auf und Nieder der
Form nachschreiben. Die düsteren,
erdigen Farben bilden eine meist
illuminative, selten malerische In-
strumentierung des linearen Netzes.
Sie sitzen wie bunte Parzellen bei-
sammen, ohne sich im Auge zu
Carlo, Fischer aufs Meer blickend
Belgische Kunstausstellung der
Akademie, Berlin
veräußernden Sammlers oder auch des Privat-
käufers, dem dort durch einen starken Händler-
ring das Kaufen auf der Auktion fast unmög-
lich gemacht wird. In Frankreich wenden sich
die Versteigerungen vor allem an das Privat-
publikum, die großen Händler sind selbst als
Experten die Veranstalter der Auktionen. Bei
den deutschen Auktionen gilt der Schutz der
Gesetzgebung, meines Erachtens, mit Recht
vornehmlich den Interessen des verkaufenden
Sammlers, der sich hier in besonders trostloser
Lage befindet. Diese beinahe historische Ent-
wicklung läßt sich nicht künstlich nach den
vereinigen. Sie sind auf Hel-
ligkeitswerte abgestimmt, sie
kontrastieren scharf, aber sie tönen
nicht. Sie bleiben höchst mate-
riell, kleben, liegen obenauf, ziehen sich zäh
über die Bildfläche und erheben sich nicht zu
jener befreiten Farbigkeit, die ein Bild ver-
langt. So ergibt sich gerade aus der Bemühung
um das Absolute, das hier derb angegangen
wird, ein mißverständlicher Rückfall in eine
Haben Sie schon die
„WELTEUNST^
abonniert ?
Alfred Stevens, Die Dame in Rosa
Belgische Kunstausstellung der
Akademie, Berlin
der im „Verlassenen Cafe“ begonnen ist, fort-
gesetzt wird. K.
Moderne Graphik
im Berliner Museum
Das Kupferstichkabinett der Staatlichen
Museen zeigt in seinem Ausstellungsraum seine
Neuerwerbungen moderner Graphik aus den
Jahren 1931/32. Die fesselnde Schau ist ein
neuer Beweis dafür, wie folgerichtig und erfolg-
reich dort unter Leitung Prof. Willy Kurths
das Beste aus der Schwarz-Weiß-Kunst des
letzten Jahrhunderts bis auf unsere Tage ge-
sammelt wird. Großartige Blätter von Munch
hängen gegenüber Ergänzungen zu dem gra-
phischen Werk von Corinth, Kokoschka, Lehm-
bruck. Eigene Wände mit Frühwerken des
deutschen „Expressionismus“ vor 1910 und mit
letzten Arbeiten haben Emil Nolde, E. L.
Kirchner, Erich Heckel, Schmidt-Rottluff. Aus
der Sammlung Heinrich Stinnes ist es ge-
lungen, einige der schönsten Lithographien
Toulouse-Lautrecs in „ersten Zuständen“ zu er-
werben: die May Belfort, die Yvette Guilbert,
Schauspielerszenen, die Loge. Ein Schautisch
birgt Picassos Radierungen zu den Metamor-
phosen des Ovid.
Fünf Maler
Galerie Gurlitt, Berlin
Erich Isenburger geht in seinen Por-
träts vom frühen Kokoschka aus und kehrt
wieder zu ihm zurück. Im übrigen versetzt
er seine Bilder mit einem Schuß Exotik oder
Phantastik, der illustrativ wirkt, und bemüht
sich mehr um eine esoterische Patina als um
farbige Gliederung. Die irisierenden Licht-
effekte und die hell ausgekratzten, graphischen
Konturen, die er verwendet, sind keine male-
risch einwandfreien Mittel. Isenburger ist be-
gabt, aber seine Begabung sitzt im Hand-
gelenk, nicht in den Augen. Karl May war
im Gegensatz zu seinem berühmten Namens-
vetter wirklich in der Fremde, wie zahlreiche
Pastelle, Aquarelle und verwaschene Ölbilder
mit persischen Motiven bekunden. Kurt Gün-
ther, fast ein Dix, beinahe ein Schlichter,
zeichnet und malt mit glättender Sorgfalt
kunstseidene Mädchen und sonstige Asphalt-
gewächse. Fritz Wagner produziert unbe-
schreiblich scheußliche, farbenstrahlende Öl-
ü 1 E W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933
denden Kunst, Münzen, Büchern usw. muß
für die in den betreffenden Katalogen
gemachten Angaben und Beschreibungen in der
Weise eine Garantie übernommen werden, daß
berechtigte Reklamationen zu berücksichtigen
sind, wenn eine Reklamation spätestens inner-
halb vier Wochen nach der Auktion geltend
gemacht wird. Eine solche Reklamation kann
nur dann in Frage kommen, wenn es sich um
irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.
Den Bestrebungen des Ver-
bandes des deutschen Kunst- und
Antiquitätenhandels, daß die
Übernahme einer begrenzten
Haftung durch die Auktions-
firmen nicht lediglich auf mehr
oder minder großes Entgegen-
kommen der einzelnen Firmen
abgestellt bleiben, sondern all-
gemein verbindlich gestaltet wer-
den soll, ist im Interesse des
Verkehrs voller Erfolg zu wün-
sche n.“
Wenn entsprechend den Richtlinien dieses
Verbandes die Frist für die Haftung der Kata-
logangaben auf einige Wochen herabgesetzt
wird, dann ist nicht einzusehen, warum dadurch
die Auktionen unmöglich gemacht werden
sollen. Wenn dagegen solche Versteigerungen,
die unter Umständen auf eine Irreführung des
Publikums hinausgehen, unmöglich gemacht
werden, so wäre das nur zu begrüßen.
Auf der einen Seite rügt Dr. F., mit Recht,
immer wieder die mangelnde Durchführung der
bestehenden Gesetze. Nur in dem Fall, in dem
er pro domo spricht, nämlich dafür, daß auch
der Kunsthändler Versteigerungen vornehmen
dürfe, scheint es ihm „im höchsten Grade be-
denklich, die (bestehende) Bestimmung heran-
zuziehen“. Steht das nicht in einem gewissen
Widerspruch zu seinen eigenen Worten? Einer-
seits sagt er „der Unterschied zwischen dem
Auktionshandel und dem freien Handel besteht
ja gerade darin, daß der freie Händler der
persönliche Berater des Kunden ist“ und
andererseits stellt er den Satz auf: „der
Auktionator ist reiner Ver-
mittler“.
Ist das übrigens was anderes, als der „ehr-
liche Makler“, den ich auch ersehne? Der
Gesetzgeber war sich sehr wohl bewußt, daß
in der Verquickung von reinem Vermittler und
von Eigenhändler eine besondere Gefahren-
quelle liegt; er dachte wohl auch „handelt einer
mit Honig, er leckt zuweilen die Finger“. Das
französische Gesetz verbietet ebenso grund-
sätzlich die Versteigerung eigener Ware. Auch
Dr. G. Ring betont ganz mit Recht, daß
„die Grundlage jeder sauberen
Au k t i o n s t ä t i g k e i t die Durch-
führung der Bestimmung ist,
daß der Auktionator keine eigene
Ware versteigern darf.“ Ein fran-
zösischer Philosoph des 14. Jahrhunderts
namens Johannes Buridan bediente sich einmal
eiiie» CHei^ftiilsseö von einem Esel, der in
gleichem Abstande von zwei Bündeln Heu,
gleichmäßig von beiden angezogen, not-
wendigerweise verhungern müsse. Wenn es
nun über kurz oder lang zu einer Trennung
zwischen Kunsthandel und Kunstauktion kom-
men sollte, so ist ja nicht zu befürchten, daß
einer der Händlerauktionatoren aus Mangel an
Entschlußkraft das Schicksal von Buridans
Esel haben wird. Es ist durchaus unrichtig,
daß der Kunsthandel einen „Sonderschutz
gegenüber den Auktionen“ durchsetzen will.
Sollten dagegen einzelne Auktionshäuser zum
Schaden des freien Handels entgegen den be-
stehenden Bestimmungen für sich eine Sonder-
stellung beanspruchen wollen, so könnte man
wohl verstehen, wenn der freie Handel das auf
die Dauer nicht stillschweigend hinnehmen
würde. Daß der Gesetzgeber einen Schutz
aller Gewerbetreibenden für notwendig hielt,
geht, wie ich schon in meinem ersten Aufsatz
erwähnte, deutlich aus dem § 33 der alten
Verordnung hervor, 1t. dem Versteigerungen
nicht nur verboten werden können, beispiels-
weise aus Gründen des unlauteren Wettbewerbs,
sondern auch in solchen Fällen, „in denen
eine empfindliche Schädigung der ansässigen
Gewerbetreibenden herbeigeführt würde“. Der
Auffassung, daß „die Interessen des Einzel-
handels gegenüber denen der Auktionshäuser
durch das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb ausreichend geschützt sind“, kann
man nur entgegenhalten:
„aber mancherlei Dinge begegnen unter der
Sonne, wider alles Vermuten erfährt man
dieses und jenes. Oft sind keine Zeugen zu
stellen, da sollte der Frevler nach wie vor
die Tücke verüben? Wer traut sich zu
reden?“
Schließlich ist es doch nicht Sache des ein-
zelnen Geschädigten, ständig auf seine Kosten
die Frevler nach verübter Tat vor Gericht zu
Inhalt Nr. 5
Ein Schlußwort zur Auktions-
frage
Karl Haberstock, Berlin:
Was aber sagt Reinike Fuchs dazu? . . 1, 2
Dr. W. Feilchenfeldt:
Eine Entgegnung. 2
Ausstellungen (mit 3 Abb.).2, 3
Hundert Jahre belgische Kunst — Josef
Schari — Moderne Graphik im Berliner
Museum — Fünf Maler
Auktions vorberichte (mit 3 Abb.). . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Preisberichte. . . . . . 3
Nachrichten von Überall . . . . . 4
Die kleine Geschichte: Bilder unter
sich. 4
Abbildungen:
C. Tro ost, Gerichtshof von Puiterveen.1
Carlo, Fischer aufs Meer blickend.2
A. Stevens, Die Dame in Rosa.2
C. B. Rode, Auf den Tod von Friederike Bause . . 3
J. Sperl, Hochzeitszug- . . ..3
L a wr e n c e, Mrs. Raikes mit Tochter.4
ziehen. Es ist vielmehr Sache der Polizei, die
Öffentlichkeit einschließlich der Gewerbe-
treibenden vor Schädigungen durch Gesetzes-
übertretungen zu schützen. „Das scheint mir
des Rechtes wahrer Sinn.“
Der Versuch, die Aufmerksamkeit von den
Mißständen im Auktionswesen abzulenken mit
dem Hinweis auf solche des freien Handels
legt es nahe, zu antworten: „Ich find’ es be-
sonders, Ihr beichtet fremde Sünden, was will
es Euch helfen? Mich dilnket, es wären Eure
eigenen genug“. Zugegeben, daß seit der
Kriegs- und Inflationszeit sich manche
Elemente in den Kunsthandel hineingedrängt
haben, die weder die moralische, doch die fach-
männische Eignung für diesen Beruf haben, so
will mir scheinen, daß viele dieser Art gerade-
zu herangezüchtet worden sind, durch eine
Gruppe von Sammlern, die unter Umgehung
des ernsten Kunsthandels glauben, günstige
Käufe machen zu können. Doch darüber ein
anderes Mal ausführlicher.
Während meines Wissens sämtliche Stim-
men, die bis jetzt zu Worte gekommen sind,
auch Dr. Bernheimer, München, in seiner oben
erwähnten Schrift, eine Ergänzung, meist so-
gar eine Verschärfung der jetzigen Be-
stimmungen verlangen, ist Dr. Feilchenfeldt
der Ansicht, der Kunsthandel sollte nicht „zur
Überwindung vorübergehender Notstände nach
einem neuen Gesetz rufen“, also auf deutsch
„laissez faire, laissez aller“. Am Ende seiner
Ausführungen sagt er: „nicht die Gesetze
müssen erneuert werden, sondern der Geist,
in dem sie durchgeführt werden“. Wieder
wechseln die Gedanken zu Reineke hin-
über, der zu demselben Schluß kommt:
„Zur Weisheit bekehre bald sich jeder und
meide das Böse, verehre die Tugend“.
Eine Entgegnung
Von Dr. W. Feilchenfeldt, Berlin
Von der Pariserin das Füß’chen
Und von der Britin die Figur,
Von allem Reizenden ein biß’chen,
Doch immer gerad’ das Beste nur.
(„Der Bettelstudent“)
Karl Haberstock und die für eine Auktions-
reform streitenden Händler beschweren sich
darüber, daß man ihre hohen sittlichen Ziele
verkenne und ihre lauteren Absichten als Kon-
kurrenzbekämpfung verdächtige. In demselben
Augenblick aber berufen sie sich auf einen
Paragraphen, der, meines Erachtens unter ganz
anderen Voraussetzungen, das Verbot von Ver-
steigerungen überhaupt ausgesprochen wissen
will, bei Fällen, „in denen eine empfindliche
Schädigung der ansässigen Gewerbetreibenden
herbeigeführt würde“. Hier wird die Ver-
steigerung an sich der Mißstand, der bekämpft
werden soll. Man schlägt einen Sack. voll
Auktionsmißständen, während man in Wirk-
lichkeit „Buridans Esel“, den Händler-
Auktionator, meint.
Die Kunstauktionen haben sich in allen
Kunstzentren der Welt nach wirtschaftlichen
Sonderwünschen einzelner Berufsgruppen ab-
ändern.
Als Karl Haberstock, der ausgezeichnete
Literaturkenner, das Bukett seiner Wünsche
für eine Auktionsreform zusammenstellte, hat
ihm sicherlich das schöne Lied der Millöcker-
sehen Operette von den exquisiten Reizen der
Polin vorgeschwebt. Von den Briten nimmt er
die Provenienzangaben des Katalogs und den
Zuschnitt der Auktion auf die Bedürfnisse des
Händlers, von den Parisern hingegen über-
nimmt er die Haftung der Experten und den
Zuschnitt der Auktion auf die Bedürfnisse des
Privatkäufers, von den Berlinern wiederum das
Verbot des Versteigerns eigener Ware und die
öffentliche Bekanntgabe der Rückkäufe. Er
„borgt zuletzt von der Mongolin ein bißchen
Pikanterie vielleicht“ — die Forderung auf
Trennung von Kunsthandel und Auktionstätig-
keit. Es muß ohne weiteres einleuchten, daß
aus zusammengesuchten Auktionsgebräuchen
aller Herren Länder niemals ein brauchbares
Gesetz entstehen kann, sondern das Gebilde,
das auf diese Weise hervorgebracht wird, ist
nichts anderes als ein lebensunfähiger Wechsel-
balg.
AUSSTELLUNGEN
Hundert Jahre
belgische Kunst
Akademie, Berlin
Nach den Dänen, den Spaniern jetzt die Bel-
gier. Brave Leute, gediegene Techniker, be-
sehr materielle Gegenständigkeit. Der starke
Firnis, der erst mit der Zeit nachlassen wird,
unterstreicht dies. Eine gewisse, unge-
schlachte Kraft ist aber unverkennbar, und
der Wagemut, mit dem hier und da experimen-
tiert wird, fordert Anerkennung. Weg von
Van Gogh, von seinen literarischen Kartoffel-
essern nämlich, möchte man sagen und gleich-
zeitig wünschen, daß der räumliche Vorstoß,
gabte Koloristen, zähe Traditionali-
sten. Belgien hat seine Schule von
Barbizon (Dubois, Heymans), sei-
nen Millet (Meunier), seinen Men-
zel (A. Stevens), seinen Vlaminck
(Saverys) und seinen Schmidt-
Rottluff (Permeke). Es hat aber
auch etliche Pilotys, Stucks und
Habermanns. Weltgeltung erran-
gen mit Recht der dämonische Fe-
licien R o p s , den man hier als fei-
nen Landschafter kennenlemt, der
gespenstige James E n s o r, der mit
einigen seiner farbig erregenden
Stilleben vertreten ist, und der
empfindsame, edle Bildhauer Ge-
orge Minne. In die Nähe dieser
Großen gehört Xavier M e 11 e r y ,
der in seinen stillen, ausgewogenen
Zeichnungen Bedeutenderes gibt
als ganze Hekatomben von Öl-
bildern seiner Landsleute. Die
Alten: der tüchtige Interieurmaler
De Braekeleer macht aus den
Zimmerdurchblicken und Fenster-
aussichten des 17. Jahrhunderts
eine wirkungsvolle Spezialität.
H e y m a n s ist ein ausgezeichneter
Landschafter, der dem Fontaine-
bleauer Rousseau nichts nachgibt
und mitunter an Corot erinnert.
M e u n i e r ist als Maler ebenso be-
merkenswert wie als Bildhauer. A.
Stevens bleibt der überragende
Meister des belgischen 19. Jahr-
hunderts (siehe Abbildung).
Verwes wiederholt Wouverman-
sche Apfelschimmel mit Landschaft
in der Sprache seiner Zeit, die
schwächer ist als die seines Vor-
bildes. Weniger wollen uns
Khnopff, Oleffe und der ak-
Bedürfnissen organisch entwickelt. Hieraus er-
klären sich die verschiedenen Gesichtspunkte,
die der Gesetzgebung in den einzelnen Ländern
zugrunde liegen. In London dienen die Ver-
steigerungen in erster Linie den Interessen des
Handels, ohne besondere Berücksichtigung des
kurate Historienmaler Leys ge-
fallen. Die Neuen: Wouters und
B a s t i e n , talentvolle Impressio-
nisten; der ernsthafte B u y 1 e ; der
akademische Buisseret; der monumentali-
sierende, nichtsdestoweniger etwas manierierte
Carte; Creytens, der Modi-
gliani plagiiert; De Kat, spiele-
risch und dekorativ; der derbe,
nicht uninteressante Permeke;
R a m a h in seinem mißverstande-
nen Kubismus; der frische Save-
rys; Sterckemans und T y t -
g a t, beide ehrlich bemüht, nur
etwas matt; und der begabte Wau-
ters. Von Crommelynck,
De Saedeler, Laermans,
Paulus und Van de Woe-
s t y n e rücken wir ab. Zum Schluß
sei noch einmal R o p s , der große
Graphiker Rops, verehrend genannt.
Kusenberg
Josef Schor
Galerie Neumann-Nieren-
dorf, Berlin
Dieser Münchener Maler ist kein
Maler, sondern ein Farbenzeichner.
Das Licht, die Leuchtkraft in den
Farben seines Wegweisers Van
Gogh fehlen bei Schari. Bewegte
Konturen formen das flächige Ge-
füge seiner Kompositionen. Mit
den formandeutenden Konturen
verbinden sich modellierende Pin-
selzüge, die das Auf und Nieder der
Form nachschreiben. Die düsteren,
erdigen Farben bilden eine meist
illuminative, selten malerische In-
strumentierung des linearen Netzes.
Sie sitzen wie bunte Parzellen bei-
sammen, ohne sich im Auge zu
Carlo, Fischer aufs Meer blickend
Belgische Kunstausstellung der
Akademie, Berlin
veräußernden Sammlers oder auch des Privat-
käufers, dem dort durch einen starken Händler-
ring das Kaufen auf der Auktion fast unmög-
lich gemacht wird. In Frankreich wenden sich
die Versteigerungen vor allem an das Privat-
publikum, die großen Händler sind selbst als
Experten die Veranstalter der Auktionen. Bei
den deutschen Auktionen gilt der Schutz der
Gesetzgebung, meines Erachtens, mit Recht
vornehmlich den Interessen des verkaufenden
Sammlers, der sich hier in besonders trostloser
Lage befindet. Diese beinahe historische Ent-
wicklung läßt sich nicht künstlich nach den
vereinigen. Sie sind auf Hel-
ligkeitswerte abgestimmt, sie
kontrastieren scharf, aber sie tönen
nicht. Sie bleiben höchst mate-
riell, kleben, liegen obenauf, ziehen sich zäh
über die Bildfläche und erheben sich nicht zu
jener befreiten Farbigkeit, die ein Bild ver-
langt. So ergibt sich gerade aus der Bemühung
um das Absolute, das hier derb angegangen
wird, ein mißverständlicher Rückfall in eine
Haben Sie schon die
„WELTEUNST^
abonniert ?
Alfred Stevens, Die Dame in Rosa
Belgische Kunstausstellung der
Akademie, Berlin
der im „Verlassenen Cafe“ begonnen ist, fort-
gesetzt wird. K.
Moderne Graphik
im Berliner Museum
Das Kupferstichkabinett der Staatlichen
Museen zeigt in seinem Ausstellungsraum seine
Neuerwerbungen moderner Graphik aus den
Jahren 1931/32. Die fesselnde Schau ist ein
neuer Beweis dafür, wie folgerichtig und erfolg-
reich dort unter Leitung Prof. Willy Kurths
das Beste aus der Schwarz-Weiß-Kunst des
letzten Jahrhunderts bis auf unsere Tage ge-
sammelt wird. Großartige Blätter von Munch
hängen gegenüber Ergänzungen zu dem gra-
phischen Werk von Corinth, Kokoschka, Lehm-
bruck. Eigene Wände mit Frühwerken des
deutschen „Expressionismus“ vor 1910 und mit
letzten Arbeiten haben Emil Nolde, E. L.
Kirchner, Erich Heckel, Schmidt-Rottluff. Aus
der Sammlung Heinrich Stinnes ist es ge-
lungen, einige der schönsten Lithographien
Toulouse-Lautrecs in „ersten Zuständen“ zu er-
werben: die May Belfort, die Yvette Guilbert,
Schauspielerszenen, die Loge. Ein Schautisch
birgt Picassos Radierungen zu den Metamor-
phosen des Ovid.
Fünf Maler
Galerie Gurlitt, Berlin
Erich Isenburger geht in seinen Por-
träts vom frühen Kokoschka aus und kehrt
wieder zu ihm zurück. Im übrigen versetzt
er seine Bilder mit einem Schuß Exotik oder
Phantastik, der illustrativ wirkt, und bemüht
sich mehr um eine esoterische Patina als um
farbige Gliederung. Die irisierenden Licht-
effekte und die hell ausgekratzten, graphischen
Konturen, die er verwendet, sind keine male-
risch einwandfreien Mittel. Isenburger ist be-
gabt, aber seine Begabung sitzt im Hand-
gelenk, nicht in den Augen. Karl May war
im Gegensatz zu seinem berühmten Namens-
vetter wirklich in der Fremde, wie zahlreiche
Pastelle, Aquarelle und verwaschene Ölbilder
mit persischen Motiven bekunden. Kurt Gün-
ther, fast ein Dix, beinahe ein Schlichter,
zeichnet und malt mit glättender Sorgfalt
kunstseidene Mädchen und sonstige Asphalt-
gewächse. Fritz Wagner produziert unbe-
schreiblich scheußliche, farbenstrahlende Öl-