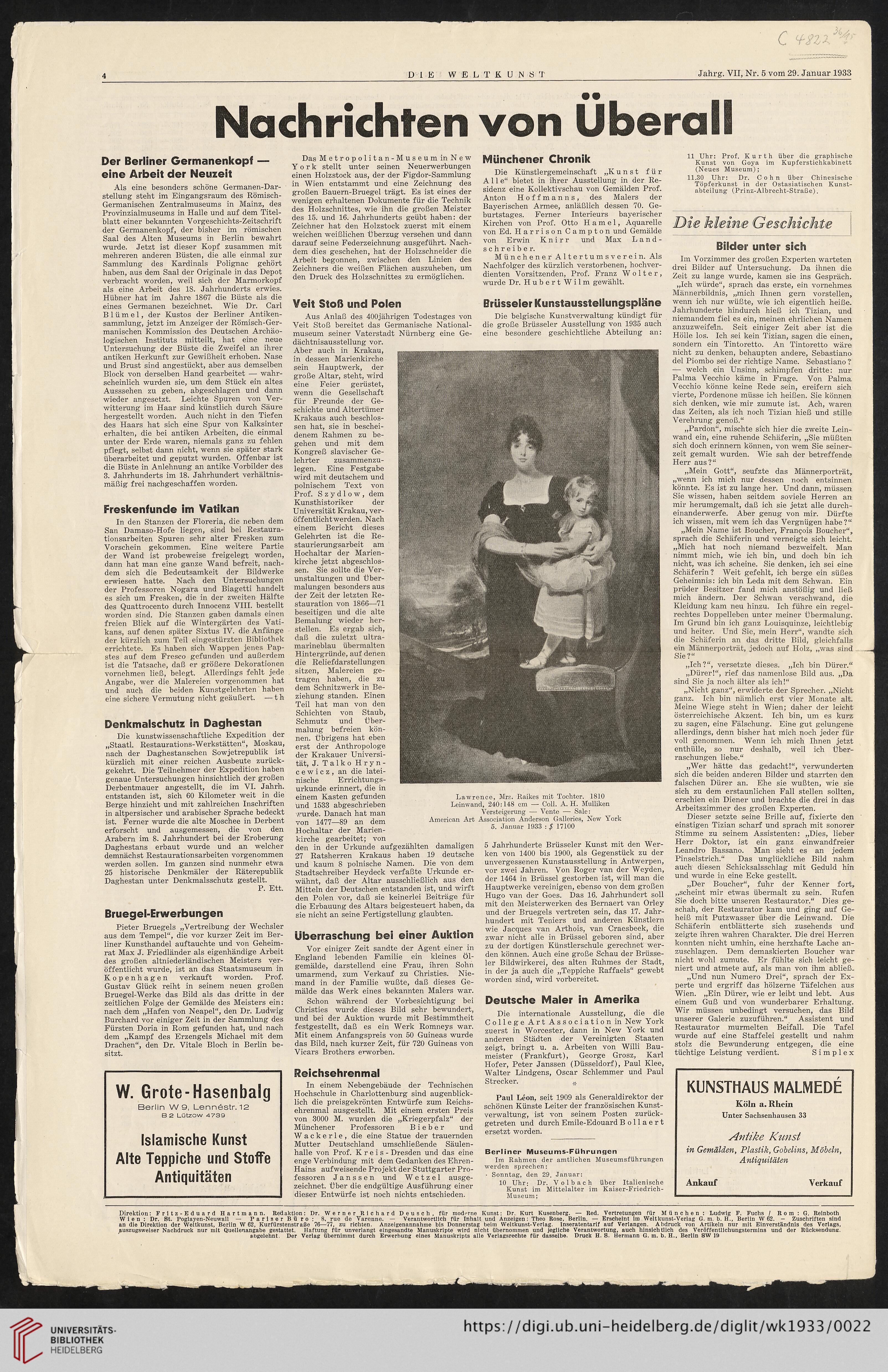4
DIE W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933
Nachrichten von Überall
Der Berliner Germanenkopf —
eine Arbeit der Neuzeit
Als eine besonders schöne Germanen-Dar-
stellung steht im Eingangsraum des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums in Mainz, des
Provinzialmuseums in Halle und auf dem Titel-
blatt einer bekannten Vorgeschichts-Zeitschrift
der Germanenkopf, der bisher im römischen
Saal des Alten Museums in Berlin bewahrt
wurde. Jetzt ist dieser Kopf zusammen mit
mehreren anderen Büsten, die alle einmal zur
Sammlung des Kardinals Polignac gehört
haben, aus dem Saal der Originale in das Depot
verbracht worden, weil sich der Marmorkopf
als eine Arbeit des 18. Jahrhunderts erwies.
Hübner hat im Jahre 1867 die Büste als die
eines Germanen bezeichnet. Wie Dr. Carl
B 1 ü m e 1, der Kustos der Berliner Antiken-
sammlung, jetzt im Anzeiger der Römisch-Ger-
manischen Kommission des Deutschen Archäo-
logischen Instituts mitteilt, hat eine neue
Untersuchung der Büste die Zweifel an ihrer
antiken Herkunft zur Gewißheit erhoben. Nase
und Brust sind angestückt, aber aus demselben
Block von derselben Hand gearbeitet — wahr-
scheinlich wurden sie, um dem Stück ein altes
Ausssehen zu geben, abgeschlagen und dann
wieder angesetzt. Leichte Spuren von Ver-
witterung im Haar sind künstlich durch Säure
hergestellt worden. Auch nicht in den Tiefen
des Haars hat sich eine Spur von Kalksinter
erhalten, die bei antiken Arbeiten, die einmal
unter der Erde waren, niemals ganz zu fehlen
pflegt, selbst dann nicht, wenn sie später stark
überarbeitet und geputzt wurden. Offenbar ist
die Büste in Anlehnung an antike Vorbilder des
3. Jahrhunderts im 18. Jahrhundert verhältnis-
mäßig frei nachgeschaffen worden.
Freskenfunde im Vatikan
In den Stanzen der Floreria, die neben dem
San Damaso-Hofe liegen, sind bei Restaura-
tionsarbeiten Spuren sehr alter Fresken zum
Vorschein gekommen. Eine weitere Partie
der Wand ist probeweise freigelegt worden,
dann hat man eine ganze Wand befreit, nach-
dem sich die Bedeutsamkeit der Bildwerke
erwiesen hatte. Nach den Untersuchungen
der Professoren Nogara und Biagetti handelt
es sich um Fresken, die in der zweiten Hälfte
des Quattrocento durch Innocenz VIII. bestellt
worden sind. Die Stanzen gaben damals einen
freien Blick auf die Wintergärten des Vati-
kans, auf denen später Sixtus IV. die Anfänge
der kürzlich zum Teil eingestürzten Bibliothek
errichtete. Es haben sich Wappen jenes Pap-
stes auf dem Fresco gefunden und außerdem
ist die Tatsache, daß er größere Dekorationen
vornehmen ließ, belegt. Allerdings fehlt jede
Angabe, wer die Malereien vorgenommen hat
und auch die beiden- Kunstgelehrten haben
eine sichere Vermutung nicht geäußert. —th
Denkmalschutz in Daghestan
Die kunstwissenschaftliche Expedition der
„Staatl. Restaurations-Werkstätten“, Moskau,
nach der Daghestanschen Sowjetrepublik ist
kürzlich mit einer reichen Ausbeute zurück-
gekehrt. Die Teilnehmer der Expedition haben
genaue Untersuchungen hinsichtlich der großen
Derbentmauer angestellt, die im VI. Jahrh.
entstanden ist, sich 60 Kilometer weit in die
Berge hinzieht und mit zahlreichen Inschriften
in altpersischer und arabischer Sprache bedeckt
ist. Ferner wurde die alte Moschee in Derbent
erforscht und ausgemessen, die von den
Arabern im 8. Jahrhundert bei der Eroberung
Daghestans erbaut wurde und an welcher
demnächst Restaurationsarbeiten vorgenommen
werden sollen. Im ganzen sind nunmehr etwa
25 historische Denkmäler der Räterepublik
Daghestan unter Denkmalsschutz gestellt.
P. Ett.
Bruegel-Erwerbungen
Pieter Bruegels „Vertreibung der Wechsler
aus dem Tempel“, die vor kurzer Zeit im Ber-
liner Kunsthandel auftauchte und von Geheim-
rat Max J. Friedländer als eigenhändige Arbeit
des großen altniederländischen Meisters ver-
öffentlicht wurde, ist an das Staatsmuseum in
Kopenhagen verkauft worden. Prof.
Gustav Glück reiht in seinem neuen großen
Bruegel-Werke das Bild als das dritte in der
zeitlichen Folge der Gemälde des Meisters ein:
nach dem „Hafen von Neapel“, den Dr. Ludwig
Burchard vor einiger Zeit in der Sammlung des
Fürsten Doria in Rom gefunden hat, und nach
dem „Kampf des Erzengels Michael mit dem
Drachen“, den Dr. Vitale Bloch in Berlin be-
sitzt.
W. Grote-Hasenbalg
Berlin W 9, Lennestr. 12
B 2 LütZOW 4739
Islamische Kunst
Alte Teppiche und Stoffe
Antiquitäten
Das Metropolitan-Museum in New
York stellt unter seinen Neuerwerbungen
einen Holzstock aus, der der Figdor-Sammlung
in Wien entstammt und eine Zeichnung des
großen Bauern-Bruegel trägt. Es ist eines der
wenigen erhaltenen Dokumente für die Technik
des Holzschnittes, wie ihn die großen Meister
des 15. und 16. Jahrhunderts geübt haben: der
Zeichner hat den Holzstock zuerst mit einem
weichen weißlichen Überzug versehen und dann
darauf seine Federzeichnung ausgeführt. Nach-
dem dies geschehen, hat der Holzschneider die
Arbeit begonnen, zwischen den Linien des
Zeichners die weißen Flächen auszuheben, um
den Druck des Holzschnittes zu ermöglichen.
Münchener Chronik
Die Künstlergemeinschaft „K u n s t für
Alle“ bietet in ihrer Ausstellung in der Re-
sidenz eine Kollektivschau von Gemälden Prof.
Anton Hoffmanns, des Malers der
Bayerischen Armee, anläßlich dessen 70. Ge-
burtstages. Ferner Interieurs bayerischer
Kirchen von Prof. Otto Hamel, Aquarelle
von Ed. Harrison Campton und Gemälde
von Erwin K n i r r und Max Land-
Schreiber.
Münchener Altertumsverein. Als
Nachfolger des kürzlich verstorbenen, hochver-
dienten Vorsitzenden, Prof. Franz Wolter,
wurde Dr. Hubert Wilm gewählt.
Veit Stoß und Polen
Aus Anlaß des 400jährigen Todestages von
Veit Stoß bereitet das Germanische National-
museum seiner Vaterstadt Nürnberg eine Ge-
Brüsseler Kunstausstellungspläne
Die belgische Kunstverwaltung kündigt für
die große Brüsseler Ausstellung von 1935 auch
eine besondere geschichtliche Abteilung an:
dächtnisausstellung vor.
Aber auch in Krakau,
in dessen Marienkirche
sein Hauptwerk, der
große Altar, steht, wird
eine Feier gerüstet,
wenn die Gesellschaft
für Freunde der Ge-
schichte und Altertümer
Krakaus auch beschlos-
sen hat, sie in beschei-
denem Rahmen zu be-
gehen und mit dem
Kongreß slavischer Ge-
lehrter zusammenzu-
legen. Eine Festgabe
wird mit deutschem und
polnischem Text von
Prof. S z y d 1 o w , dem
Kunsthistoriker der
Universität Krakau, ver-
öffentlichtwerden. Nach
einem Bericht dieses
Gelehrten ist die Re-
staurierungsarbeit am
Hochaltar der Marien-
kirche jetzt abgeschlos-
sen. Sie sollte die Ver-
unstaltungen und Über-
malungen besonders aus
der Zeit der letzten Re-
stauration von 1866—71
beseitigen und die alte
Bemalung wieder her-
stellen. Es ergab sich,
daß die zuletzt ultra-
marineblau übermalten
Hintergründe, auf denen
die Reliefdarstellungen
sitzen, Malereien ge-
tragen haben, die zu
dem Schnitzwerk in Be-
ziehung standen. Einen
Teil hat man von den
Schichten von Staub,
Schmutz und Über-
malung befreien kön-
nen. Übrigens hat eben
erst der Anthropologe
der Krakauer Universi-
tät, J. Talko Hryn-
c e w i c z , an die latei-
nische Errichtungs-
urkunde erinnert, die in
einem Kasten gefunden
Lawrence, Mrs. Raikes mit Tochter. 1810
und 1533 abgeschrieben
wurde. Danach hat man
von 1477—89 an dem
Hochaltar der Marien -
Leinwand, 240:148 cm — Coll. A. H. Mulliken
Versteigerung — Vente —• Sale:
American Art Association Anderson Galleries, New York
5. Januar 1933 : $ 17100
kirche gearbeitet; von
den in der Urkunde aufgezählten damaligen
27 Ratsherren Krakaus haben 19 deutsche
und kaum 8 polnische Namen. Die von dem
Stadtschreiber Hey deck verfaßte Urkunde er-
wähnt, daß der Altar ausschließlich aus den
Mitteln der Deutschen entstanden ist, und wirft
den Polen vor, daß sie keinerlei Beiträge für
die Erbauung des Altars beigesteuert haben, da
sie nicht an seine Fertigstellung glaubten.
5 Jahrhunderte Brüsseler Kunst mit den Wer-
ken von 1400 bis 1900, als Gegenstück zu der
unvergessenen Kunstausstellung in Antwerpen,
vor zwei Jahren. Von Roger van der Weyden,
der 1464 in Brüssel gestorben ist, will man die
Hauptwerke vereinigen, ebenso von dem großen
Hugo van der Goes. Das 16. Jahrhundert soll
mit den Meisterwerken des Bernaert van Orley
und der Bruegels vertreten sein, das 17. Jahr-
hundert mit Teniers und anderen Künstlern
Überraschung bei einer Auktion
Vor einiger Zeit sandte der Agent einer in
England lebenden Familie ein kleines Öl-
gemälde, darstellend eine Frau, ihren Sohn
umarmend, zum Verkauf zu Christies. Nie-
mand in der Familie wußte, daß dieses Ge-
mälde das Werk eines bekannten Malers war.
Schon während der Vorbesichtigung bei
Christies wurde dieses Bild sehr bewundert,
und bei der Auktion wurde mit Bestimmtheit
festgestellt, daß es ein Werk Romneys war.
Mit einem Anfangspreis von 50 Guineas wurde
das Bild, nach kurzer Zeit, für 720 Guineas von
Vicars Brothers erworben.
Reichsehrenmal
In einem Nebengebäude der Technischen
Hochschule in Charlottenburg sind augenblick-
lich die preisgekrönten Entwürfe zum Reichs-
ehrenmal ausgestellt. Mit einem ersten Preis
von 3000 M. wurden die „Kriegerpfalz“ der
Münchener Professoren Bieber und
W a c k e r 1 e , die eine Statue der trauernden
Mutter Deutschland umschließende Säulen-
wie Jacques van Arthois, van Craesbeek, die
zwar nicht alle in Brüssel geboren sind, aber
zu der dortigen Künstlerschule gerechnet wer-
den können. Auch eine große Schau der Brüsse-
ler Bildwirkerei, des alten Ruhmes der Stadt,
in der ja auch die „Teppiche Raffaels“ gewebt
worden sind, wird vorbereitet.
Deutsche Maler in Amerika
Die internationale Ausstellung, die die
College Art Association in New York
zuerst in Worcester, dann in New York und
anderen Städten der Vereinigten Staaten
zeigt, bringt u. a. Arbeiten von Willi Bau-
meister (Frankfurt), George Grosz, Karl
Hofer, Peter Janssen (Düsseldorf), Paul Klee,
Walter Lindgens, Oscar Schlemmer und Paul
Strecker. #
Paul Leon, seit 1909 als Generaldirektor der
schönen Künste Leiter der französischen Kunst-
verwaltung, ist von seinem Posten zurück-
getreten und durch Emile-Edouard Bollaert
ersetzt worden.
halle von Prof. Kreis- Dresden und das eine
enge Verbindung mit dem Gedanken des Ehren-
Hains aufweisende Projekt der Stuttgarter Pro-
fessoren Janssen und Wetzel ausge-
zeichnet. Über die endgültige Ausführung einer
dieser Entwürfe ist noch nichts entschieden.
Berliner Museums-Führungen
Im Rahmen der amtlichen Museumsführungen
werden sprechen:
• Sonntag, den 29. Januar:
10 Uhr; Dr. Volbach über Italienische
Kunst im Mittelalter im Kaiser-Friedrich-
Museum ;
11 Uhr: Prof. Kurth über die graphische
Kunst von Goya im Kupferstichkabinett
(Neues Museum);
11.30 Uhr: Dr. Cohn über Chinesische
Töpferkunst in der Ostasiatischen Kunst-
abteilung (Prinz-Albrecht-Straße).
Die kleine Geschichte
Bildes1 unter sich
Im Vorzimmer des großen Experten warteten
drei Bilder auf Untersuchung. Da ihnen die
Zeit zu lange wurde, kamen sie ins Gespräch.
„Ich würde“, sprach das erste, ein vornehmes
Männerbildnis, „mich Ihnen gern vorstellen,
wenn ich nur wüßte, wie ich eigentlich heiße.
Jahrhunderte hindurch hieß ich Tizian, und
niemandem fiel es ein, meinen ehrlichen Namen
anzuzweifeln. Seit einiger Zeit aber ist die
Hölle los. Ich sei kein Tizian, sagen die einen,
sondern ein Tintoretto. An Tintoretto wäre
nicht zu denken, behaupten andere, Sebastiano
del Piombo sei der richtige Name. Sebastiano ?
— welch ein Unsinn, schimpfen dritte: nur
Palma Vecchio käme in Frage. Von Palma
Vecchio könne keine Rede sein, ereifern sich
vierte, Pordenone müsse ich heißen. Sie können
sich denken, wie mir zumute ist. Ach, waren
das Zeiten, als ich noch Tizian hieß und stille
Verehrung genoß.“
„Pardon“, mischte sich hier die zweite Lein-
wand ein, eine ruhende Schäferin, „Sie müßten
sich doch erinnern können, von wem Sie seiner-
zeit gemalt wurden. Wie sah der betreffende
Herr aus?“
„Mein Gott“, seufzte das Männerporträt,
„wenn ich mich nur dessen noch entsinnen
könnte. Es ist zu lange her. Und dann, müssen
Sie wissen, haben seitdem soviele Herren an
mir herumgemalt, daß ich sie jetzt alle durch-
einanderwerfe. Aber genug von mir. Dürfte
ich wissen, mit wem ich das Vergnügen habe?“
„Mein Name ist Boucher, Frangois Boucher“,
sprach die Schäferin und verneigte sich leicht.
„Mich hat noch niemand bezweifelt. Man
nimmt mich, wie ich bin, und doch bin ich
nicht, was ich scheine. Sie denken, ich sei eine
Schäferin ? Weit gefehlt, ich berge ein süßes
Geheimnis: ich bin Leda mit dem Schwan. Ein
prüder Besitzer fand mich anstößig und ließ
mich ändern. Der Schwan verschwand, die
Kleidung kam neu hinzu. Ich führe ein regel-
rechtes Doppelleben unter meiner Übermalung.
Im Grund bin ich ganz Louisquinze, leichtlebig
und heiter. Und Sie, mein Herr“, wandte sich
die Schäferin an das dritte Bild, gleichfalls
ein Männerporträt, jedoch auf Holz, „was sind
Sie?“
„Ich?“, versetzte dieses. „Ich bin Dürer.“
„Dürer!“, rief das namenlose Bild aus. „Da
sind Sie ja noch älter als ich!“
„Nicht ganz“, erwiderte der Sprecher. „Nicht
ganz. Ich bin nämlich erst vier Monate alt.
Meine Wiege steht in Wien; daher der leicht
österreichische Akzent. Ich bin, um es kurz
zu sagen, eine Fälschung. Eine gut gelungene
allerdings, denn bisher hat mich noch jeder für
voll genommen. Wenn ich mich Ihnen jetzt
enthülle, so nur deshalb, weil ich Über-
raschungen liebe.“
„Wer hätte das gedacht!“, verwunderten
sich die beiden anderen Bilder und starrten den
falschen Dürer an. Ehe sie wußten, wie sie
sich zu dem erstaunlichen Fall stellen sollten,
erschien ein Diener und brachte die drei in das
Arbeitszimmer des großen Experten.
Dieser setzte seine Brille auf, fixierte den
einstigen Tizian scharf und sprach mit sonorer
Stimme zu seinem Assistenten: „Dies, lieber
Herr Doktor, ist ein ganz einwandfreier
Leandro Bassano. Man sieht es an jedem
Pinselstrich.“ Das unglückliche Bild nahm
auch diesen Schicksalsschlag mit Geduld hin
und wurde in eine Ecke gestellt.
„Der Boucher“, fuhr der Kenner fort,
„scheint mir etwas übermalt zu sein. Rufen
Sie doch bitte unseren Restaurator.“ Dies ge-
schah, der Restaurator kam und ging auf Ge-
heiß mit Putzwasser über die Leinwand. Die
Schäferin entblätterte sich zusehends und
zeigte ihren wahren Charakter. Die drei Herren
konnten nicht umhin, eine herzhafte Lache an-
zuschlagen. Dem demaskierten Boucher war
nicht wohl zumute. Er fühlte sich leicht ge-
niert und atmete auf, als man von ihm abließ.
„Und nun Numero Drei“, sprach der Ex-
perte und ergriff das hölzerne Täfelchen aus
Wien. „Ein Dürer, wie er leibt und lebt. Aus
einem Guß und von wunderbarer Erhaltung.
Wir müssen unbedingt versuchen, das Bild
unserer Galerie zuzuführen.“ Assistent und
Restaurator murmelten Beifall. Die Tafel
wurde auf eine Staffelei gestellt und nahm
stolz die Bewunderung entgegen, die eine
tüchtige Leistung verdient. Simplex
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. - Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
angelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19
DIE W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933
Nachrichten von Überall
Der Berliner Germanenkopf —
eine Arbeit der Neuzeit
Als eine besonders schöne Germanen-Dar-
stellung steht im Eingangsraum des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums in Mainz, des
Provinzialmuseums in Halle und auf dem Titel-
blatt einer bekannten Vorgeschichts-Zeitschrift
der Germanenkopf, der bisher im römischen
Saal des Alten Museums in Berlin bewahrt
wurde. Jetzt ist dieser Kopf zusammen mit
mehreren anderen Büsten, die alle einmal zur
Sammlung des Kardinals Polignac gehört
haben, aus dem Saal der Originale in das Depot
verbracht worden, weil sich der Marmorkopf
als eine Arbeit des 18. Jahrhunderts erwies.
Hübner hat im Jahre 1867 die Büste als die
eines Germanen bezeichnet. Wie Dr. Carl
B 1 ü m e 1, der Kustos der Berliner Antiken-
sammlung, jetzt im Anzeiger der Römisch-Ger-
manischen Kommission des Deutschen Archäo-
logischen Instituts mitteilt, hat eine neue
Untersuchung der Büste die Zweifel an ihrer
antiken Herkunft zur Gewißheit erhoben. Nase
und Brust sind angestückt, aber aus demselben
Block von derselben Hand gearbeitet — wahr-
scheinlich wurden sie, um dem Stück ein altes
Ausssehen zu geben, abgeschlagen und dann
wieder angesetzt. Leichte Spuren von Ver-
witterung im Haar sind künstlich durch Säure
hergestellt worden. Auch nicht in den Tiefen
des Haars hat sich eine Spur von Kalksinter
erhalten, die bei antiken Arbeiten, die einmal
unter der Erde waren, niemals ganz zu fehlen
pflegt, selbst dann nicht, wenn sie später stark
überarbeitet und geputzt wurden. Offenbar ist
die Büste in Anlehnung an antike Vorbilder des
3. Jahrhunderts im 18. Jahrhundert verhältnis-
mäßig frei nachgeschaffen worden.
Freskenfunde im Vatikan
In den Stanzen der Floreria, die neben dem
San Damaso-Hofe liegen, sind bei Restaura-
tionsarbeiten Spuren sehr alter Fresken zum
Vorschein gekommen. Eine weitere Partie
der Wand ist probeweise freigelegt worden,
dann hat man eine ganze Wand befreit, nach-
dem sich die Bedeutsamkeit der Bildwerke
erwiesen hatte. Nach den Untersuchungen
der Professoren Nogara und Biagetti handelt
es sich um Fresken, die in der zweiten Hälfte
des Quattrocento durch Innocenz VIII. bestellt
worden sind. Die Stanzen gaben damals einen
freien Blick auf die Wintergärten des Vati-
kans, auf denen später Sixtus IV. die Anfänge
der kürzlich zum Teil eingestürzten Bibliothek
errichtete. Es haben sich Wappen jenes Pap-
stes auf dem Fresco gefunden und außerdem
ist die Tatsache, daß er größere Dekorationen
vornehmen ließ, belegt. Allerdings fehlt jede
Angabe, wer die Malereien vorgenommen hat
und auch die beiden- Kunstgelehrten haben
eine sichere Vermutung nicht geäußert. —th
Denkmalschutz in Daghestan
Die kunstwissenschaftliche Expedition der
„Staatl. Restaurations-Werkstätten“, Moskau,
nach der Daghestanschen Sowjetrepublik ist
kürzlich mit einer reichen Ausbeute zurück-
gekehrt. Die Teilnehmer der Expedition haben
genaue Untersuchungen hinsichtlich der großen
Derbentmauer angestellt, die im VI. Jahrh.
entstanden ist, sich 60 Kilometer weit in die
Berge hinzieht und mit zahlreichen Inschriften
in altpersischer und arabischer Sprache bedeckt
ist. Ferner wurde die alte Moschee in Derbent
erforscht und ausgemessen, die von den
Arabern im 8. Jahrhundert bei der Eroberung
Daghestans erbaut wurde und an welcher
demnächst Restaurationsarbeiten vorgenommen
werden sollen. Im ganzen sind nunmehr etwa
25 historische Denkmäler der Räterepublik
Daghestan unter Denkmalsschutz gestellt.
P. Ett.
Bruegel-Erwerbungen
Pieter Bruegels „Vertreibung der Wechsler
aus dem Tempel“, die vor kurzer Zeit im Ber-
liner Kunsthandel auftauchte und von Geheim-
rat Max J. Friedländer als eigenhändige Arbeit
des großen altniederländischen Meisters ver-
öffentlicht wurde, ist an das Staatsmuseum in
Kopenhagen verkauft worden. Prof.
Gustav Glück reiht in seinem neuen großen
Bruegel-Werke das Bild als das dritte in der
zeitlichen Folge der Gemälde des Meisters ein:
nach dem „Hafen von Neapel“, den Dr. Ludwig
Burchard vor einiger Zeit in der Sammlung des
Fürsten Doria in Rom gefunden hat, und nach
dem „Kampf des Erzengels Michael mit dem
Drachen“, den Dr. Vitale Bloch in Berlin be-
sitzt.
W. Grote-Hasenbalg
Berlin W 9, Lennestr. 12
B 2 LütZOW 4739
Islamische Kunst
Alte Teppiche und Stoffe
Antiquitäten
Das Metropolitan-Museum in New
York stellt unter seinen Neuerwerbungen
einen Holzstock aus, der der Figdor-Sammlung
in Wien entstammt und eine Zeichnung des
großen Bauern-Bruegel trägt. Es ist eines der
wenigen erhaltenen Dokumente für die Technik
des Holzschnittes, wie ihn die großen Meister
des 15. und 16. Jahrhunderts geübt haben: der
Zeichner hat den Holzstock zuerst mit einem
weichen weißlichen Überzug versehen und dann
darauf seine Federzeichnung ausgeführt. Nach-
dem dies geschehen, hat der Holzschneider die
Arbeit begonnen, zwischen den Linien des
Zeichners die weißen Flächen auszuheben, um
den Druck des Holzschnittes zu ermöglichen.
Münchener Chronik
Die Künstlergemeinschaft „K u n s t für
Alle“ bietet in ihrer Ausstellung in der Re-
sidenz eine Kollektivschau von Gemälden Prof.
Anton Hoffmanns, des Malers der
Bayerischen Armee, anläßlich dessen 70. Ge-
burtstages. Ferner Interieurs bayerischer
Kirchen von Prof. Otto Hamel, Aquarelle
von Ed. Harrison Campton und Gemälde
von Erwin K n i r r und Max Land-
Schreiber.
Münchener Altertumsverein. Als
Nachfolger des kürzlich verstorbenen, hochver-
dienten Vorsitzenden, Prof. Franz Wolter,
wurde Dr. Hubert Wilm gewählt.
Veit Stoß und Polen
Aus Anlaß des 400jährigen Todestages von
Veit Stoß bereitet das Germanische National-
museum seiner Vaterstadt Nürnberg eine Ge-
Brüsseler Kunstausstellungspläne
Die belgische Kunstverwaltung kündigt für
die große Brüsseler Ausstellung von 1935 auch
eine besondere geschichtliche Abteilung an:
dächtnisausstellung vor.
Aber auch in Krakau,
in dessen Marienkirche
sein Hauptwerk, der
große Altar, steht, wird
eine Feier gerüstet,
wenn die Gesellschaft
für Freunde der Ge-
schichte und Altertümer
Krakaus auch beschlos-
sen hat, sie in beschei-
denem Rahmen zu be-
gehen und mit dem
Kongreß slavischer Ge-
lehrter zusammenzu-
legen. Eine Festgabe
wird mit deutschem und
polnischem Text von
Prof. S z y d 1 o w , dem
Kunsthistoriker der
Universität Krakau, ver-
öffentlichtwerden. Nach
einem Bericht dieses
Gelehrten ist die Re-
staurierungsarbeit am
Hochaltar der Marien-
kirche jetzt abgeschlos-
sen. Sie sollte die Ver-
unstaltungen und Über-
malungen besonders aus
der Zeit der letzten Re-
stauration von 1866—71
beseitigen und die alte
Bemalung wieder her-
stellen. Es ergab sich,
daß die zuletzt ultra-
marineblau übermalten
Hintergründe, auf denen
die Reliefdarstellungen
sitzen, Malereien ge-
tragen haben, die zu
dem Schnitzwerk in Be-
ziehung standen. Einen
Teil hat man von den
Schichten von Staub,
Schmutz und Über-
malung befreien kön-
nen. Übrigens hat eben
erst der Anthropologe
der Krakauer Universi-
tät, J. Talko Hryn-
c e w i c z , an die latei-
nische Errichtungs-
urkunde erinnert, die in
einem Kasten gefunden
Lawrence, Mrs. Raikes mit Tochter. 1810
und 1533 abgeschrieben
wurde. Danach hat man
von 1477—89 an dem
Hochaltar der Marien -
Leinwand, 240:148 cm — Coll. A. H. Mulliken
Versteigerung — Vente —• Sale:
American Art Association Anderson Galleries, New York
5. Januar 1933 : $ 17100
kirche gearbeitet; von
den in der Urkunde aufgezählten damaligen
27 Ratsherren Krakaus haben 19 deutsche
und kaum 8 polnische Namen. Die von dem
Stadtschreiber Hey deck verfaßte Urkunde er-
wähnt, daß der Altar ausschließlich aus den
Mitteln der Deutschen entstanden ist, und wirft
den Polen vor, daß sie keinerlei Beiträge für
die Erbauung des Altars beigesteuert haben, da
sie nicht an seine Fertigstellung glaubten.
5 Jahrhunderte Brüsseler Kunst mit den Wer-
ken von 1400 bis 1900, als Gegenstück zu der
unvergessenen Kunstausstellung in Antwerpen,
vor zwei Jahren. Von Roger van der Weyden,
der 1464 in Brüssel gestorben ist, will man die
Hauptwerke vereinigen, ebenso von dem großen
Hugo van der Goes. Das 16. Jahrhundert soll
mit den Meisterwerken des Bernaert van Orley
und der Bruegels vertreten sein, das 17. Jahr-
hundert mit Teniers und anderen Künstlern
Überraschung bei einer Auktion
Vor einiger Zeit sandte der Agent einer in
England lebenden Familie ein kleines Öl-
gemälde, darstellend eine Frau, ihren Sohn
umarmend, zum Verkauf zu Christies. Nie-
mand in der Familie wußte, daß dieses Ge-
mälde das Werk eines bekannten Malers war.
Schon während der Vorbesichtigung bei
Christies wurde dieses Bild sehr bewundert,
und bei der Auktion wurde mit Bestimmtheit
festgestellt, daß es ein Werk Romneys war.
Mit einem Anfangspreis von 50 Guineas wurde
das Bild, nach kurzer Zeit, für 720 Guineas von
Vicars Brothers erworben.
Reichsehrenmal
In einem Nebengebäude der Technischen
Hochschule in Charlottenburg sind augenblick-
lich die preisgekrönten Entwürfe zum Reichs-
ehrenmal ausgestellt. Mit einem ersten Preis
von 3000 M. wurden die „Kriegerpfalz“ der
Münchener Professoren Bieber und
W a c k e r 1 e , die eine Statue der trauernden
Mutter Deutschland umschließende Säulen-
wie Jacques van Arthois, van Craesbeek, die
zwar nicht alle in Brüssel geboren sind, aber
zu der dortigen Künstlerschule gerechnet wer-
den können. Auch eine große Schau der Brüsse-
ler Bildwirkerei, des alten Ruhmes der Stadt,
in der ja auch die „Teppiche Raffaels“ gewebt
worden sind, wird vorbereitet.
Deutsche Maler in Amerika
Die internationale Ausstellung, die die
College Art Association in New York
zuerst in Worcester, dann in New York und
anderen Städten der Vereinigten Staaten
zeigt, bringt u. a. Arbeiten von Willi Bau-
meister (Frankfurt), George Grosz, Karl
Hofer, Peter Janssen (Düsseldorf), Paul Klee,
Walter Lindgens, Oscar Schlemmer und Paul
Strecker. #
Paul Leon, seit 1909 als Generaldirektor der
schönen Künste Leiter der französischen Kunst-
verwaltung, ist von seinem Posten zurück-
getreten und durch Emile-Edouard Bollaert
ersetzt worden.
halle von Prof. Kreis- Dresden und das eine
enge Verbindung mit dem Gedanken des Ehren-
Hains aufweisende Projekt der Stuttgarter Pro-
fessoren Janssen und Wetzel ausge-
zeichnet. Über die endgültige Ausführung einer
dieser Entwürfe ist noch nichts entschieden.
Berliner Museums-Führungen
Im Rahmen der amtlichen Museumsführungen
werden sprechen:
• Sonntag, den 29. Januar:
10 Uhr; Dr. Volbach über Italienische
Kunst im Mittelalter im Kaiser-Friedrich-
Museum ;
11 Uhr: Prof. Kurth über die graphische
Kunst von Goya im Kupferstichkabinett
(Neues Museum);
11.30 Uhr: Dr. Cohn über Chinesische
Töpferkunst in der Ostasiatischen Kunst-
abteilung (Prinz-Albrecht-Straße).
Die kleine Geschichte
Bildes1 unter sich
Im Vorzimmer des großen Experten warteten
drei Bilder auf Untersuchung. Da ihnen die
Zeit zu lange wurde, kamen sie ins Gespräch.
„Ich würde“, sprach das erste, ein vornehmes
Männerbildnis, „mich Ihnen gern vorstellen,
wenn ich nur wüßte, wie ich eigentlich heiße.
Jahrhunderte hindurch hieß ich Tizian, und
niemandem fiel es ein, meinen ehrlichen Namen
anzuzweifeln. Seit einiger Zeit aber ist die
Hölle los. Ich sei kein Tizian, sagen die einen,
sondern ein Tintoretto. An Tintoretto wäre
nicht zu denken, behaupten andere, Sebastiano
del Piombo sei der richtige Name. Sebastiano ?
— welch ein Unsinn, schimpfen dritte: nur
Palma Vecchio käme in Frage. Von Palma
Vecchio könne keine Rede sein, ereifern sich
vierte, Pordenone müsse ich heißen. Sie können
sich denken, wie mir zumute ist. Ach, waren
das Zeiten, als ich noch Tizian hieß und stille
Verehrung genoß.“
„Pardon“, mischte sich hier die zweite Lein-
wand ein, eine ruhende Schäferin, „Sie müßten
sich doch erinnern können, von wem Sie seiner-
zeit gemalt wurden. Wie sah der betreffende
Herr aus?“
„Mein Gott“, seufzte das Männerporträt,
„wenn ich mich nur dessen noch entsinnen
könnte. Es ist zu lange her. Und dann, müssen
Sie wissen, haben seitdem soviele Herren an
mir herumgemalt, daß ich sie jetzt alle durch-
einanderwerfe. Aber genug von mir. Dürfte
ich wissen, mit wem ich das Vergnügen habe?“
„Mein Name ist Boucher, Frangois Boucher“,
sprach die Schäferin und verneigte sich leicht.
„Mich hat noch niemand bezweifelt. Man
nimmt mich, wie ich bin, und doch bin ich
nicht, was ich scheine. Sie denken, ich sei eine
Schäferin ? Weit gefehlt, ich berge ein süßes
Geheimnis: ich bin Leda mit dem Schwan. Ein
prüder Besitzer fand mich anstößig und ließ
mich ändern. Der Schwan verschwand, die
Kleidung kam neu hinzu. Ich führe ein regel-
rechtes Doppelleben unter meiner Übermalung.
Im Grund bin ich ganz Louisquinze, leichtlebig
und heiter. Und Sie, mein Herr“, wandte sich
die Schäferin an das dritte Bild, gleichfalls
ein Männerporträt, jedoch auf Holz, „was sind
Sie?“
„Ich?“, versetzte dieses. „Ich bin Dürer.“
„Dürer!“, rief das namenlose Bild aus. „Da
sind Sie ja noch älter als ich!“
„Nicht ganz“, erwiderte der Sprecher. „Nicht
ganz. Ich bin nämlich erst vier Monate alt.
Meine Wiege steht in Wien; daher der leicht
österreichische Akzent. Ich bin, um es kurz
zu sagen, eine Fälschung. Eine gut gelungene
allerdings, denn bisher hat mich noch jeder für
voll genommen. Wenn ich mich Ihnen jetzt
enthülle, so nur deshalb, weil ich Über-
raschungen liebe.“
„Wer hätte das gedacht!“, verwunderten
sich die beiden anderen Bilder und starrten den
falschen Dürer an. Ehe sie wußten, wie sie
sich zu dem erstaunlichen Fall stellen sollten,
erschien ein Diener und brachte die drei in das
Arbeitszimmer des großen Experten.
Dieser setzte seine Brille auf, fixierte den
einstigen Tizian scharf und sprach mit sonorer
Stimme zu seinem Assistenten: „Dies, lieber
Herr Doktor, ist ein ganz einwandfreier
Leandro Bassano. Man sieht es an jedem
Pinselstrich.“ Das unglückliche Bild nahm
auch diesen Schicksalsschlag mit Geduld hin
und wurde in eine Ecke gestellt.
„Der Boucher“, fuhr der Kenner fort,
„scheint mir etwas übermalt zu sein. Rufen
Sie doch bitte unseren Restaurator.“ Dies ge-
schah, der Restaurator kam und ging auf Ge-
heiß mit Putzwasser über die Leinwand. Die
Schäferin entblätterte sich zusehends und
zeigte ihren wahren Charakter. Die drei Herren
konnten nicht umhin, eine herzhafte Lache an-
zuschlagen. Dem demaskierten Boucher war
nicht wohl zumute. Er fühlte sich leicht ge-
niert und atmete auf, als man von ihm abließ.
„Und nun Numero Drei“, sprach der Ex-
perte und ergriff das hölzerne Täfelchen aus
Wien. „Ein Dürer, wie er leibt und lebt. Aus
einem Guß und von wunderbarer Erhaltung.
Wir müssen unbedingt versuchen, das Bild
unserer Galerie zuzuführen.“ Assistent und
Restaurator murmelten Beifall. Die Tafel
wurde auf eine Staffelei gestellt und nahm
stolz die Bewunderung entgegen, die eine
tüchtige Leistung verdient. Simplex
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. - Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
angelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19