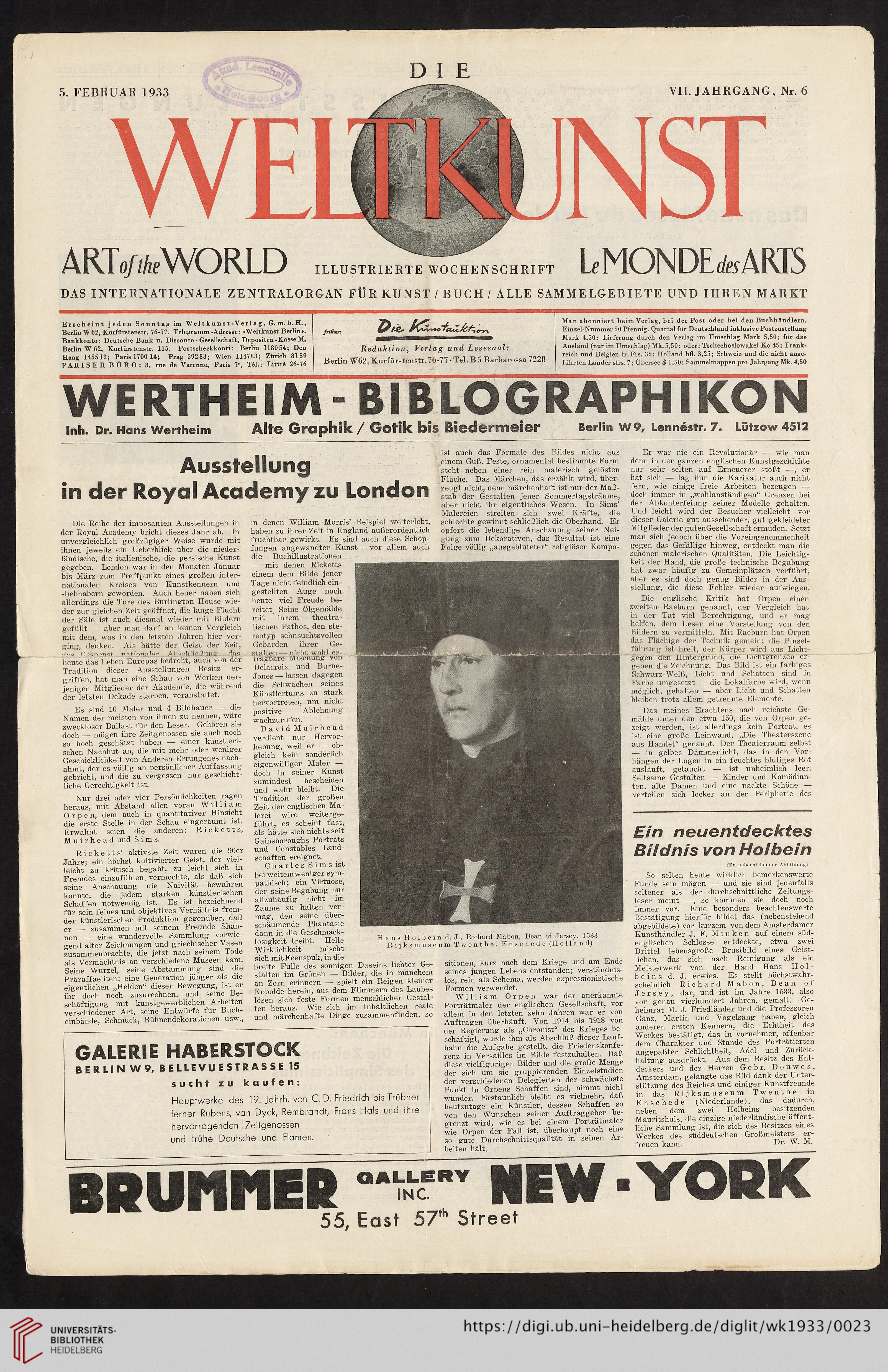5. FEBRUAR 1933
V1L JAHRGANG, Nr. 6
ARTo/rfeWORLD ILLUSTRIERTE WOCHENSCHRIFT LMONDE^AKß
DAS INTERNATIONALE ZENTRALORGAN FÜR KUNST / BUCH / ALLE SAMMELGEBIETE UND IHREN MARKT
Erscheint jeden Sonntag im Weltkunst-Verlag, G. m. b. EL,
Berlin W62, Kurfürstenstr. 76-77. Telegramm-Adresse: «Weltkunst Berlin».
Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto - Gesellschaft, Depositen - Kasse M,
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 115. Postscheckkonti: Berlin 1180 54; Den
Haag 145512; Paris 1700 14; Prag 59283; Wien 114783; Zürich 8159
PARISER BÜRO: 8, nie de Varenne, Paris 7e, T61.: Littre 26-76
Redaktion, Verlag und Lesesaal:
Berlin W62, Kurfürstenstr. 76-77 • Tel. B 5 Barbarossa 7228
Man abonniert beim Verlag, bei der Post oder bei den Buchhändlern,
Einzel-Nummer 50 Pfennig. Quartal für Deutschland inklusive Postzustellung
Mark 4,50; Lieferung durch den Verlag im Umschlag Mark 5,50; für das
Ausland (nur im Umschlag) Mk. 5,50; oder: Tschechoslowakei Kc 45; Frank-
reich und Belgien fr. Frs. 35; Holland hfl. 3,25; Schweiz und die nicht ange-
führten Länder sfrs. 7; Übersee $ 1,50; Sammelmappen pro Jahrgang Mk. 4,50
WERTHEIM- BIBLOGRAPHIKON
Inh. Dr. Hans Wertheim Alte Graphik / Gotik bis Biedermeier Berlin W9, Lennestr. 7. Lützow 4512
Ausstellung
in der Royal Academy zu London
ist auch das Formale des Bildes nicht aus
einem Guß. Feste, ornamental bestimmte Form
steht neben einer rein malerisch gelösten
Fläche. Das Märchen, das erzählt wird, über-
zeugt nicht, denn märchenhaft ist nur der Maß-
stab der Gestalten jener Sommertagsträume,
aber nicht ihr eigentliches Wesen. In Sims’
Die Reihe der imposanten Ausstellungen in
der Royal Academy bricht dieses Jahr ab. In
unvergleichlich großzügiger Weise wurde mit
ihnen jeweils ein Ueberblick über die nieder-
ländische, die italienische, die persische Kunst
in denen William Morris’ Beispiel weiterlebt,
haben zu ihrer Zeit in England außerordentlich
fruchtbar gewirkt. Es sind auch diese Schöp-
fungen angewandter Kunst — vor allem auch
die Buchillustrationen
Malereien streiten sich zwei Kräfte, die
schlechte gewinnt schließlich die Oberhand. Er
opfert die lebendige Anschauung seiner Nei-
gung zum Dekorativen, das Resultat ist eine
Folge völlig „ausgebluteter“ religiöser Kompo-
Hauptwerke des 19. Jahrh. von C. D. Friedrich bisTrübner
ferner Rubens, van Dyck, Rembrandt, Frans Hals und ihre
hervorragenden Zeitgenossen
und frühe Deutsche und Flamen.
sitionen, kurz nach dem Kriege und am Ende
seines jungen Lebens entstanden; verständnis-
los, rein als Schema, werden expressionistische
Formen verwendet.
William Orpen war der anerkannte
Porträtmaler der englischen Gesellschaft, vor
allem in den letzten zehn Jahren war er von
Aufträgen überhäuft. Von 1914 bis 1918 von
der Regierung als „Chronist“ des Krieges be-
schäftigt, wurde ihm als Abschluß dieser Lauf-
bahn die Aufgabe gestellt, die Friedenskonfe-
renz in Versailles im Bilde festzuhalten. Daß
diese vielfigurigen Bilder und die große Menge
der sich um sie gruppierenden Einzelstudien
der verschiedenen Delegierten der schwächste
Punkt in Orpens Schaffen sind, nimmt nicht
wunder. Erstaunlich bleibt es vielmehr, daß
heutzutage ein Künstler, dessen Schaffen so
von den Wünschen seiner Auftraggeber be-
grenzt wird, wie es bei einem Porträtmaler
wie Orpen der Fall ist, überhaupt noch eine
so gute Durchschnittsqualität in seinen Ar-
beiten hält.
Hans Holbein d. J., Richard Mabon, Dean of Jersey. 1533
Rijksmuseum T wen t he, Enschede (Holland)
—■ mit denen Ricketts
einem dem Bilde jener
Tage nicht feindlich ein-
gestellten Auge noch
heute viel Freude be-
reitet. Seine Ölgemälde
mit ihrem theatra-
lischen Pathos, den ste-
reotyp sehnsuchtsvollen
Gebärden ihrer Ge-
stalten -—rieht wob] er-
tragbare Miscnung von
Delacroix und Bume-
Jones — lassen dagegen
die Schwächen seines
Künstlertums zu stark
hervortreten, um nicht
positive Ablehnung
wachzurufen.
David Muirhead
verdient nur Hervor-
hebung, weil er — ob-
gleich kein sonderlich
eigenwilliger Maler —
doch in seiner Kunst
zumindest bescheiden
und wahr bleibt. Die
Tradition der großen
Zeit der englischen Ma-
lerei wird weiterge-
führt, es scheint fast,
als hätte sich nichts seit
Gainsboroughs Porträts
und Constables Land-
schaften ereignet.
Charles Sims ist
bei weitem weniger sym-
pathisch; ein Virtuose,
der seine Begabung nur
allzuhäufig nicht im
Zaume zu halten ver-
mag, den seine über-
schäumende Phantasie
dann in die Geschmack-
losigkeit treibt. Helle
Wirklichkeit mischt
sich mit Feenspuk, in die
breite Fülle des sonnigen Daseins lichter Ge-
stalten im Grünen — Bilder, die in manchem
an Zorn erinnern — spielt ein Reigen kleiner
Kobolde herein, aus dem Flimmern des Laubes
lösen sich feste Formen menschlicher Gestal-
ten heraus. Wie sich im Inhaltlichen reale
und märchenhafte Dinge zusammenfinden, so
gegeben. London war in den Monaten Januar
bis März zum Treffpunkt eines großen inter-
nationalen Kreises von Kunstkennern und
-liebhabern geworden. Auch heuer haben sich
allerdings die Tore des Burlington House wie-
der zur gleichen Zeit geöffnet, die lange Flucht
der Säle ist auch diesmal wieder mit Bildern
gefüllt — aber man darf an keinen Vergleich
mit dem, was in den letzten Jahren hier vor-
ging, denken. Als hätte der Geist der Zeit,
'G» cj n n Q-f-i nn p Ipp A Fr-<‘b 2?. Jf-LS
heute das Leben Europas bedroht, auch von der
Tradition dieser Ausstellungen Besitz er-
griffen, hat man eine Schau von Werken der-
jenigen Mitglieder der Akademie, die während
der letzten Dekade starben, veranstaltet.
Es sind 10 Maler und 4 Bildhauer — die
Namen der meisten von ihnen zu nennen, wäre
zweckloser Ballast für den Leser. Gehören sie
doch — mögen ihre Zeitgenossen sie auch noch
so hoch geschätzt haben — einer künstleri-
schen Nachhut an, die mit mehr oder weniger
Geschicklichkeit von Anderen Errungenes nach-
ahmt, der es völlig an persönlicher Auffassung
gebricht, und die zu vergessen nur geschicht-
liche Gerechtigkeit ist.
Nur drei oder vier Persönlichkeiten ragen
heraus, mit Abstand allen voran William
Orpen, dem auch in quantitativer Hinsicht
die erste Stelle in der Schau eingeräumt ist.
Erwähnt seien die anderen: Ricketts,
Muirhead und Sims.
Ricketts’ aktivste Zeit waren die 90er
Jahre; ein höchst kultivierter Geist, der viel-
leicht zu kritisch begabt, zu leicht sich in
Fremdes einzufühlen vermochte, als daß sich
seine Anschauung die Naivität bewahren
konnte, die jedem starken künstlerischen
Schaffen notwendig ist. Es ist bezeichnend
für sein feines und objektives Verhältnis frem-
der künstlerischer Produktion gegenüber, daß
er — zusammen mit seinem Freunde Shan-
non — eine wundervolle Sammlung vorwie-
gend alter Zeichnungen und griechischer Vasen
zusammenbrachte, die jetzt nach seinem Tode
als Vermächtnis an verschiedene Museen kam.
Seine Wurzel, seine Abstammung sind die
Präraffaeliten; eine Generation jünger als die
eigentlichen „Helden“ dieser Bewegung, ist er
ihr doch noch zuzurechnen, und seine Be-
schäftigung mit kunstgewerblichen Arbeiten
verschiedener Art, seine Entwürfe für Buch-
einbände, Schmuck, Bühnendekorationen usw.,
GALERIE HABERSTOCK
BERLIN W 9, BELLEVUESTRASSE 15
sucht zu kaufen:
Er war nie ein Revolutionär — wie man
denn in der ganzen englischen Kunstgeschichte
nur sehr selten auf Erneuerer stößt —, er
hat sich — lag ihm die Karikatur auch nicht
fern, wie einige freie Arbeiten bezeugen —
doch immer in „wohlanständigen“ Grenzen bei
der Abkonterfeiung seiner Modelle gehalten.
Und leicht wird der Besucher vielleicht vor
dieser Galerie gut aussehender, gut gekleideter
Mitglieder der gutenGesellschaft ermüden. Setzt
man sich jedoch über die Voreingenommenheit
gegen das Gefällige hinweg, entdeckt man die
schönen malerischen Qualitäten. Die Leichtig-
keit der Hand, die große technische Begabung
hat zwar häufig zu Gemeinplätzen verführt,
aber es sind doch genug Bilder in der Aus-
stellung, die diese Fehler wieder aufwiegen.
Die englische Kritik hat Orpen einen
zweiten Raeburn genannt, der Vergleich hat
in der Tat viel Berechtigung, und er mag
helfen, dem Leser eine Vorstellung von den
Bildern zu vermitteln. Mit Raeburn hat Orpen
das Flächige der Technik gemein; die Pinsel-
führung ist breit, der Körper wird aus Licht-
gegen den Hintergrund, die Sichtgrenzen er-
geben die Zeichnung. Das Bild ist ein farbiges
Schwarz-Weiß, Licht und Schatten sind in
Farbe umgesetzt — die Lokalfarbe wird, wenn
möglich, gehalten — aber Licht und Schatten
bleiben trotz allem getrennte Elemente.
Das meines Erachtens nach reichste Ge-
mälde unter den etwa 150, die von Orpen ge-
zeigt werden, ist allerdings kein Porträt, es
ist eine große Leinwand, „Die Theaterszene
aus Hamlet“ genannt. Der Theaterraum selbst
— in gelbes Dämmerlicht, das in den Vor-
hängen der Logen in ein feuchtes blutiges Rot
ausläuft, getaucht — ist unheimlich leer.
Seltsame Gestalten — Kinder und Komödian-
ten, alte Damen und eine nackte Schöne -—
verteilen sich locker an der Peripherie des
Ein neuentdecktes
Bildnis von Holbein
(Zu nebenstehender Abbildung)
So selten heute wirklich bemerkenswerte
Funde sein mögen — und sie sind jedenfalls
seltener als der durchschnittliche Zeitungs-
leser meint —, so kommen sie doch noch
immer vor. Eine besonders beachtenswerte
Bestätigung hierfür bildet das (nebenstehend
abgebildete) vor kurzem von dem Amsterdamer
Kunsthändler J. F. Minken auf einem süd-
englischen Schlosse entdeckte, etwa zwei
Drittel lebensgroße Brustbild eines Geist-
lichen, das sich nach Reinigung als ein
Meisterwerk von der Hand Hans Hol-
beins d. J. erwies. Es stellt höchstwahr-
scheinlich Richard Mabon, Dean of
Jersey, dar, und ist im Jahre 1533, also
vor genau vierhundert Jahren, gemalt. Ge-
heimrat M. J. Friedländer und die Professoren
Ganz, Martin und Vogelsang haben, gleich
anderen ersten Kennern, die Echtheit des
Werkes bestätigt, das in vornehmer, offenbar
dem Charakter und Stande des Porträtierten
angepaßter Schlichtheit, Adel und Zurück-
haltung ausdrückt. Aus dem Besitz des Ent-
deckers und der Herren Gebr. Douwes,
Amsterdam, gelangte das Bild dank der Unter-
stützung des Reiches und einiger Kunstfreunde
in das Rijksmuseum Tw ent he in
Enschede (Niederlande), das dadurch,
neben dem zwei Holbeins besitzenden
Mauritshuis, die einzige niederländische öffent-
liche Sammlung ist, die sich des Besitzes eines
Werkes des süddeutschen Großmeisters er-
freuen kann. Dr. W. M.
BRUNNER OiLUE"Y NEW - YORK
55, East 57th Street