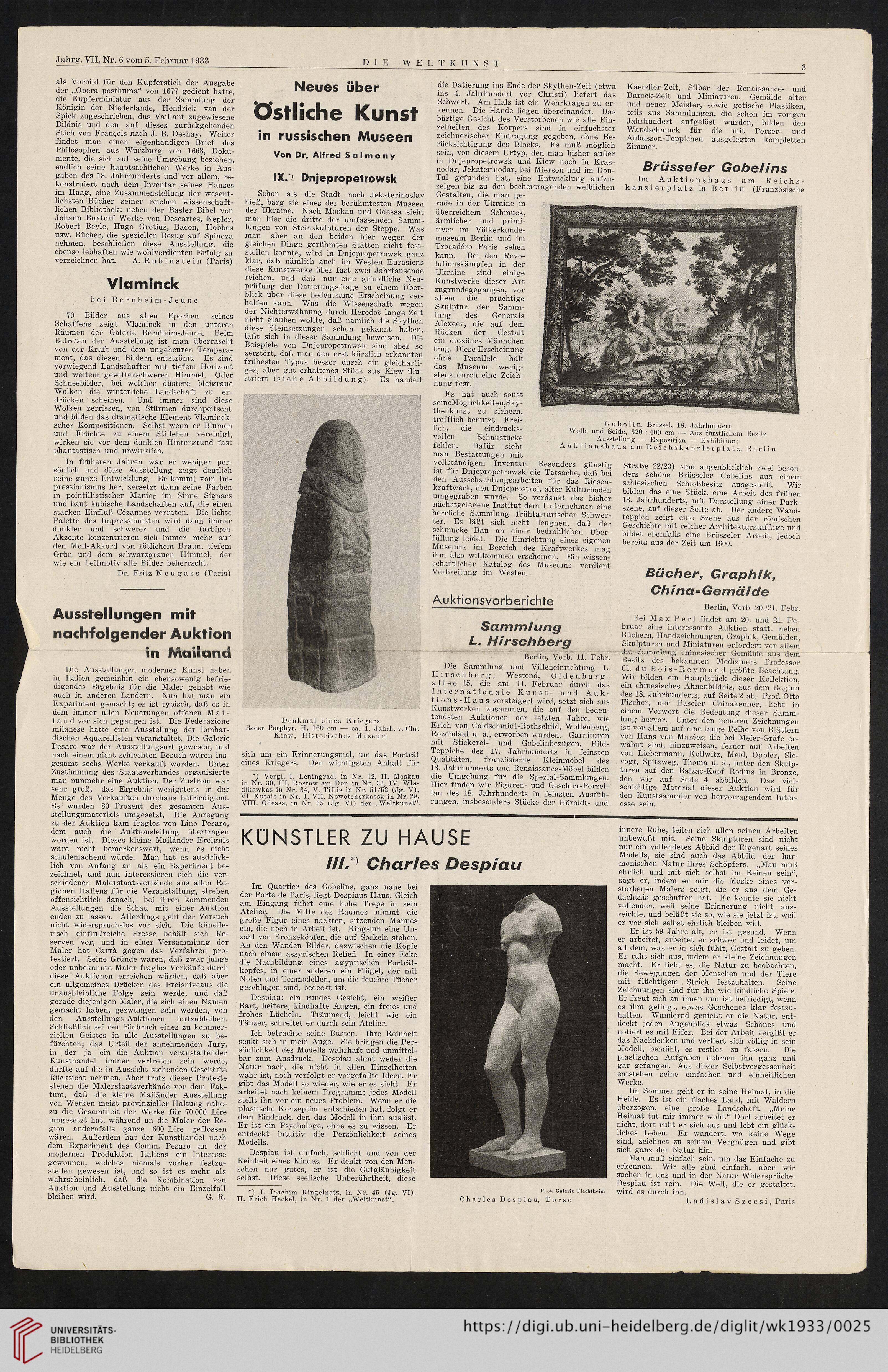Jahrg. VII, Nr. 6 vom 5. Februar 1933
DIE WELTKUNST
3
als Vorbild für den Kupferstich der Ausgabe
der „Opera posthuma“ von 1677 gedient hatte,
die Kupferminiatur aus der Sammlung der
Königin der Niederlande, Hendrick van der
Spick zugeschrieben, das Vaillant zugewiesene
Bildnis und den auf dieses zurückgehenden
Stich von Frangois nach J. B. Deshay. Weiter
findet man einen eigenhändigen Brief des
Philosophen aus Würzburg von 1663, Doku-
mente, die sich auf seine Umgebung beziehen,
endlich seine hauptsächlichen Werke in Aus-
gaben des 18. Jahrhunderts und vor allem, re-
konstruiert nach dem Inventar seines Hauses
im Haag, eine Zusammenstellung der wesent-
lichsten Bücher seiner reichen wissenschaft-
lichen Bibliothek: neben der Basler Bibel von
Johann Buxtorf Werke von Descartes, Kepler,
Robert Beyle, Hugo Grotius, Bacon, Hobbes
usw. Bücher, die speziellen Bezug auf Spinoza
nehmen, beschließen diese Ausstellung, die
ebenso lebhaften wie wohlverdienten Erfolg zu
verzeichnen hat. A. Rubinstein (Paris)
Vlaminck
bei Bernheim-Jeune
70 Bilder aus allen Epochen seines
Schaffens zeigt Vlaminck in den unteren
Räumen der Galerie Bernheim-Jeune. Beim
Betreten der Ausstellung ist man überrascht
von der Kraft und dem ungeheuren Tempera-
ment, das diesen Bildern entströmt. Es sind
vorwiegend Landschaften mit tiefem Horizont
und weitem gewitterschweren Himmel. Oder
Schneebilder, bei welchen düstere bleigraue
Wolken die winterliche Landschaft zu er-
drücken scheinen. Und immer sind diese
Wolken zerrissen, von Stürmen durchpeitscht
und bilden das dramatische Element Vlaminck-
scher Kompositionen. Selbst wenn er Blumen
und Früchte zu einem Stilleben vereinigt,
wirken sie vor dem dunklen Hintergrund fast
phantastisch und unwirklich.
In früheren Jahren war er weniger per-
sönlich und diese Ausstellung zeigt deutlich
seine ganze Entwicklung. Er kommt vom Im-
pressionismus. her, zersetzt dann seine Farben
in pointillistischer Manier im Sinne Signacs
und baut kubische Landschaften auf, die einen
starken Einfluß Cezannes verraten. Die lichte
Palette des Impressionisten wird dann immer
dunkler und schwerer und die farbigen
Akzente konzentrieren sich immer mehr auf
den Moll-Akkord von rötlichem Braun, tiefem
Grün und dem schwarzgrauen Himmel, der
wie ein Leitmotiv alle Bilder beherrscht.
Dr. Fritz Neugass (Paris)
Ausstellungen mit
nachfolgender Auktion
in Mailand
Die Ausstellungen moderner Kunst haben
in Italien gemeinhin ein ebensowenig befrie-
digendes Ergebnis für die Maler gehabt wie
auch in anderen Ländern. Nun hat man ein
Experiment gemacht; es ist typisch, daß es in
dem immer allen Neuerungen offenen Mai-
land vor sich gegangen ist. Die Federazione
milanese hatte eine Ausstellung der lombar-
dischen Aquarellisten veranstaltet. Die Galerie
Pesaro war der Ausstellungsort gewesen, und
nach einem nicht schlechten Besuch waren ins-
gesamt sechs Werke verkauft worden. Unter
Zustimmung des Staatsverbandes organisierte
man nunmehr eine Auktion. Der Zustrom war
sehr groß, das Ergebnis wenigstens in der
Menge des Verkauften durchaus befriedigend.
Es wurden 80 Prozent des gesamten Aus-
stellungsmaterials umgesetzt. Die Anregung
zu der Auktion kam fraglos von Lino Pesaro,
dem auch die Auktionsleitung übertragen
worden ist. Dieses kleine Mailänder- Ereignis
wäre nicht bemerkenswert, wenn es nicht
schulemachend würde. Man hat es ausdrück-
lich von Anfang an als ein Experiment be-
zeichnet, und nun interessieren sich die ver-
schiedenen Malerstaatsverbände aus allen Re-
gionen Italiens für die Veranstaltung, streben
offensichtlich danach, bei ihren kommenden
Ausstellungen die Schau mit einer Auktion
enden zu lassen. Allerdings geht der Versuch
nicht widerspruchslos vor sich. Die künstle-
risch einflußreiche Presse behält sich Re-
serven vor, und in einer Versammlung der
Maler hat Carrä gegen das Verfahren pro-
testiert. Seine Gründe waren, daß zwar junge
oder unbekannte Maler fraglos Verkäufe durch
diese Auktionen erreichen würden, daß aber
ein allgemeines Drücken des Preisniveaus die
unausbleibliche Folge sein werde, und daß
gerade diejenigen Maler, die sich einen Namen
gemacht haben, gezwungen sein werden, von
den Ausstellungs-Auktionen fortzubleiben.
Schließlich sei der Einbruch eines zu kommer-
ziellen Geistes in alle Ausstellungen zu be-
fürchten; das Urteil der annehmenden Jury,
in der ja ein die Auktion veranstaltender
Kunsthandel immer vertreten sein werde,
dürfte auf die in Aussicht stehenden Geschäfte
Rücksicht nehmen. Aber trotz dieser Proteste
stehen die Malerstaatsverbände vor dem Fak-
tum, daß die kleine Mailänder Ausstellung
von Werken meist provinzieller Haltung nahe-
zu die Gesamtheit der Werke für 70 000 Lire
umgesetzt hat, während an die Maler der Re-
gion andernfalls ganze 600 Lire geflossen
wären. Außerdem hat der Kunsthandel nach
dem Experiment des Comm. Pesaro an der
modernen Produktion Italiens ein Interesse
gewonnen, welches niemals vorher festzu-
stellen gewesen ist, und so ist es mehr als
wahrscheinlich, daß die Kombination von
Auktion und Ausstellung nicht ein Einzelfall
bleiben wird. G. R.
Neues über
östliche Kunst
in russischen Museen
Von Dr. Alfred Salmony
IX/> Dnjepropetrowsk
Schon als die Stadt noch Jekaterinoslav
hieß, barg sie eines der berühmtesten Museen
der Ukraine. Nach Moskau und Odessa sieht
man hier die dritte der umfassenden Samm-
lungen von Steinskulpturen der Steppe. Was
man aber an den beiden hier wegen der
gleichen Dinge gerühmten Stätten nicht fest-
stellen konnte, wird in Dnjepropetrowsk ganz
klar, daß nämlich auch im Westen Eurasiens
diese Kunstwerke über fast zwei Jahrtausende
reichen, und daß nur eine gründliche Neu-
prüfung der Datierungsfrage zu einem Über-
blick über diese bedeutsame Erscheinung ver-
helfen kann. Was die Wissenschaft wegen
der Nichterwähnung durch Herodot lange Zeit
nicht glauben wollte, daß nämlich die Skythen
diese Steinsetzungen schon gekannt haben,
läßt sich in dieser Sammlung beweisen. Die
Beispiele von Dnjepropetrowsk sind aber so
zerstört, daß man den erst kürzlich erkannten
frühesten Typus besser durch ein gleicharti-
ges, aber gut erhaltenes Stück aus Kiew illu-
striert (siehe Abbildung). Es handelt
Denkmal eines Kriegers
Roter Porphyr, H. 160 cm — ca. 4. Jahrh. v. Chr.
Kiew, Historisches Museum
sich um ein Erinnerungsmai, um das Porträt
eines Kriegers. Den wichtigsten Anhalt für
*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau
in Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wla-
dikawkas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52 (Jg. V),
VI. Kutais in Nr. 1, VII. Nowotcherkassk in Nr. 29,
VIII. Odessa, in Nr. 35 (Jg. VI) der „Weltkunst“.
die Datierung ins Ende der Skythen-Zeit (etwa
ins 4. Jahrhundert vor Christi) liefert das
Schwert. Am Hals ist ein Wehrkragen zu er-
kennen. Die Hände liegen übereinander. Das
bärtige Gesicht des Verstorbenen wie alle Ein-
zelheiten des Körpers sind in einfachster
zeichnerischer Eintragung gegeben, ohne Be-
rücksichtigung des Blocks. Es muß möglich
sein, von diesem Urtyp, den man bisher außer
in Dnjepropetrowsk und Kiew noch in Kras-
nodar, Jekaterinodar, bei Mierson und im Don-
Tal gefunden hat, eine Entwicklung aufzu-
Kaendler-Zeit, Silber der Renaissance- und
Barock-Zeit und Miniaturen. Gemälde alter
und neuer Meister, sowie gotische Plastiken,
teils aus Sammlungen, die schon im vorigen
Jahrhundert aufgelöst wurden, bilden den
Wandschmuck für die mit Perser- und
Aubusson-Teppichen ausgelegten kompletten
Zimmer.
Brüsseler Gobelins
Im Auktionshaus am Reichs-
kanzlerplatz in Berlin (Französische
Gobelin. Brüssel, 18. Jahrhundert
Wolle und Seide, 320 : 400 cm — Aus fürstlichem Besitz
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Auktionshaus am Reichskanzlerplatz, Berlin
zeigen bis zu den bechertragenden weiblichen
Gestalten, die man ge-
rade in der Ukraine in
überreichem Schmuck,
ärmlicher und primi-
tiver im Völkerkunde-
museum Berlin und im
Trocadero Paris sehen
kann. Bei den Revo-
lutionskämpfen in der
Ukraine sind einige
Kunstwerke dieser Art
zugrundegegangen, vor
allem die prächtige
Skulptur der Samm-
lung des Generals
Alexeev, die' auf dem
Rücken der Gestalt
ein obszönes Männchen
trug. Diese Erscheinung
ohne Parallele hält
das Museum wenig-
stens durch eine Zeich-
nung fest.
Es hat auch sonst
seineMöglichkeiten,Sky-
thenkunst zu sichern,
trefflich benutzt. Frei-
lich, die eindrucks-
vollen Schaustücke
fehlen. Dafür sieht
man Bestattungen mit
vollständigem Inventar. Besonders günstig
ist für Dnjepropetrowsk die Tatsache, daß bei
den Ausschachtungsarbeiten für das Riesen-
kraftwerk, den Dnjeprostroi, alter Kulturboden
umgegraben wurde. So verdankt das bisher
nächstgelegene Institut dem Unternehmen eine
herrliche Sammlung frühtartarischer Schwer-
ter. Es läßt sich nicht leugnen, daß der
schmucke Bau an einer bedrohlichen Über-
füllung leidet. Die Einrichtung eines eigenen
Museums im Bereich des Kraftwerkes mag
ihm also willkommen erscheinen. Ein wissen-
schaftlicher Katalog des Museums verdient
Verbreitung im Westen.
Straße 22/23) sind augenblicklich zwei beson-
ders schöne Brüsseler Gobelins aus einem
schlesischen Schloßbesitz ausgestellt. Wir
bilden das eine Stück, eine Arbeit des frühen
18. Jahrhunderts, mit Darstellung einer Park-
szene, auf dieser Seite ab. Der andere Wand-
teppich zeigt eine Szene aus der römischen
Geschichte mit reicher Architekturstaffage und
bildet ebenfalls eine Brüsseler Arbeit, jedoch
bereits aus der Zeit um 1600.
Bücher, Graphik,
Auktionsvorberichte
China-Gemälde
Berlin, Vorb. 20./21. Febr.
Sammlung
L. Hirschberg
Berlin, Vorb. 11. Febr.
Die Sammlung und Villeneinrichtung L.
Hirschberg, Westend, Oldenburg-
allee 15, die am 11. Februar durch das
Internationale Kunst- und Auk-
tions-Haus versteigert wird, setzt sich aus
Kunstwerken zusammen, die auf den bedeu-
tendsten Auktionen der letzten Jahre, wie
Erich von Goldschmidt-Rothschild, Wollenberg,
Rozendaal u. a., erworben wurden. Garnituren
mit Stickerei- und Gobelinbezügen, Bild-
Teppiche des 17. Jahrhunderts in feinsten
Qualitäten, französische Kleinmöbel des
18. Jahrhunderts und Renaissance-Möbel bilden
die Umgebung für die Spezial-Sammlungen.
Hier finden wir Figuren- und Geschirr-Porzel-
lan des 18. Jahrhunderts in feinsten Ausfüh-
rungen, insbesondere Stücke der Höroldt- und
Bei Max Perl findet am 20. und 21. Fe-
bruar eine interessante Auktion statt: neben
Büchern, Handzeichnungen, Graphik, Gemälden,
Skulpturen und Miniaturen erfordert vor allem
die- Sammlung chinesischer Gemälde aus dem
Besitz des bekannten Mediziners Professor
CI. du Bois-Reymond größte Beachtung.
Wir bilden ein Hauptstück dieser Kollektion,
ein chinesisches Ahnenbildnis, aus dem Beginn
des 18. Jahrhunderts, auf Seite 2 ab. Prof. Otto
Fischer, der Baseler1 Chinakenner, hebt in
einem Vorwort die Bedeutung dieser Samm-
lung hervor. Unter den neueren Zeichnungen
ist vor allem auf eine lange Reihe von Blättern
von Hans von Marees, die bei Meier-Gräfe er-
wähnt sind, hinzuweisen, ferner auf Arbeiten
von Liebermann, Kollwitz, Meid, Oppler, Sle-
vogt, Spitzweg, Thoma u. a., unter den Skulp-
turen auf den Balzac-Kopf Rodins in Bronze,
den wir auf Seite 4 abbilden. Das viel-
schichtige Material dieser Auktion wird für
den Kunstsammler von hervorragendem Inter-
esse sein.
KÜNSTLER ZU HAUSE
///.’ Charles Despiau
Im Quartier des Gobelins, ganz nahe bei
der Porte de Paris, liegt Despiaus Haus. Gleich
am Eingang führt eine hohe Trepe in sein
Atelier. Die Mitte des Raumes nimmt die
große Figur eines nackten, sitzenden Mannes
ein, die noch in Arbeit ist. Ringsum eine Un-
zahl von Bronzeköpfen, die auf Sockeln stehen.
An den Wänden Bilder, dazwischen die Kopie
nach einem assyrischen Relief. In einer Ecke
die Nachbildung eines ägyptischen Porträt-
kopfes, in einer anderen ein Flügel, der mit
Noten und Tonmodellen, um die feuchte Tücher
geschlagen sind, bedeckt ist.
Despiau: ein rundes Gesicht, ein weißer
Bart, heitere, kindhafte Augen, ein freies und
frohes Lächeln. Träumend, leicht wie ein
Tänzer, schreitet er durch sein Atelier.
Ich betrachte seine Büsten. Ihre Reinheit
senkt sich in mein Auge. Sie bringen die Per-
sönlichkeit des Modells wahrhaft und unmittel-
bar zum Ausdruck. Despiau ahmt weder die
Natur nach, die nicht in allen Einzelheiten
wahr ist, noch verfolgt er vorgefaßte Ideen. Er
gibt das Modell so wieder, wie er es sieht. Er
arbeitet nach keinem Programm; jedes Modell
stellt ihn vor ein neues Problem. Wenn er die
plastische Konzeption entschieden hat, folgt er
dem Eindruck, den das Modell in ihm auslöst.
Er ist ein Psychologe, ohne es zu wissen. Er
entdeckt intuitiv die Persönlichkeit seines
Modells.
Despiau ist einfach, schlicht und von der
Reinheit eines Kindes. Er denkt von den Men-
schen nur gutes, er ist die Gutgläubigkeit
selbst. Diese seelische Unberührtheit, diese
*) I. Joachim Ringelnatz, in Nr. 45 (Jg. VI).
II. Erich Heckel, in Nr. 1 der „Weltkunst“.
Phot. Galerie Flechtheim
Charles Despiau, Torso
innere Ruhe, teilen sich allen seinen Arbeiten
unbewußt mit. Seine Skulpturen sind nicht
nur ein vollendetes Abbild der Eigenart seines
Modells, sie sind auch das Abbild der har-
monischen Natur ihres Schöpfers. „Man muß
ehrlich und mit sich selbst im Reinen sein“,
sagt er, indem er mir die Maske eines ver-
storbenen Malers zeigt, die er aus dem Ge-
dächtnis geschaffen hat. Er konnte sie nicht
vollenden, weil seine Erinnerung nicht aus-
reichte, und beläßt sie so, wie sie jetzt ist, weil
er vor sich selbst ehrlich bleiben will.
Er ist 59 Jahre alt, er ist gesund. Wenn
er arbeitet, arbeitet er schwer und leidet, um
all dem, was er in sich fühlt, Gestalt zu geben.
Er ruht sich aus, indem er kleine Zeichnungen
macht. Er liebt es, die Natur zu beobachten,
die Bewegungen der Menschen und der Tiere
mit flüchtigem Strich festzuhalten. Seine
Zeichnungen sind für ihn wie kindliche Spiele.
Er freut sich an ihnen und ist befriedigt, wenn
es ihm gelingt, etwas Gesehenes klar festzu-
halten. Wandernd genießt er die Natur, ent-
deckt jeden Augenblick etwas Schönes und
notiert es mit Eifer. Bei der Arbeit vergißt er
das Nachdenken und verliert sich völlig in sein
Modell, bemüht, es restlos zu fassen. Die
plastischen Aufgaben nehmen ihn ganz und
gar gefangen. Aus dieser Selbstvergessenheit
entstehen seine einfachen und einheitlichen
Werke.
Im Sommer geht er in seine Heimat, in die
Heide. Es ist ein flaches Land, mit Wäldern
überzogen, eine große Landschaft. „Meine
Heimat tut mir immer wohl.“ Dort arbeitet er
nicht, dort ruht er sich aus und lebt ein glück-
liches Leben. Er wandert, wo keine Wege
sind, zeichnet zu seinem Vergnügen und gibt
sich ganz der Natur hin.
Man muß einfach sein, um das Einfache zu
erkennen. Wir alle sind einfach, aber wir
suchen in uns und in der Natur Widersprüche.
Despiau ist rein. Die Welt, die er gestaltet,
wird es durch ihn.
Ladislav Szecsi, Paris
DIE WELTKUNST
3
als Vorbild für den Kupferstich der Ausgabe
der „Opera posthuma“ von 1677 gedient hatte,
die Kupferminiatur aus der Sammlung der
Königin der Niederlande, Hendrick van der
Spick zugeschrieben, das Vaillant zugewiesene
Bildnis und den auf dieses zurückgehenden
Stich von Frangois nach J. B. Deshay. Weiter
findet man einen eigenhändigen Brief des
Philosophen aus Würzburg von 1663, Doku-
mente, die sich auf seine Umgebung beziehen,
endlich seine hauptsächlichen Werke in Aus-
gaben des 18. Jahrhunderts und vor allem, re-
konstruiert nach dem Inventar seines Hauses
im Haag, eine Zusammenstellung der wesent-
lichsten Bücher seiner reichen wissenschaft-
lichen Bibliothek: neben der Basler Bibel von
Johann Buxtorf Werke von Descartes, Kepler,
Robert Beyle, Hugo Grotius, Bacon, Hobbes
usw. Bücher, die speziellen Bezug auf Spinoza
nehmen, beschließen diese Ausstellung, die
ebenso lebhaften wie wohlverdienten Erfolg zu
verzeichnen hat. A. Rubinstein (Paris)
Vlaminck
bei Bernheim-Jeune
70 Bilder aus allen Epochen seines
Schaffens zeigt Vlaminck in den unteren
Räumen der Galerie Bernheim-Jeune. Beim
Betreten der Ausstellung ist man überrascht
von der Kraft und dem ungeheuren Tempera-
ment, das diesen Bildern entströmt. Es sind
vorwiegend Landschaften mit tiefem Horizont
und weitem gewitterschweren Himmel. Oder
Schneebilder, bei welchen düstere bleigraue
Wolken die winterliche Landschaft zu er-
drücken scheinen. Und immer sind diese
Wolken zerrissen, von Stürmen durchpeitscht
und bilden das dramatische Element Vlaminck-
scher Kompositionen. Selbst wenn er Blumen
und Früchte zu einem Stilleben vereinigt,
wirken sie vor dem dunklen Hintergrund fast
phantastisch und unwirklich.
In früheren Jahren war er weniger per-
sönlich und diese Ausstellung zeigt deutlich
seine ganze Entwicklung. Er kommt vom Im-
pressionismus. her, zersetzt dann seine Farben
in pointillistischer Manier im Sinne Signacs
und baut kubische Landschaften auf, die einen
starken Einfluß Cezannes verraten. Die lichte
Palette des Impressionisten wird dann immer
dunkler und schwerer und die farbigen
Akzente konzentrieren sich immer mehr auf
den Moll-Akkord von rötlichem Braun, tiefem
Grün und dem schwarzgrauen Himmel, der
wie ein Leitmotiv alle Bilder beherrscht.
Dr. Fritz Neugass (Paris)
Ausstellungen mit
nachfolgender Auktion
in Mailand
Die Ausstellungen moderner Kunst haben
in Italien gemeinhin ein ebensowenig befrie-
digendes Ergebnis für die Maler gehabt wie
auch in anderen Ländern. Nun hat man ein
Experiment gemacht; es ist typisch, daß es in
dem immer allen Neuerungen offenen Mai-
land vor sich gegangen ist. Die Federazione
milanese hatte eine Ausstellung der lombar-
dischen Aquarellisten veranstaltet. Die Galerie
Pesaro war der Ausstellungsort gewesen, und
nach einem nicht schlechten Besuch waren ins-
gesamt sechs Werke verkauft worden. Unter
Zustimmung des Staatsverbandes organisierte
man nunmehr eine Auktion. Der Zustrom war
sehr groß, das Ergebnis wenigstens in der
Menge des Verkauften durchaus befriedigend.
Es wurden 80 Prozent des gesamten Aus-
stellungsmaterials umgesetzt. Die Anregung
zu der Auktion kam fraglos von Lino Pesaro,
dem auch die Auktionsleitung übertragen
worden ist. Dieses kleine Mailänder- Ereignis
wäre nicht bemerkenswert, wenn es nicht
schulemachend würde. Man hat es ausdrück-
lich von Anfang an als ein Experiment be-
zeichnet, und nun interessieren sich die ver-
schiedenen Malerstaatsverbände aus allen Re-
gionen Italiens für die Veranstaltung, streben
offensichtlich danach, bei ihren kommenden
Ausstellungen die Schau mit einer Auktion
enden zu lassen. Allerdings geht der Versuch
nicht widerspruchslos vor sich. Die künstle-
risch einflußreiche Presse behält sich Re-
serven vor, und in einer Versammlung der
Maler hat Carrä gegen das Verfahren pro-
testiert. Seine Gründe waren, daß zwar junge
oder unbekannte Maler fraglos Verkäufe durch
diese Auktionen erreichen würden, daß aber
ein allgemeines Drücken des Preisniveaus die
unausbleibliche Folge sein werde, und daß
gerade diejenigen Maler, die sich einen Namen
gemacht haben, gezwungen sein werden, von
den Ausstellungs-Auktionen fortzubleiben.
Schließlich sei der Einbruch eines zu kommer-
ziellen Geistes in alle Ausstellungen zu be-
fürchten; das Urteil der annehmenden Jury,
in der ja ein die Auktion veranstaltender
Kunsthandel immer vertreten sein werde,
dürfte auf die in Aussicht stehenden Geschäfte
Rücksicht nehmen. Aber trotz dieser Proteste
stehen die Malerstaatsverbände vor dem Fak-
tum, daß die kleine Mailänder Ausstellung
von Werken meist provinzieller Haltung nahe-
zu die Gesamtheit der Werke für 70 000 Lire
umgesetzt hat, während an die Maler der Re-
gion andernfalls ganze 600 Lire geflossen
wären. Außerdem hat der Kunsthandel nach
dem Experiment des Comm. Pesaro an der
modernen Produktion Italiens ein Interesse
gewonnen, welches niemals vorher festzu-
stellen gewesen ist, und so ist es mehr als
wahrscheinlich, daß die Kombination von
Auktion und Ausstellung nicht ein Einzelfall
bleiben wird. G. R.
Neues über
östliche Kunst
in russischen Museen
Von Dr. Alfred Salmony
IX/> Dnjepropetrowsk
Schon als die Stadt noch Jekaterinoslav
hieß, barg sie eines der berühmtesten Museen
der Ukraine. Nach Moskau und Odessa sieht
man hier die dritte der umfassenden Samm-
lungen von Steinskulpturen der Steppe. Was
man aber an den beiden hier wegen der
gleichen Dinge gerühmten Stätten nicht fest-
stellen konnte, wird in Dnjepropetrowsk ganz
klar, daß nämlich auch im Westen Eurasiens
diese Kunstwerke über fast zwei Jahrtausende
reichen, und daß nur eine gründliche Neu-
prüfung der Datierungsfrage zu einem Über-
blick über diese bedeutsame Erscheinung ver-
helfen kann. Was die Wissenschaft wegen
der Nichterwähnung durch Herodot lange Zeit
nicht glauben wollte, daß nämlich die Skythen
diese Steinsetzungen schon gekannt haben,
läßt sich in dieser Sammlung beweisen. Die
Beispiele von Dnjepropetrowsk sind aber so
zerstört, daß man den erst kürzlich erkannten
frühesten Typus besser durch ein gleicharti-
ges, aber gut erhaltenes Stück aus Kiew illu-
striert (siehe Abbildung). Es handelt
Denkmal eines Kriegers
Roter Porphyr, H. 160 cm — ca. 4. Jahrh. v. Chr.
Kiew, Historisches Museum
sich um ein Erinnerungsmai, um das Porträt
eines Kriegers. Den wichtigsten Anhalt für
*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau
in Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wla-
dikawkas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52 (Jg. V),
VI. Kutais in Nr. 1, VII. Nowotcherkassk in Nr. 29,
VIII. Odessa, in Nr. 35 (Jg. VI) der „Weltkunst“.
die Datierung ins Ende der Skythen-Zeit (etwa
ins 4. Jahrhundert vor Christi) liefert das
Schwert. Am Hals ist ein Wehrkragen zu er-
kennen. Die Hände liegen übereinander. Das
bärtige Gesicht des Verstorbenen wie alle Ein-
zelheiten des Körpers sind in einfachster
zeichnerischer Eintragung gegeben, ohne Be-
rücksichtigung des Blocks. Es muß möglich
sein, von diesem Urtyp, den man bisher außer
in Dnjepropetrowsk und Kiew noch in Kras-
nodar, Jekaterinodar, bei Mierson und im Don-
Tal gefunden hat, eine Entwicklung aufzu-
Kaendler-Zeit, Silber der Renaissance- und
Barock-Zeit und Miniaturen. Gemälde alter
und neuer Meister, sowie gotische Plastiken,
teils aus Sammlungen, die schon im vorigen
Jahrhundert aufgelöst wurden, bilden den
Wandschmuck für die mit Perser- und
Aubusson-Teppichen ausgelegten kompletten
Zimmer.
Brüsseler Gobelins
Im Auktionshaus am Reichs-
kanzlerplatz in Berlin (Französische
Gobelin. Brüssel, 18. Jahrhundert
Wolle und Seide, 320 : 400 cm — Aus fürstlichem Besitz
Ausstellung — Exposition — Exhibition:
Auktionshaus am Reichskanzlerplatz, Berlin
zeigen bis zu den bechertragenden weiblichen
Gestalten, die man ge-
rade in der Ukraine in
überreichem Schmuck,
ärmlicher und primi-
tiver im Völkerkunde-
museum Berlin und im
Trocadero Paris sehen
kann. Bei den Revo-
lutionskämpfen in der
Ukraine sind einige
Kunstwerke dieser Art
zugrundegegangen, vor
allem die prächtige
Skulptur der Samm-
lung des Generals
Alexeev, die' auf dem
Rücken der Gestalt
ein obszönes Männchen
trug. Diese Erscheinung
ohne Parallele hält
das Museum wenig-
stens durch eine Zeich-
nung fest.
Es hat auch sonst
seineMöglichkeiten,Sky-
thenkunst zu sichern,
trefflich benutzt. Frei-
lich, die eindrucks-
vollen Schaustücke
fehlen. Dafür sieht
man Bestattungen mit
vollständigem Inventar. Besonders günstig
ist für Dnjepropetrowsk die Tatsache, daß bei
den Ausschachtungsarbeiten für das Riesen-
kraftwerk, den Dnjeprostroi, alter Kulturboden
umgegraben wurde. So verdankt das bisher
nächstgelegene Institut dem Unternehmen eine
herrliche Sammlung frühtartarischer Schwer-
ter. Es läßt sich nicht leugnen, daß der
schmucke Bau an einer bedrohlichen Über-
füllung leidet. Die Einrichtung eines eigenen
Museums im Bereich des Kraftwerkes mag
ihm also willkommen erscheinen. Ein wissen-
schaftlicher Katalog des Museums verdient
Verbreitung im Westen.
Straße 22/23) sind augenblicklich zwei beson-
ders schöne Brüsseler Gobelins aus einem
schlesischen Schloßbesitz ausgestellt. Wir
bilden das eine Stück, eine Arbeit des frühen
18. Jahrhunderts, mit Darstellung einer Park-
szene, auf dieser Seite ab. Der andere Wand-
teppich zeigt eine Szene aus der römischen
Geschichte mit reicher Architekturstaffage und
bildet ebenfalls eine Brüsseler Arbeit, jedoch
bereits aus der Zeit um 1600.
Bücher, Graphik,
Auktionsvorberichte
China-Gemälde
Berlin, Vorb. 20./21. Febr.
Sammlung
L. Hirschberg
Berlin, Vorb. 11. Febr.
Die Sammlung und Villeneinrichtung L.
Hirschberg, Westend, Oldenburg-
allee 15, die am 11. Februar durch das
Internationale Kunst- und Auk-
tions-Haus versteigert wird, setzt sich aus
Kunstwerken zusammen, die auf den bedeu-
tendsten Auktionen der letzten Jahre, wie
Erich von Goldschmidt-Rothschild, Wollenberg,
Rozendaal u. a., erworben wurden. Garnituren
mit Stickerei- und Gobelinbezügen, Bild-
Teppiche des 17. Jahrhunderts in feinsten
Qualitäten, französische Kleinmöbel des
18. Jahrhunderts und Renaissance-Möbel bilden
die Umgebung für die Spezial-Sammlungen.
Hier finden wir Figuren- und Geschirr-Porzel-
lan des 18. Jahrhunderts in feinsten Ausfüh-
rungen, insbesondere Stücke der Höroldt- und
Bei Max Perl findet am 20. und 21. Fe-
bruar eine interessante Auktion statt: neben
Büchern, Handzeichnungen, Graphik, Gemälden,
Skulpturen und Miniaturen erfordert vor allem
die- Sammlung chinesischer Gemälde aus dem
Besitz des bekannten Mediziners Professor
CI. du Bois-Reymond größte Beachtung.
Wir bilden ein Hauptstück dieser Kollektion,
ein chinesisches Ahnenbildnis, aus dem Beginn
des 18. Jahrhunderts, auf Seite 2 ab. Prof. Otto
Fischer, der Baseler1 Chinakenner, hebt in
einem Vorwort die Bedeutung dieser Samm-
lung hervor. Unter den neueren Zeichnungen
ist vor allem auf eine lange Reihe von Blättern
von Hans von Marees, die bei Meier-Gräfe er-
wähnt sind, hinzuweisen, ferner auf Arbeiten
von Liebermann, Kollwitz, Meid, Oppler, Sle-
vogt, Spitzweg, Thoma u. a., unter den Skulp-
turen auf den Balzac-Kopf Rodins in Bronze,
den wir auf Seite 4 abbilden. Das viel-
schichtige Material dieser Auktion wird für
den Kunstsammler von hervorragendem Inter-
esse sein.
KÜNSTLER ZU HAUSE
///.’ Charles Despiau
Im Quartier des Gobelins, ganz nahe bei
der Porte de Paris, liegt Despiaus Haus. Gleich
am Eingang führt eine hohe Trepe in sein
Atelier. Die Mitte des Raumes nimmt die
große Figur eines nackten, sitzenden Mannes
ein, die noch in Arbeit ist. Ringsum eine Un-
zahl von Bronzeköpfen, die auf Sockeln stehen.
An den Wänden Bilder, dazwischen die Kopie
nach einem assyrischen Relief. In einer Ecke
die Nachbildung eines ägyptischen Porträt-
kopfes, in einer anderen ein Flügel, der mit
Noten und Tonmodellen, um die feuchte Tücher
geschlagen sind, bedeckt ist.
Despiau: ein rundes Gesicht, ein weißer
Bart, heitere, kindhafte Augen, ein freies und
frohes Lächeln. Träumend, leicht wie ein
Tänzer, schreitet er durch sein Atelier.
Ich betrachte seine Büsten. Ihre Reinheit
senkt sich in mein Auge. Sie bringen die Per-
sönlichkeit des Modells wahrhaft und unmittel-
bar zum Ausdruck. Despiau ahmt weder die
Natur nach, die nicht in allen Einzelheiten
wahr ist, noch verfolgt er vorgefaßte Ideen. Er
gibt das Modell so wieder, wie er es sieht. Er
arbeitet nach keinem Programm; jedes Modell
stellt ihn vor ein neues Problem. Wenn er die
plastische Konzeption entschieden hat, folgt er
dem Eindruck, den das Modell in ihm auslöst.
Er ist ein Psychologe, ohne es zu wissen. Er
entdeckt intuitiv die Persönlichkeit seines
Modells.
Despiau ist einfach, schlicht und von der
Reinheit eines Kindes. Er denkt von den Men-
schen nur gutes, er ist die Gutgläubigkeit
selbst. Diese seelische Unberührtheit, diese
*) I. Joachim Ringelnatz, in Nr. 45 (Jg. VI).
II. Erich Heckel, in Nr. 1 der „Weltkunst“.
Phot. Galerie Flechtheim
Charles Despiau, Torso
innere Ruhe, teilen sich allen seinen Arbeiten
unbewußt mit. Seine Skulpturen sind nicht
nur ein vollendetes Abbild der Eigenart seines
Modells, sie sind auch das Abbild der har-
monischen Natur ihres Schöpfers. „Man muß
ehrlich und mit sich selbst im Reinen sein“,
sagt er, indem er mir die Maske eines ver-
storbenen Malers zeigt, die er aus dem Ge-
dächtnis geschaffen hat. Er konnte sie nicht
vollenden, weil seine Erinnerung nicht aus-
reichte, und beläßt sie so, wie sie jetzt ist, weil
er vor sich selbst ehrlich bleiben will.
Er ist 59 Jahre alt, er ist gesund. Wenn
er arbeitet, arbeitet er schwer und leidet, um
all dem, was er in sich fühlt, Gestalt zu geben.
Er ruht sich aus, indem er kleine Zeichnungen
macht. Er liebt es, die Natur zu beobachten,
die Bewegungen der Menschen und der Tiere
mit flüchtigem Strich festzuhalten. Seine
Zeichnungen sind für ihn wie kindliche Spiele.
Er freut sich an ihnen und ist befriedigt, wenn
es ihm gelingt, etwas Gesehenes klar festzu-
halten. Wandernd genießt er die Natur, ent-
deckt jeden Augenblick etwas Schönes und
notiert es mit Eifer. Bei der Arbeit vergißt er
das Nachdenken und verliert sich völlig in sein
Modell, bemüht, es restlos zu fassen. Die
plastischen Aufgaben nehmen ihn ganz und
gar gefangen. Aus dieser Selbstvergessenheit
entstehen seine einfachen und einheitlichen
Werke.
Im Sommer geht er in seine Heimat, in die
Heide. Es ist ein flaches Land, mit Wäldern
überzogen, eine große Landschaft. „Meine
Heimat tut mir immer wohl.“ Dort arbeitet er
nicht, dort ruht er sich aus und lebt ein glück-
liches Leben. Er wandert, wo keine Wege
sind, zeichnet zu seinem Vergnügen und gibt
sich ganz der Natur hin.
Man muß einfach sein, um das Einfache zu
erkennen. Wir alle sind einfach, aber wir
suchen in uns und in der Natur Widersprüche.
Despiau ist rein. Die Welt, die er gestaltet,
wird es durch ihn.
Ladislav Szecsi, Paris