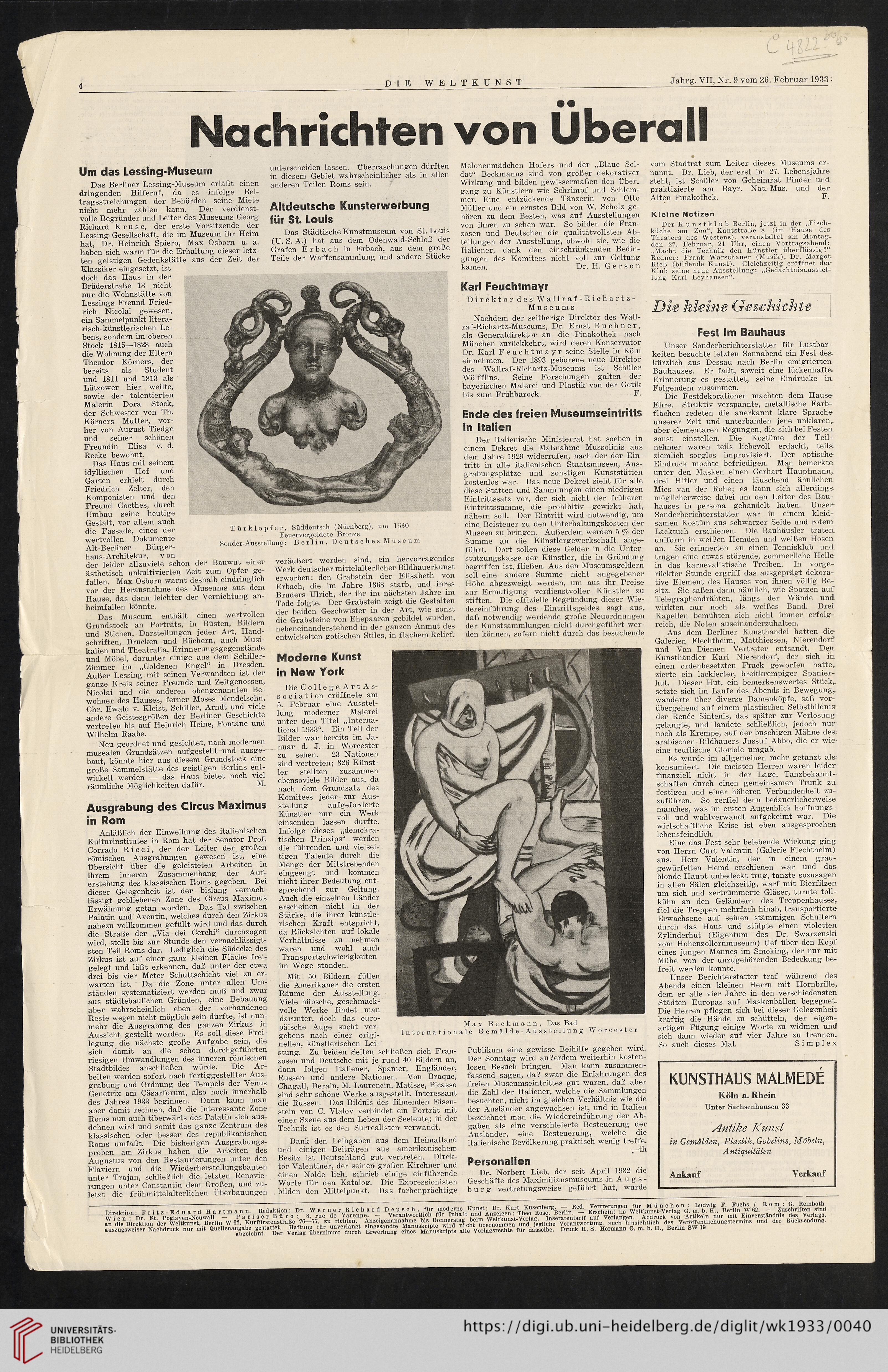4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 9 vom 26. Februar 1933 '•
• •
Nachrichten von Überall
Um das Lessing-Museum
Das Berliner Lessing-Museum erläßt einen
dringenden Hilferuf, da es infolge Bei-
tragsstreichungen der Behörden seine Miete
nicht mehr zahlen kann. Der verdienst-
volle Begründer und Leiter des Museums Georg
Richard Kruse, der erste Vorsitzende der
Lessing-Gesellschaft, die im Museum ihr Heim
hat, Dr. Heinrich Spiero, Max Osborn u. a.
haben sich warm für die Erhaltung dieser letz-
ten geistigen Gedenkstätte aus der Zeit der
Klassiker eingesetzt, ist
unterscheiden lassen. Überraschungen dürften
in diesem Gebiet wahrscheinlicher als in allen
anderen Teilen Roms sein.
Altdeutsche Kunsterwerbung
für St. Louis
Das Städtische Kunstmuseum von St. Louis
(U. S. A.) hat aus dem Odenwald-Schloß der
Grafen Erbach in Erbach, aus dem große
Teile der Waffensammlung und andere Stücke
Melonenmädchen Hofers und der „Blaue Sol-
dat“ Beckmanns sind von großer dekorativer
Wirkung und bilden gewissermaßen den Über-
gang zu Künstlern wie Schrimpf und Schlem-
mer. Eine entzückende Tänzerin von Otto
Müller und ein ernstes Bild von W. Scholz ge-
hören zu dem Besten, was auf Ausstellungen
von ihnen zu sehen war. So bilden die Fran-
zosen und Deutschen die qualitätvollsten Ab-
teilungen der Ausstellung, obwohl sie, wie die
Italiener, dank den einschränkenden Bedin-
gungen des Komitees nicht voll zur Geltung
kamen. Dr. H. Gerson
Tür klopf er, Süddeutsch (Nürnberg), um 1530
Feuervergoldete Bronze
Sonder-Ausstellung: Berlin, Deutsches Museum
doch das Haus in der
Brüderstraße 13 nicht
nur die Wohnstätte von
Lessings Freund Fried-
rich Nicolai gewesen,
ein Sammelpunkt litera-
risch-künstlerischen Le-
bens, sondern im oberen
Stock 1815—1828 auch
die Wohnung der Eltern
Theodor Körners, der
bereits als Student
und 1811 und 1813 als
Lützower hier weilte,
sowie der talentierten
Malerin Dora Stock,
der Schwester von Th.
Körners Mutter, vor-
her von August Tiedge
und seiner schönen
Freundin Elisa v. d.
Recke bewohnt.
Das Haus mit seinem
idyllischen Hof und
Garten erhielt durch
Friedrich Zelter, den
Komponisten und den
Freund Goethes, durch
Umbau seine heutige
Gestalt, vor allem auch
die Fassade, eines der
wertvollen Dokumente
Alt-Berliner Bürger-
haus-Architekur, v on
der leider allzuviele schon der Bauwut einer
ästhetisch unkultivierten Zeit zum Opfer ge-
fallen. Max Osborn warnt deshalb eindringlich
vor der Herausnahme des Museums aus dem
Hause, das dann leichter der Vernichtung an-
heimfallen könnte.
Das Museum enthält einen wertvollen
Grundstock an Porträts, in Büsten, Bildern
und Stichen, Darstellungen jeder Art, Hand-
schriften, Drucken und Büchern, auch Musi-
kalien und Theatralia, Erinnerungsgegenstände
und Möbel, darunter einige aus dem Schiller-
Zimmer im „Goldenen Engel“ in Dresden.
Außer Lessing mit seinen Verwandten ist der
ganze Kreis seiner Freunde und Zeitgenossen,
Nicolai und die anderen obengenannten Be-
wohner des Hauses, ferner Moses Mendelsohn,
Chr. Ewald v. Kleist, Schiller, Arndt und viele
andere Geistesgrößen der Berliner Geschichte
vertreten bis auf Heinrich Heine, Fontane und
Wilhelm Raabe.
Neu geordnet und gesichtet, nach modernen
musealen Grundsätzen aufgestellt und ausge-
baut, könnte hier aus diesem Grundstock eine
große Sammelstätte des geistigen Berlins ent-
wickelt werden — das Haus bietet noch viel
räumliche Möglichkeiten dafür. M.
Ausgrabung des Circus Maximus
in Rom
Anläßlich der Einweihung des italienischen
Kulturinstitutes in Rom hat der Senator Prof.
Corrado Ricci, der der Leiter der großen
römischen Ausgrabungen gewesen ist, eine
Übersicht über die geleisteten Arbeiten in
ihrem inneren Zusammenhang der Auf-
erstehung des klassischen Roms gegeben. Bei
dieser Gelegenheit ist der bislang vernach-
lässigt gebliebenen Zone des Circus Maximus
Erwähnung getan worden. Das Tal zwischen
Palatin und Aventin, welches durch den Zirkus
nahezu vollkommen gefüllt wird und das durch
die Straße der „Via dei Cerchi“ durchzogen
wird, stellt bis zur Stunde den vernachlässigt-
sten Teil Roms dar. Lediglich die Südecke des
Zirkus ist auf einer ganz kleinen Fläche frei-
gelegt und läßt erkennen, daß unter der etwa
drei bis vier Meter Schuttschicht viel zu er-
warten ist. Da die Zone unter allen Um-
ständen systematisiert werden muß und zwar
aus städtebaulichen Gründen, eine Bebauung
aber wahrscheinlich eben der vorhandenen
Reste wegen nicht möglich sein dürfte, ist nun-
mehr die Ausgrabung des ganzen Zirkus in
Aussicht gestellt worden. Es soll diese Frei-
legung die nächste große Aufgabe sein, die
sich damit an die schon durchgeführten
riesigen Umwandlungen des inneren römischen
Stadtbildes anschließen würde. Die Ar-
beiten werden sofort nach fertiggestellter Aus-
grabung und Ordnung des Tempels der Venus
Genetrix am Cäsarforum, also noch innerhalb
des Jahres 1933 beginnen. Dann kann man
aber damit rechnen, daß die interessante Zone
Roms nun auch tiberwärts des Palatin sich aus-
dehnen wird und somit das ganze Zentrum des
klassischen oder besser des republikanischen
Roms umfaßt. Die bisherigen Ausgrabungs-
proben am Zirkus haben die Arbeiten des
Augustus von den Restaurierungen unter den
Flaviern und die Wiederherstellungsbauten
unter Trajan, schließlich die letzten Renovie-
rungen unter Constantin dem Großen, und zu-
letzt die frühmittelalterlichen Überbauungen
veräußert worden sind, ein hervorragendes
Werk deutscher mittelalterlicher Bildhauerkunst
erworben: den Grabstein der Elisabeth von
Erbach, die im Jahre 1368 starb, und ihres
Bruders Ulrich, der ihr im nächsten Jahre im
Tode folgte. Der Grabstein zeigt die Gestalten
der beiden Geschwister in der Art, wie sonst
die Grabsteine von Ehepaaren gebildet wurden,
nebeneinanderstehend in der ganzen Anmut des
entwickelten gotischen Stiles, in flachem Relief.
Moderne Kunst
in New York
Die CollegeArtAs-
s o c i a t i on eröffnete am
5. Februar eine Ausstel-
lung moderner Malerei
unter dem Titel „Interna-
tional 1933“. Ein Teil der
Bilder war bereits im Ja-
nuar d. J. in Worcester
zu sehen. 23 Nationen
sind vertreten; 326 Künst-
ler stellten zusammen
ebensoviele Bilder aus, da
nach dem Grundsatz des
Komitees jeder zur Aus-
stellung aufgeforderte
Künstler nur ein Werk
einsenden lassen durfte.
Infolge dieses „demokra-
tischen Prinzips“ werden
die führenden und vielsei-
tigen Talente durch die
Menge der Mitstrebenden
eingeengt und kommen
nicht ihrer Bedeutung ent-
sprechend zur Geltung.
Auch die einzelnen Länder
erscheinen nicht in der
Stärke, die ihrer künstle-
rischen Kraft entspricht,
da Rücksichten auf lokale
Verhältnisse zu nehmen
waren und wohl auch
Transportschwierigkeiten
im Wege standen.
Mit 50 Bildern füllen
die Amerikaner die ersten
Räume der Ausstellung.
Viele hübsche, geschmack-
volle Werke findet man
darunter, doch das euro-
päische Auge sucht ver-
gebens nach einer origi-
nellen, künstlerischen Lei-
stung. Zu beiden Seiten schließen sich Fran-
zosen und Deutsche mit je rund 40 Bildern an,
dann folgen Italiener, Spanier, Engländer,
Russen und andere Nationen. Von Braque,
Chagall, Derain, M. Laurencin, Matisse, Picasso
sind sehr schöne Werke ausgestellt. Interessant
die Russen. Das Bildnis des filmenden Eisen-
stein von C. Vlalov verbindet ein Porträt mit
einer Szene aus dem Leben der Seeleute; in der
Technik ist es den Surrealisten verwandt.
Dank den Leihgaben aus dem Heimatland
und einigen Beiträgen aus amerikanischem
Besitz ist Deutschland gut vertreten. Direk-
tor Valentiner, der seinen großen Kirchner und
einen Nolde lieh, schrieb einige einführende
Worte für den Katalog. Die Expressionisten
bilden den Mittelpunkt. Das farbenprächtige
Karl Feuchtmayr
Direktor des Wallraf-Richartz-
Museums
Nachdem der seitherige Direktor des Wall-
raf-Richartz-Museums, Dr. Ernst Buchner,
als Generaldirektor an die Pinakothek nach
München zurückkehrt, wird deren Konservator
Dr. Karl Feuchtmayr seine Stelle in Köln
einnehmen. Der 1893 geborene neue Direktor
des Wallraf-Richartz-Museums ist Schüler
Wölf f lins. Seine Forschungen galten der
bayerischen Malerei und Plastik von der Gotik
bis zum Frühbarock. F.
Ende des freien Museumseintritts
in Italien
Der italienische Ministerrat hat soeben in
einem Dekret die Maßnahme Mussolinis aus
dem Jahre 1929 widerrufen, nach der der Ein-
tritt in alle italienischen Staatsmuseen, Aus-
grabungsplätze und sonstigen Kunststätten
kostenlos war. Das neue Dekret sieht für alle
diese Stätten und Sammlungen einen niedrigen
Eintrittssatz vor, der sich nicht der früheren
Eintrittssumme, die prohibitiv gewirkt hat,
nähern soll. Der Eintritt wird notwendig, um
eine Beisteuer zu den Unterhaltungskosten der
Museen zu bringen. Außerdem werden 5 % der
Summe an die Künstlergewerkschaft abge-
führt. Dort sollen diese Gelder in die Unter-
stützungskasse der Künstler, die in Gründung
begriffen ist, fließen. Aus den Museumsgeldern
soll eine andere Summe nicht angegebener
Höhe abgezweigt werden, um aus ihr Preise
zur Ermutigung verdienstvoller Künstler zu
stiften. Die offizielle Begründung dieser Wie-
dereinführung des Eintrittsgeldes sagt aus,
daß notwendig werdende große Neuordnungen
der Kunstsammlungen nicht durchgeführt wer-
den können, sofern nicht durch das besuchende
Publikum eine gewisse Beihilfe gegeben wird.
Der Sonntag wird außerdem weiterhin kosten-
losen Besuch bringen. Man kann zusammen-
fassend sagen, daß zwar die Erfahrungen des
freien Museumseintrittes gut waren, daß aber
die Zahl der Italiener, welche die Sammlungen
besuchten, nicht im gleichen Verhältnis wie die
der Ausländer angewachsen ist, und in Italien
bezeichnet man die Wiedereinführung der Ab-
gaben als eine verschleierte Besteuerung der
Ausländer, eine Besteuerung, welche die
italienische Bevölkerung praktisch wenig treffe.
—th
Personalien
Dr. Norbert Lieb, der seit April 1932 die
Geschäfte des Maximiliansmuseums in Augs-
burg vertretungsweise geführt hat, wurde
Max Beckmann, Das Bad
Internationale Gemälde-Ausstellung Worcester
vom Stadtrat zum Leiter dieses Museums er-
nannt. Dr. Lieb, der erst im 27. Lebensjahre
steht, ist Schüler von Geheimrat Pinder und.
praktizierte am Bayr. Nat.-Mus. und der
Alten Pinakothek. F.
Kleine Notizen
Der Kunstklub Berlin, jetzt in der „Fisch-
küche am Zoo“, Kantstraße 8 (im Hause des
Theaters des Westens), veranstaltet am Mcntag-
den 27. Februar, 21 Uhr, einen Vortragsabend:
„Macht die Technik den Künstler überflüssig?“
Redner: Frank Warschauer (Musik), Dr. Margot
Rieß (bildende Kunst). Gleichzeitig eröffnet der
Klub seine neue Ausstellung: „Gedächtnisausstel-
lung Karl Leyhausen“.
Die kleine Geschichte
Fest im Bauhaus
Unser Sonderberichterstatter für Lustbar-
keiten besuchte letzten Sonnabend ein Fest des
kürzlich aus Dessau nach Berlin emigrierten
Bauhauses. Er faßt, soweit eine lückenhaftem
Erinnerung es gestattet, seine Eindrücke in
Folgendem zusammen.
Die Festdekorationen machten dem Hause
Ehre. Struktiv verspannte, metallische Farb-
flächen redeten die anerkannt klare Sprache
unserer Zeit und unterbanden jene unklaren,,
aber elementaren Regungen, die sich bei Festen
sonst einstellen. Die Kostüme der Teil-
nehmer waren teils liebevoll erdacht, teils,
ziemlich sorglos improvisiert. Der optische
Eindruck mochte befriedigen. Man bemerkte
unter den Masken einen Gerhart Hauptmann,
drei Hitler und einen täuschend ähnlichen
Mies van der Rohe; es kann sich allerdings
möglicherweise dabei um den Leiter des Bau-
hauses in persona gehandelt haben. Unser
Sonderberichterstatter war in einem kleid-
samen Kostüm aus schwarzer Seide und rotem.
Lacktuch erschienen. Die Bauhäusler traten
uniform in weißen Hemden und weißen Hosen
an. Sie erinnerten an einen Tennisklub und
trugen eine etwas störende, sommerliche Helle
in das karnevalistische Treiben. In vorge-
rückter Stunde ergriff das ausgeprägt dekora-
tive Element des Hauses von ihnen völlig Be-
sitz. Sie saßen dann nämlich, wie Spatzen auf
Telegraphendrähten, längs der Wände und
wirkten nur noch als weißes Band. Drei
Kapellen bemühten sich nicht immer erfolg-
reich, die Noten auseinanderzuhalten.
Aus dem Berliner Kunsthandel hatten die
Galerien Flechtheim, Matthiessen, Nierendorf
und Van Diemen Vertreter entsandt. Den
Kunsthändler Karl Nierendorf, der sich in
einen ordenbesetzten Frack geworfen hatte,
zierte ein lackierter, breitkrempiger Spanier-
hut. Dieser Hut, ein bemerkenswertes Stück,
setzte sich im Laufe des Abends in Bewegung,
wanderte über diverse Damenköpfe, saß vor-
übergehend auf einem plastischen Selbstbildnis-,
der Renee Sintenis, das später zur Verlosung
gelangte, und landete schließlich, jedoch nur-
noch als Krempe, auf der buschigen Mähne des.
arabischen Bildhauers Jussuf Abbo, die er wie-
eine teuflische Gloriole umgab.
Es wurde im allgemeinen mehr getanzt als;
konsumiert. Die meisten Herren waren leider-
finanziell nicht in der Lage, Tanzbekannt-
schaften durch einen gemeinsamen Trunk zu
festigen und einer höheren Verbundenheit zu-
zuführen. So zerfiel denn bedauerlicherweise
manches, was im ersten Augenblick hoffnungs-
voll und wahlverwandt aufgekeimt war. Die
wirtschaftliche Krise ist eben ausgesprochen
lebensfeindlich.
Eine das Fest sehr belebende Wirkung ging
von Herrn Curt Valentin (Galerie Flechtheim)
aus. Herr Valentin, der in einem grau-
gewürfelten Hemd erschienen war und das
blonde Haupt unbedeckt trug, tanzte sozusagen
in allen Sälen gleichzeitig, warf mit Bierfilzen
um sich und zertrümmerte Gläser, turnte toll-
kühn an den Geländern des Treppenhauses,
fiel die Treppen mehrfach hinab, transportierte
Erwachsene auf seinen stämmigen Schultern
durch das Haus und stülpte einen violetten
Zylinderhut (Eigentum des Dr. Swarzenski
vom Hohenzollernmuseum) tief über den Kopf
eines jungen Mannes im Smoking, der nur mit
Mühe von der unzugehörenden Bedeckung be-
freit werden konnte.
Unser Berichterstatter traf während des
Abends einen kleinen Herrn mit Hornbrille,
dem er alle vier Jahre in den verschiedensten
Städten Europas auf Maskenbällen begegnet.
Die Herren pflegen sich bei dieser Gelegenheit
kräftig die Hände zu schütteln, der eigen-
artigen Fügung einige Worte zu widmen und
sich dann wieder auf vier Jahre zu trennen.
So auch dieses Mal. Simplex
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für M u nc h e n: Ludwig F. Fuchs / R o in : G. Relnboth
Wien : Dr. St. Poglaven-Neuwall — Pariser Bü ro : 8. rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m b. H., Ber in W 62. Zuschriften sind
an die Direktion der Weitkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif atif Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrecbte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 9 vom 26. Februar 1933 '•
• •
Nachrichten von Überall
Um das Lessing-Museum
Das Berliner Lessing-Museum erläßt einen
dringenden Hilferuf, da es infolge Bei-
tragsstreichungen der Behörden seine Miete
nicht mehr zahlen kann. Der verdienst-
volle Begründer und Leiter des Museums Georg
Richard Kruse, der erste Vorsitzende der
Lessing-Gesellschaft, die im Museum ihr Heim
hat, Dr. Heinrich Spiero, Max Osborn u. a.
haben sich warm für die Erhaltung dieser letz-
ten geistigen Gedenkstätte aus der Zeit der
Klassiker eingesetzt, ist
unterscheiden lassen. Überraschungen dürften
in diesem Gebiet wahrscheinlicher als in allen
anderen Teilen Roms sein.
Altdeutsche Kunsterwerbung
für St. Louis
Das Städtische Kunstmuseum von St. Louis
(U. S. A.) hat aus dem Odenwald-Schloß der
Grafen Erbach in Erbach, aus dem große
Teile der Waffensammlung und andere Stücke
Melonenmädchen Hofers und der „Blaue Sol-
dat“ Beckmanns sind von großer dekorativer
Wirkung und bilden gewissermaßen den Über-
gang zu Künstlern wie Schrimpf und Schlem-
mer. Eine entzückende Tänzerin von Otto
Müller und ein ernstes Bild von W. Scholz ge-
hören zu dem Besten, was auf Ausstellungen
von ihnen zu sehen war. So bilden die Fran-
zosen und Deutschen die qualitätvollsten Ab-
teilungen der Ausstellung, obwohl sie, wie die
Italiener, dank den einschränkenden Bedin-
gungen des Komitees nicht voll zur Geltung
kamen. Dr. H. Gerson
Tür klopf er, Süddeutsch (Nürnberg), um 1530
Feuervergoldete Bronze
Sonder-Ausstellung: Berlin, Deutsches Museum
doch das Haus in der
Brüderstraße 13 nicht
nur die Wohnstätte von
Lessings Freund Fried-
rich Nicolai gewesen,
ein Sammelpunkt litera-
risch-künstlerischen Le-
bens, sondern im oberen
Stock 1815—1828 auch
die Wohnung der Eltern
Theodor Körners, der
bereits als Student
und 1811 und 1813 als
Lützower hier weilte,
sowie der talentierten
Malerin Dora Stock,
der Schwester von Th.
Körners Mutter, vor-
her von August Tiedge
und seiner schönen
Freundin Elisa v. d.
Recke bewohnt.
Das Haus mit seinem
idyllischen Hof und
Garten erhielt durch
Friedrich Zelter, den
Komponisten und den
Freund Goethes, durch
Umbau seine heutige
Gestalt, vor allem auch
die Fassade, eines der
wertvollen Dokumente
Alt-Berliner Bürger-
haus-Architekur, v on
der leider allzuviele schon der Bauwut einer
ästhetisch unkultivierten Zeit zum Opfer ge-
fallen. Max Osborn warnt deshalb eindringlich
vor der Herausnahme des Museums aus dem
Hause, das dann leichter der Vernichtung an-
heimfallen könnte.
Das Museum enthält einen wertvollen
Grundstock an Porträts, in Büsten, Bildern
und Stichen, Darstellungen jeder Art, Hand-
schriften, Drucken und Büchern, auch Musi-
kalien und Theatralia, Erinnerungsgegenstände
und Möbel, darunter einige aus dem Schiller-
Zimmer im „Goldenen Engel“ in Dresden.
Außer Lessing mit seinen Verwandten ist der
ganze Kreis seiner Freunde und Zeitgenossen,
Nicolai und die anderen obengenannten Be-
wohner des Hauses, ferner Moses Mendelsohn,
Chr. Ewald v. Kleist, Schiller, Arndt und viele
andere Geistesgrößen der Berliner Geschichte
vertreten bis auf Heinrich Heine, Fontane und
Wilhelm Raabe.
Neu geordnet und gesichtet, nach modernen
musealen Grundsätzen aufgestellt und ausge-
baut, könnte hier aus diesem Grundstock eine
große Sammelstätte des geistigen Berlins ent-
wickelt werden — das Haus bietet noch viel
räumliche Möglichkeiten dafür. M.
Ausgrabung des Circus Maximus
in Rom
Anläßlich der Einweihung des italienischen
Kulturinstitutes in Rom hat der Senator Prof.
Corrado Ricci, der der Leiter der großen
römischen Ausgrabungen gewesen ist, eine
Übersicht über die geleisteten Arbeiten in
ihrem inneren Zusammenhang der Auf-
erstehung des klassischen Roms gegeben. Bei
dieser Gelegenheit ist der bislang vernach-
lässigt gebliebenen Zone des Circus Maximus
Erwähnung getan worden. Das Tal zwischen
Palatin und Aventin, welches durch den Zirkus
nahezu vollkommen gefüllt wird und das durch
die Straße der „Via dei Cerchi“ durchzogen
wird, stellt bis zur Stunde den vernachlässigt-
sten Teil Roms dar. Lediglich die Südecke des
Zirkus ist auf einer ganz kleinen Fläche frei-
gelegt und läßt erkennen, daß unter der etwa
drei bis vier Meter Schuttschicht viel zu er-
warten ist. Da die Zone unter allen Um-
ständen systematisiert werden muß und zwar
aus städtebaulichen Gründen, eine Bebauung
aber wahrscheinlich eben der vorhandenen
Reste wegen nicht möglich sein dürfte, ist nun-
mehr die Ausgrabung des ganzen Zirkus in
Aussicht gestellt worden. Es soll diese Frei-
legung die nächste große Aufgabe sein, die
sich damit an die schon durchgeführten
riesigen Umwandlungen des inneren römischen
Stadtbildes anschließen würde. Die Ar-
beiten werden sofort nach fertiggestellter Aus-
grabung und Ordnung des Tempels der Venus
Genetrix am Cäsarforum, also noch innerhalb
des Jahres 1933 beginnen. Dann kann man
aber damit rechnen, daß die interessante Zone
Roms nun auch tiberwärts des Palatin sich aus-
dehnen wird und somit das ganze Zentrum des
klassischen oder besser des republikanischen
Roms umfaßt. Die bisherigen Ausgrabungs-
proben am Zirkus haben die Arbeiten des
Augustus von den Restaurierungen unter den
Flaviern und die Wiederherstellungsbauten
unter Trajan, schließlich die letzten Renovie-
rungen unter Constantin dem Großen, und zu-
letzt die frühmittelalterlichen Überbauungen
veräußert worden sind, ein hervorragendes
Werk deutscher mittelalterlicher Bildhauerkunst
erworben: den Grabstein der Elisabeth von
Erbach, die im Jahre 1368 starb, und ihres
Bruders Ulrich, der ihr im nächsten Jahre im
Tode folgte. Der Grabstein zeigt die Gestalten
der beiden Geschwister in der Art, wie sonst
die Grabsteine von Ehepaaren gebildet wurden,
nebeneinanderstehend in der ganzen Anmut des
entwickelten gotischen Stiles, in flachem Relief.
Moderne Kunst
in New York
Die CollegeArtAs-
s o c i a t i on eröffnete am
5. Februar eine Ausstel-
lung moderner Malerei
unter dem Titel „Interna-
tional 1933“. Ein Teil der
Bilder war bereits im Ja-
nuar d. J. in Worcester
zu sehen. 23 Nationen
sind vertreten; 326 Künst-
ler stellten zusammen
ebensoviele Bilder aus, da
nach dem Grundsatz des
Komitees jeder zur Aus-
stellung aufgeforderte
Künstler nur ein Werk
einsenden lassen durfte.
Infolge dieses „demokra-
tischen Prinzips“ werden
die führenden und vielsei-
tigen Talente durch die
Menge der Mitstrebenden
eingeengt und kommen
nicht ihrer Bedeutung ent-
sprechend zur Geltung.
Auch die einzelnen Länder
erscheinen nicht in der
Stärke, die ihrer künstle-
rischen Kraft entspricht,
da Rücksichten auf lokale
Verhältnisse zu nehmen
waren und wohl auch
Transportschwierigkeiten
im Wege standen.
Mit 50 Bildern füllen
die Amerikaner die ersten
Räume der Ausstellung.
Viele hübsche, geschmack-
volle Werke findet man
darunter, doch das euro-
päische Auge sucht ver-
gebens nach einer origi-
nellen, künstlerischen Lei-
stung. Zu beiden Seiten schließen sich Fran-
zosen und Deutsche mit je rund 40 Bildern an,
dann folgen Italiener, Spanier, Engländer,
Russen und andere Nationen. Von Braque,
Chagall, Derain, M. Laurencin, Matisse, Picasso
sind sehr schöne Werke ausgestellt. Interessant
die Russen. Das Bildnis des filmenden Eisen-
stein von C. Vlalov verbindet ein Porträt mit
einer Szene aus dem Leben der Seeleute; in der
Technik ist es den Surrealisten verwandt.
Dank den Leihgaben aus dem Heimatland
und einigen Beiträgen aus amerikanischem
Besitz ist Deutschland gut vertreten. Direk-
tor Valentiner, der seinen großen Kirchner und
einen Nolde lieh, schrieb einige einführende
Worte für den Katalog. Die Expressionisten
bilden den Mittelpunkt. Das farbenprächtige
Karl Feuchtmayr
Direktor des Wallraf-Richartz-
Museums
Nachdem der seitherige Direktor des Wall-
raf-Richartz-Museums, Dr. Ernst Buchner,
als Generaldirektor an die Pinakothek nach
München zurückkehrt, wird deren Konservator
Dr. Karl Feuchtmayr seine Stelle in Köln
einnehmen. Der 1893 geborene neue Direktor
des Wallraf-Richartz-Museums ist Schüler
Wölf f lins. Seine Forschungen galten der
bayerischen Malerei und Plastik von der Gotik
bis zum Frühbarock. F.
Ende des freien Museumseintritts
in Italien
Der italienische Ministerrat hat soeben in
einem Dekret die Maßnahme Mussolinis aus
dem Jahre 1929 widerrufen, nach der der Ein-
tritt in alle italienischen Staatsmuseen, Aus-
grabungsplätze und sonstigen Kunststätten
kostenlos war. Das neue Dekret sieht für alle
diese Stätten und Sammlungen einen niedrigen
Eintrittssatz vor, der sich nicht der früheren
Eintrittssumme, die prohibitiv gewirkt hat,
nähern soll. Der Eintritt wird notwendig, um
eine Beisteuer zu den Unterhaltungskosten der
Museen zu bringen. Außerdem werden 5 % der
Summe an die Künstlergewerkschaft abge-
führt. Dort sollen diese Gelder in die Unter-
stützungskasse der Künstler, die in Gründung
begriffen ist, fließen. Aus den Museumsgeldern
soll eine andere Summe nicht angegebener
Höhe abgezweigt werden, um aus ihr Preise
zur Ermutigung verdienstvoller Künstler zu
stiften. Die offizielle Begründung dieser Wie-
dereinführung des Eintrittsgeldes sagt aus,
daß notwendig werdende große Neuordnungen
der Kunstsammlungen nicht durchgeführt wer-
den können, sofern nicht durch das besuchende
Publikum eine gewisse Beihilfe gegeben wird.
Der Sonntag wird außerdem weiterhin kosten-
losen Besuch bringen. Man kann zusammen-
fassend sagen, daß zwar die Erfahrungen des
freien Museumseintrittes gut waren, daß aber
die Zahl der Italiener, welche die Sammlungen
besuchten, nicht im gleichen Verhältnis wie die
der Ausländer angewachsen ist, und in Italien
bezeichnet man die Wiedereinführung der Ab-
gaben als eine verschleierte Besteuerung der
Ausländer, eine Besteuerung, welche die
italienische Bevölkerung praktisch wenig treffe.
—th
Personalien
Dr. Norbert Lieb, der seit April 1932 die
Geschäfte des Maximiliansmuseums in Augs-
burg vertretungsweise geführt hat, wurde
Max Beckmann, Das Bad
Internationale Gemälde-Ausstellung Worcester
vom Stadtrat zum Leiter dieses Museums er-
nannt. Dr. Lieb, der erst im 27. Lebensjahre
steht, ist Schüler von Geheimrat Pinder und.
praktizierte am Bayr. Nat.-Mus. und der
Alten Pinakothek. F.
Kleine Notizen
Der Kunstklub Berlin, jetzt in der „Fisch-
küche am Zoo“, Kantstraße 8 (im Hause des
Theaters des Westens), veranstaltet am Mcntag-
den 27. Februar, 21 Uhr, einen Vortragsabend:
„Macht die Technik den Künstler überflüssig?“
Redner: Frank Warschauer (Musik), Dr. Margot
Rieß (bildende Kunst). Gleichzeitig eröffnet der
Klub seine neue Ausstellung: „Gedächtnisausstel-
lung Karl Leyhausen“.
Die kleine Geschichte
Fest im Bauhaus
Unser Sonderberichterstatter für Lustbar-
keiten besuchte letzten Sonnabend ein Fest des
kürzlich aus Dessau nach Berlin emigrierten
Bauhauses. Er faßt, soweit eine lückenhaftem
Erinnerung es gestattet, seine Eindrücke in
Folgendem zusammen.
Die Festdekorationen machten dem Hause
Ehre. Struktiv verspannte, metallische Farb-
flächen redeten die anerkannt klare Sprache
unserer Zeit und unterbanden jene unklaren,,
aber elementaren Regungen, die sich bei Festen
sonst einstellen. Die Kostüme der Teil-
nehmer waren teils liebevoll erdacht, teils,
ziemlich sorglos improvisiert. Der optische
Eindruck mochte befriedigen. Man bemerkte
unter den Masken einen Gerhart Hauptmann,
drei Hitler und einen täuschend ähnlichen
Mies van der Rohe; es kann sich allerdings
möglicherweise dabei um den Leiter des Bau-
hauses in persona gehandelt haben. Unser
Sonderberichterstatter war in einem kleid-
samen Kostüm aus schwarzer Seide und rotem.
Lacktuch erschienen. Die Bauhäusler traten
uniform in weißen Hemden und weißen Hosen
an. Sie erinnerten an einen Tennisklub und
trugen eine etwas störende, sommerliche Helle
in das karnevalistische Treiben. In vorge-
rückter Stunde ergriff das ausgeprägt dekora-
tive Element des Hauses von ihnen völlig Be-
sitz. Sie saßen dann nämlich, wie Spatzen auf
Telegraphendrähten, längs der Wände und
wirkten nur noch als weißes Band. Drei
Kapellen bemühten sich nicht immer erfolg-
reich, die Noten auseinanderzuhalten.
Aus dem Berliner Kunsthandel hatten die
Galerien Flechtheim, Matthiessen, Nierendorf
und Van Diemen Vertreter entsandt. Den
Kunsthändler Karl Nierendorf, der sich in
einen ordenbesetzten Frack geworfen hatte,
zierte ein lackierter, breitkrempiger Spanier-
hut. Dieser Hut, ein bemerkenswertes Stück,
setzte sich im Laufe des Abends in Bewegung,
wanderte über diverse Damenköpfe, saß vor-
übergehend auf einem plastischen Selbstbildnis-,
der Renee Sintenis, das später zur Verlosung
gelangte, und landete schließlich, jedoch nur-
noch als Krempe, auf der buschigen Mähne des.
arabischen Bildhauers Jussuf Abbo, die er wie-
eine teuflische Gloriole umgab.
Es wurde im allgemeinen mehr getanzt als;
konsumiert. Die meisten Herren waren leider-
finanziell nicht in der Lage, Tanzbekannt-
schaften durch einen gemeinsamen Trunk zu
festigen und einer höheren Verbundenheit zu-
zuführen. So zerfiel denn bedauerlicherweise
manches, was im ersten Augenblick hoffnungs-
voll und wahlverwandt aufgekeimt war. Die
wirtschaftliche Krise ist eben ausgesprochen
lebensfeindlich.
Eine das Fest sehr belebende Wirkung ging
von Herrn Curt Valentin (Galerie Flechtheim)
aus. Herr Valentin, der in einem grau-
gewürfelten Hemd erschienen war und das
blonde Haupt unbedeckt trug, tanzte sozusagen
in allen Sälen gleichzeitig, warf mit Bierfilzen
um sich und zertrümmerte Gläser, turnte toll-
kühn an den Geländern des Treppenhauses,
fiel die Treppen mehrfach hinab, transportierte
Erwachsene auf seinen stämmigen Schultern
durch das Haus und stülpte einen violetten
Zylinderhut (Eigentum des Dr. Swarzenski
vom Hohenzollernmuseum) tief über den Kopf
eines jungen Mannes im Smoking, der nur mit
Mühe von der unzugehörenden Bedeckung be-
freit werden konnte.
Unser Berichterstatter traf während des
Abends einen kleinen Herrn mit Hornbrille,
dem er alle vier Jahre in den verschiedensten
Städten Europas auf Maskenbällen begegnet.
Die Herren pflegen sich bei dieser Gelegenheit
kräftig die Hände zu schütteln, der eigen-
artigen Fügung einige Worte zu widmen und
sich dann wieder auf vier Jahre zu trennen.
So auch dieses Mal. Simplex
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für M u nc h e n: Ludwig F. Fuchs / R o in : G. Relnboth
Wien : Dr. St. Poglaven-Neuwall — Pariser Bü ro : 8. rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m b. H., Ber in W 62. Zuschriften sind
an die Direktion der Weitkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif atif Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrecbte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19