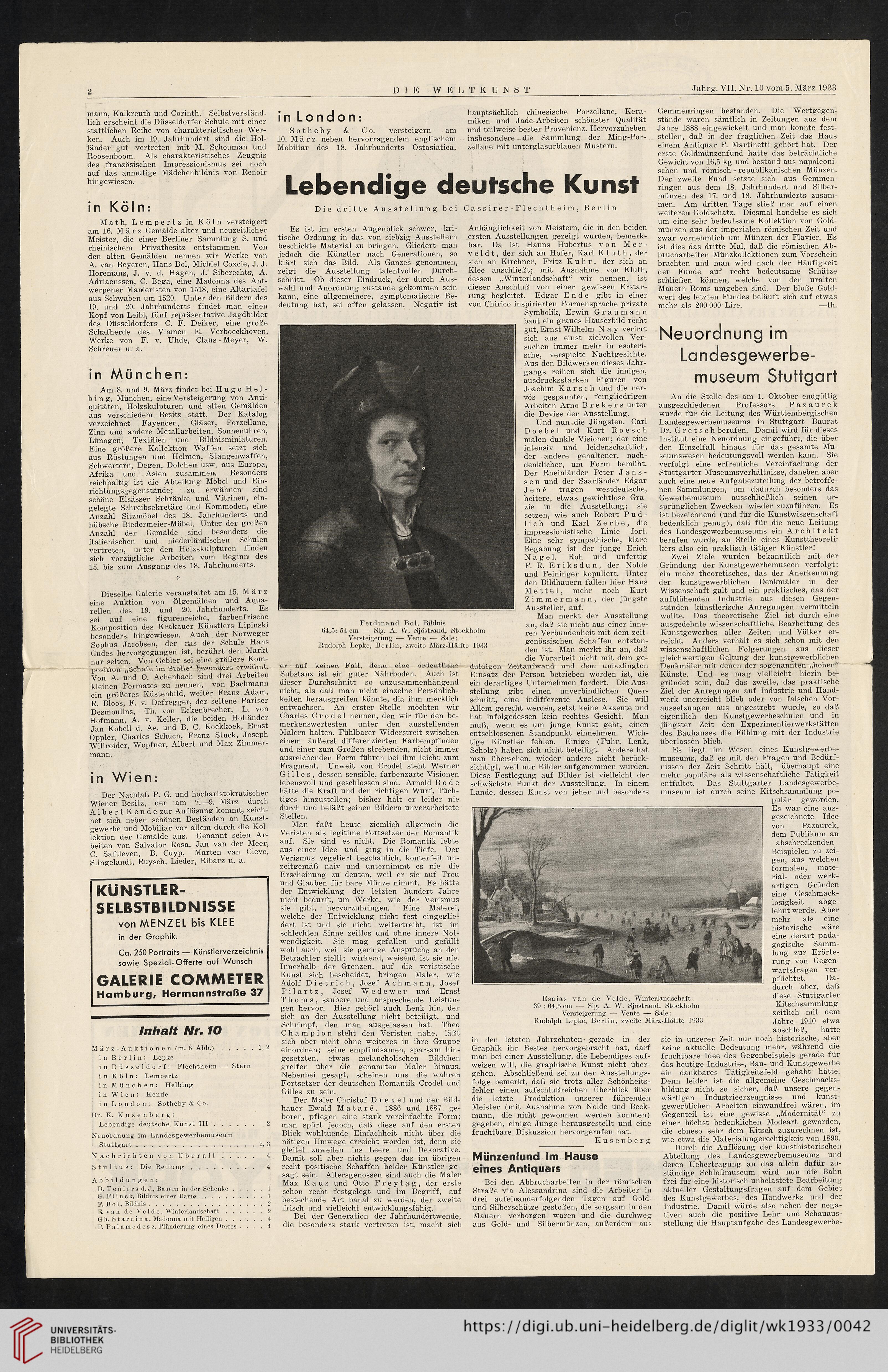2
DIE VV E L T K U N S T
Jahrg. VII, Nr. 10 vom 5. März 1933
mann, Kalkreuth und Corinth. Selbstverständ-
lich erscheint die Düsseldorfer Schule mit einer
stattlichen Reihe von charakteristischen Wer-
ken. Auch im 19. Jahrhundert sind die Hol-
länder gut vertreten mit M. Schouman und
Roosenboom. Als charakteristisches Zeugnis
des französischen Impressionismus sei noch
auf das anmutige Mädchenbildnis von Renoir
hingewiesen.
in Köln:
Math, Lempertz in Köln versteigert
am 16. März Gemälde alter und neuzeitlicher
Meister, die einer Berliner Sammlung S. und
rheinischem Privatbesitz entstammen. Von
den alten Gemälden nennen wir Werke von
A. van Beyeren, Hans Boi, Michiel Coxcie, J. J.
Horemans, J. v. d. Hagen, J. Siberechts, A.
Adriaenssen, C. Bega, eine Madonna des Ant-
werpener Manieristen von 1518, eine Altartafel
aus Schwaben um 1520. Unter den Bildern1 des
19. und 20. Jahrhunderts findet man einen
Kopf von Leibi, fünf repräsentative Jagdbilder
des Düsseldorfers C. F. Deiker, eine große
Schafherde des Vlamen E. Verboeckhoven,
Werke von F. v. Uhde, Claus - Meyer, W.
Schreuer u. a.
in München:
Am 8. und 9. März findet bei Hugo H e 1 -
hing, München, eine Versteigerung von Anti-
quitäten, Holzskulpturen und alten Gemälden
aus verschiedem Besitz statt. Der Katalog
verzeichnet Fayencen, Gläser, Porzellane,
Zinn und andere Metallarbeiten, Sonnenuhren,
Limogem, Textilien und Bildnisminiaturen.
Eine größere Kollektion Waffen setzt sich
aus Rüstungen und Helmen, Stangenwaffen,
Schwertern, Degen, Dolchen usw. aus Europa,
Afrika und Asien zusammen. Besonders
reichhaltig ist die Abteilung Möbel und Ein-
richtungsgegenstände; zu erwähnen sind
schöne Elsässer Schränke und Vitrinen, ein-
gelegte Schreibsekretäre und Kommoden, eine
Anzahl Sitzmöbel des 18. Jahrhunderts und
hübsche Biedermeier-Möbel. Unter der großen
Anzahl der Gemälde sind besonders die
italienischen und niederländischen Schulen
vertreten, unter den Holzskulpturen finden
sich vorzügliche Arbeiten vom Beginn des
15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.
Dieselbe Galerie veranstaltet am 15. März
eine Auktion von Ölgemälden und Aqua-
rellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es
sei auf eine figurenreiche, farbenfrische
Komposition des Krakauer Künstlers Lipinski
besonders hingewiesen. Auch der Norweger
Sophus Jacobsen, der aus der Schule Hans
Gudes hervorgegangen ist, berührt den Markt
nur selten. Von Gebier sei eine größere Kom-
position „Schafe im Stalle“ besonders erwähnt.
Von A. und 0. Achenbach sind drei Arbeiten
kleinen Formates zu nennen, von Bachmann
ein größeres Küstenbild, weiter Franz Adam,
R. Bloos, F. v. Defregger, der seltene Pariser
Desmoulins, Th. von Eckenbrecher, L. von
Hofmann, A. v. Keller, die beiden Holländer
Jan Kobell d. Ae. und B. C. Koekkoek, Ernst
Oppler, Charles Schuch, Franz Stuck, Joseph
Willroider, Wopfner, Albert und Max Zimmer-
mann.
in Wien:
Der Nachlaß P. G. und hocharistokratischer
Wiener Besitz, der am 7.—9. März durch
Albe r t Kend e zur Auflösung kommt, zeich-
net sich neben schönen Beständen an Kunst-
gewerbe und Mobiliar vor allem durch die Kol-
lektion der Gemälde aus. Genannt seien Ar-
beiten von Salvator Rosa, Jan van der Meer,
C. Saftleven, B. Cuyp, Marten van Cleve,
Slingelandt, Ruysch, Lieder, Ribarz u. a.
KÜNSTLER-
SELBSTBILDNISSE
von MENZEL bis KLEE
in der Graphik.
Ca. 250 Portraits — Künstlerverzeichnis
sowie Spezial-Offerte auf Wunsch
GALERIE COMMETER
Hamburg, Hermannstraße 37
Inhalt Nr. 10
März-Auktionen (m. 6 Abb.).1, 2
in Berlin: Lepke
in Düsseldorf: Flechtheim — Stern
in Köln: Lempertz
in München: Helbing
in Wien: Kende
in London: Sotheby & Co.
Dr. K. Kusenberg:
Lebendige deutsche Kunst III. 2
Neuordnung im Landesgewerbemuseum
Stuttgart . . . t . 2, 3
Nachrichten von Überall. 4
S t u 11 u s : Die Rettung. 4
Abbildungen:
D. T e n i e r s d. J., -Bauern in der Schenke.1
G. F1 i n c k, Bildnis einer Dame.1
F. B o 1, Bildnis.2
E. van de Velde, Winterlandschaft.2
G h. S t a r n i n a, Madonna mit Heiligen.4
P. Palame des z, Plünderung eines Dorfes . ... 4
in London:
Sotheby & Co. versteigern am
10. März neben hervorragendem englischem
Mobiliar des 18. Jahrhunderts Ostasiatica,
hauptsächlich chinesische Porzellane, Kera-
miken und Jade-Arbeiten schönster Qualität
und teilweise bester Provenienz. Hervorzuheben
insbesondere die Sammlung der Ming-Por-
zellane mit unterglasurblauen Mustern.
Lebendige deutsche Kunst
Die dritte Ausstellung bei C a s s i r e r - F 1 e c h t h e i m , Berlin
Es ist im ersten Augenblick schwer, kri-
tische Ordnung in das von siebzig Ausstellern
beschickte Material zu bringen. Gliedert man
jedoch die Künstler nach Generationen, so
klärt sich das Bild. Als Ganzes genommen,
zeigt die Ausstellung talentvollen Durch-
schnitt. Ob dieser Eindruck, der durch Aus-
wahl und Anordnung zustande gekommen sein
kann, eine allgemeinere, symptomatische Be-
deutung hat, sei offen gelassen. Negativ ist
Anhänglichkeit von Meistern, die in den beiden
ersten Ausstellungen gezeigt wurden, bemerk-
bar. Da ist Hanns Hubertus von Mer-
v e 1 d t, der sich an Hofer, Karl K1 u t h , der
sich an Kirchner, Fritz K u h r, der sich an
Klee anschließt; mit Ausnahme von Kluth,
dessen „Winterlandschaft“ wir nennen, ist
dieser Anschluß von einer gewissen Erstar-
rung begleitet. Edgar Ende gibt in einer
von Chirico inspirierten Formensprache private
Symbolik, Erwin Graumann
baut ein graues Häuserbild recht
gut, Ernst Wilhelm Nay verirrt
sich aus einst zielvollen Ver-
suchen immer mehr in esoteri-
sche, verspielte Nachtgesichte.
Aus den Bildwerken dieses Jahr-
gangs reihen sich die innigen,
ausdrucksstarken Figuren von
Joachim Kar sch und die ner-
vös gespannten, feingliedrigen
Arbeiten Arno B r e k e r s unter
die Devise der Ausstellung.
Und nun die Jüngsten. Carl
D o e b e 1 und Kurt Roesch
malen dunkle Visionen; der eine
intensiv und leidenschaftlich,
der andere gehaltener, nach-
denklicher, um Form bemüht.
Der Rheinländer Peter Jans-
sen und der Saarländer Edgar
Jene tragen westdeutsche,
heitere, etwas gewichtlose Gra-
zie in die Ausstellung; sie
setzen, wie auch Robert P u d -
lieh und Karl Zerbe, die
impressionistische Linie fort.
Eine sehr sympathische, klare
Begabung ist der junge Erich
Nagel. Roh und unfertig
F. R. Eriksdun, der Nolde
und Feininger kopuliert. Unter
den Bildhauern fallen hier Hans
Mettel, mehr noch Kurt
Zimmermann, der jüngste
Aussteller, auf.
Gemmenringen bestanden. Die Wertgegen-
stände waren sämtlich in Zeitungen aus dem
Jahre 1888 eingewickelt und man konnte fest-
stellen:, daß in der fraglichen Zeit das Haus
einem Antiquar F. Martinetti gehört hat. Der
erste Goldmünzenfund hatte das beträchtliche
Gewicht von 16,5 kg und bestand aus napoleoni-
schen und römisch - republikanischen Münzen.
Der zweite Fund setzte sich aus Gemmen-
ringen aus dem 18. Jahrhundert und Silber-
münzen des 17. und 18. Jahrhunderts zusam-
men. Am dritten Tage stieß man auf einen
weiterem Goldschatz. Diesmal handelte es sich
um eine sehr bedeutsame Kollektion von Gold-
münzen aus der imperialen römischen Zeit und
zwar vornehmlich um Münzen der Flavier. Es
ist dies das dritte Mal, daß die römischen Ab-
brucharbeiten Münzkollektionen zum Vorschein
brachten und man wird nach der Häufigkeit
der Funde auf recht bedeutsame Schätze
schließen können, welche von den uralten
Mauern Roms umgeben sind. Der bloße Gold-
wert des letzten Fundes beläuft sich auf etwas
mehr als 200 000 Lire. -—th.
Neuordnung im
Landesgewerbe-
museum Stuttgart
An die Stelle des am 1. Oktober endgültig
ausgeschiedenen Professors Pazaurek
wurde für die Leitung des Württembergischen
Landesgewerbemuseums in Stuttgart Baurat
Dr. Gretsch berufen. Damit wird für dieses
Institut eine Neuordnung eingeführt, die über
den Einzelfall hinaus für das gesamte Mu-
seumswesen bedeutungsvoll werden kann. Sie
verfolgt eine erfreuliche Vereinfachung der
Stuttgarter Museumsverhältnisse, daneben aber
auch eine neue Aufgabezuteilung der betroffe-
nen Sammlungen, um dadurch besonders das
Gewerbemuseum ausschließlich seinen ur-
sprünglichen Zwecken wieder zuzuführen. Es
ist bezeichnend (und für die Kunstwissenschaft
bedenklich genug), daß für die neue Leitung
des Landesgewerbemuseums ein Architekt
berufen wurde, an Stelle eines Kunsttheoreti-
kers also ein praktisch tätiger Künstler!
Zwei Ziele wurden bekanntlich mit der
Gründung der Kunstgewerbemuseen verfolgt:
ein mehr theoretisches, das der Anerkennung
der kunstgewerblichen Denkmäler in der
Wissenschaft galt und ein praktisches, das der
aufblühenden Industrie aus diesen Gegen-
ständen künstlerische Anregungen vermitteln
Ferdinand Boi, Bildnis
64,5:54 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm
Versteigerung -— Vente — Sale:
Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte 1933
er auf keinen Fall, denn eine ordentliche
Substanz ist ein guter Nährboden. Auch ist
dieser Durchschnitt so unzusammenhängend
nicht, als daß man nicht einzelne Persönlich-
keiten herausgreifen könnte, die ihm merklich
entwachsen. An erster Stelle möchten wir
Charles C r o d e 1 nennen, den wir für den be-
merkenswertesten unter den ausstellenden
Malern halten. Fühlbarer Widerstreit zwischen
einem äußerst differenzierten Farbempfinden
und einer zum Großen strebenden, nicht immer
ausreichenden Form führen bei ihm leicht zum
Fragment. Unweit von Crodel steht Werner
Gilles, dessen sensible, farbenzarte Visionen
lebensvoll und geschlossen sind. Arnold Bode
hätte die Kraft und den richtigen Wurf, Tüch-
tiges hinzustellen; bisher hält er leider nie
durch und beläßt seinen Bildern unverarbeitete
Stellen.
Man faßt heute ziemlich allgemein die
Veristen als legitime Fortsetzer der Romantik
auf. Sie sind es nicht. Die Romantik lebte
aus einer Idee und ging in die Tiefe. Der
Verismus vegetiert beschaulich, konterfeit un-
zeitgemäß naiv und unternimmt es nie die
Erscheinung zu deuten, weil er sie auf Treu
und Glauben für bare Münze nimmt. Es hätte
der Entwicklung der letzten hundert Jahre
nicht bedurft, um Werke, wie der Verismus
sie gibt, hervorzubringen. Eine Malerei,
welche der Entwicklung nicht fest eingeglie-
dert ist und sie nicht weitertreibt, ist im
schlechten Sinne zeitlos und ohne innere Not-
wendigkeit. Sie mag gefallen und gefällt
wohl auch, weil sie geringe Ansprüche an den
Betrachter stellt: wirkend, weisend ist sie nie.
Innerhalb der Grenzen, auf die veristische
Kunst sich bescheidet, bringen Maler, wie
Adolf Dietrich, Josef Ach mann, Josef
P i 1 a r t z , Josef W e d e w e r und Ernst
Thoms, saubere und ansprechende Leistun-
gen hervor. Hier gehört auch Lenk hin, der
sich an der Ausstellung nicht beteiligt, und
Schrimpf, den man ausgelassen hat. Theo
Champion steht den Veristen nahe, läßt
sich aber nicht ohne weiteres in ihre Gruppe
einordnen; seine empfindsamen, sparsam hin-
gesetzten, etwas melancholischen Bildchen
greifen über die genannten Maler hinaus.
Nebenbei gesagt, scheinen uns die wahren
Fortsetzer der deutschen Romantik Crodel und
Gilles zu sein.
Der Maler Christof Drexel und der Bild-
hauer Ewald M a t a r e , 1886 und 1887 ge-
boren, pflegen eine stark vereinfachte Form;
man spürt jedoch, daß diese auf den ersten
Blick wohltuende Einfachheit nicht über die
nötigen Umwege erreicht worden ist, denn sie
gleitet zuweilen ins Leere und Dekorative.
Damit soll aber nichts gegen das im übrigen
recht positische Schaffen beider Künstler ge-
sagt sein. Altersgenossen sind auch die Maler
Max K a u s und Otto F r e y t a g , der erste
schon recht festgelegt und im Begriff, auf
bestechende Art banal zu werden, der zweite
frisch und vielleicht entwicklungsfähig.
Bei der Generation der Jahrhundertwende,
die besonders stark vertreten ist, macht sich
Man merkt der Ausstellung
an, daß sie nicht aus einer inne-
ren Verbundenheit mit dem zeit-
genössischen Schaffen entstan-
den ist. Man merkt ihr an, daß
die Vorarbeit nicht mit dem ge-
duldigen Zeitaufwand und dem unbedingten
Einsatz der Person betrieben worden ist, die
ein derartiges Unternehmen fordert. Die Aus-
stellung gibt einen unverbindlichen Quer-
schnitt, eine indifferente Auslese. Sie will
Allem gerecht werden, setzt keine Akzente und
hat infolgedessen kein rechtes Gesicht. Man
muß, wenn es um junge Kunst geht, einen
entschlossenen Standpunkt einnehmen. Wich-
tige Künstler fehlen. Einige (Fuhr, Lenk,
Scholz) haben sich nicht beteiligt. Andere hat
man übersehen, wieder andere nicht berück-
sichtigt, weil nur Bilder aufgenommen wurden.
Diese Festlegung auf Bilder ist vielleicht der
schwächste Punkt der Ausstellung. In einem
Lande, dessen Kunst von jeher und besonders
in den letzten .Jahrzehnten- gerade in der
Graphik ihr Bestes hervorgebracht hat, darf
man bei einer Ausstellung, die Lebendiges auf-
weisen will, die graphische Kunst nicht über-
gehen. Abschließend sei zu der Ausstellungs-
folge bemerkt, daß sie trotz aller Schönheits-
fehler einen aufschlußreichen Überblick über
die letzte Produktion unserer führenden
Meister (mit Ausnahme von Nolde und Beck-
mann, die nicht gewonnen werden konnten)
gegeben, einige Junge herausgestellt und eine
fruchtbare Diskussion hervorgerufen hat.
Kusenberg
Münzenfund im Hause
eines Antiquars
Bei den Abbrucharbeiten in der römischen
Straße via Alessandrina sind die Arbeiter in
drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Gold-
und Silberschätze gestoßen, die sorgsam in den
Mauern verborgen waren und die durchweg
aus Gold- und Silbermünzen, außerdem aus
wollte. Das theoretische Ziel ist durch eine
ausgedehnte wissenschaftliche Bearbeitung des
Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker er-
reicht. Anders verhält es sich schon mit den
wissenschaftlichen Folgerungen aus dieser
gleichwertigen Geltung der kunstgewerblichen
Denkmäler mit denen der sogenannten „hohen“
Künste. Und es mag vielleicht hierin be-
gründet sein, daß das zweite, das praktische
Ziel der Anregungen auf Industrie und Hand-
werk unerreicht blieb oder von falschen Vor-
aussetzungen aus angestrebt wurde, so daß
eigentlich den Kunstgewerbeschulen und in
jüngster Zeit den Experimentierwerkstätten
des Bauhauses die Fühlung mit der Industrie
überlassen blieb.
Es liegt im Wesen eines Kunstgewerbe-
museums, daß es mit den Fragen und Bedürf-
nissen der Zeit Schritt hält, überhaupt eine
mehr populäre als wissenschaftliche Tätigkeit
entfaltet. Das Stuttgarter Landesgewerbe-
museum ist durch seine Kitschsammlung po-
pulär geworden.
Es war eine aus-
gezeichnete Idee
von Pazaurek,
dem Publikum an
abschreckenden
Beispielen zu zei-
gen, aus welchen
formalen, mate-
rial- oder werk-
artigen Gründen
eine Geschmack-
losigkeit abge-
lehntwerde. Aber
mehr als eine
historische wäre
eine derart päda-
gogische Samm-
lung zur Erörte-
rung von Gegen-
wartsfragen ver-
pflichtet. Da-
durch aber, daß
diese Stuttgarter
Kitschsammlung
zeitlich mit dem
1933 Jahre 1910 etwa
abschloß, hatte
sie in unserer Zeit nur noch historische, aber
keine aktuelle Bedeutung mehr, während die
fruchtbare Idee des Gegenbeispiels gerade für
das heutige Industrie-, Bau- und Kunstgewerbe
ein dankbares Tätigkeitsfeld gehabt hätte.
Denn leider ist die allgemeine Geschmacks-
bildung nicht so sicher, daß unsere gegen-
wärtigen Industrieerzeugnisse und kunst-
gewerblichen Arbeiten einwandfrei wären, im
Gegenteil ist eine gewisse „Modernität“ zu
einer höchst bedenklichen Modeart geworden,
die ebneso sehr dem Kitsch zuzurechnen ist,
wie etwa die Materialungerechtigkeit von 1890.
Durch die Auflösung der kunsthistorischen
Abteilung des Landesgewerbemuseums und
deren Uebertragung an das allein dafür zu-
ständige Schloßmuseum wird nun die Bahn
frei für eine historisch unbelastete Bearbeitung
aktueller Gestaltungsfragen auf dem Gebiet
des Kunstgewerbes, des Handwerks und der
Industrie. Damit würde also neben der nega-
tiven auch die positive Lehr- und Schauaus-
stellung die Hauptaufgabe des Landesgewerbe-
Esaias van de Velde, Winterlandschaft
39 : 64,5 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm
Versteigerung — Vente — Sale:
Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte
DIE VV E L T K U N S T
Jahrg. VII, Nr. 10 vom 5. März 1933
mann, Kalkreuth und Corinth. Selbstverständ-
lich erscheint die Düsseldorfer Schule mit einer
stattlichen Reihe von charakteristischen Wer-
ken. Auch im 19. Jahrhundert sind die Hol-
länder gut vertreten mit M. Schouman und
Roosenboom. Als charakteristisches Zeugnis
des französischen Impressionismus sei noch
auf das anmutige Mädchenbildnis von Renoir
hingewiesen.
in Köln:
Math, Lempertz in Köln versteigert
am 16. März Gemälde alter und neuzeitlicher
Meister, die einer Berliner Sammlung S. und
rheinischem Privatbesitz entstammen. Von
den alten Gemälden nennen wir Werke von
A. van Beyeren, Hans Boi, Michiel Coxcie, J. J.
Horemans, J. v. d. Hagen, J. Siberechts, A.
Adriaenssen, C. Bega, eine Madonna des Ant-
werpener Manieristen von 1518, eine Altartafel
aus Schwaben um 1520. Unter den Bildern1 des
19. und 20. Jahrhunderts findet man einen
Kopf von Leibi, fünf repräsentative Jagdbilder
des Düsseldorfers C. F. Deiker, eine große
Schafherde des Vlamen E. Verboeckhoven,
Werke von F. v. Uhde, Claus - Meyer, W.
Schreuer u. a.
in München:
Am 8. und 9. März findet bei Hugo H e 1 -
hing, München, eine Versteigerung von Anti-
quitäten, Holzskulpturen und alten Gemälden
aus verschiedem Besitz statt. Der Katalog
verzeichnet Fayencen, Gläser, Porzellane,
Zinn und andere Metallarbeiten, Sonnenuhren,
Limogem, Textilien und Bildnisminiaturen.
Eine größere Kollektion Waffen setzt sich
aus Rüstungen und Helmen, Stangenwaffen,
Schwertern, Degen, Dolchen usw. aus Europa,
Afrika und Asien zusammen. Besonders
reichhaltig ist die Abteilung Möbel und Ein-
richtungsgegenstände; zu erwähnen sind
schöne Elsässer Schränke und Vitrinen, ein-
gelegte Schreibsekretäre und Kommoden, eine
Anzahl Sitzmöbel des 18. Jahrhunderts und
hübsche Biedermeier-Möbel. Unter der großen
Anzahl der Gemälde sind besonders die
italienischen und niederländischen Schulen
vertreten, unter den Holzskulpturen finden
sich vorzügliche Arbeiten vom Beginn des
15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.
Dieselbe Galerie veranstaltet am 15. März
eine Auktion von Ölgemälden und Aqua-
rellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es
sei auf eine figurenreiche, farbenfrische
Komposition des Krakauer Künstlers Lipinski
besonders hingewiesen. Auch der Norweger
Sophus Jacobsen, der aus der Schule Hans
Gudes hervorgegangen ist, berührt den Markt
nur selten. Von Gebier sei eine größere Kom-
position „Schafe im Stalle“ besonders erwähnt.
Von A. und 0. Achenbach sind drei Arbeiten
kleinen Formates zu nennen, von Bachmann
ein größeres Küstenbild, weiter Franz Adam,
R. Bloos, F. v. Defregger, der seltene Pariser
Desmoulins, Th. von Eckenbrecher, L. von
Hofmann, A. v. Keller, die beiden Holländer
Jan Kobell d. Ae. und B. C. Koekkoek, Ernst
Oppler, Charles Schuch, Franz Stuck, Joseph
Willroider, Wopfner, Albert und Max Zimmer-
mann.
in Wien:
Der Nachlaß P. G. und hocharistokratischer
Wiener Besitz, der am 7.—9. März durch
Albe r t Kend e zur Auflösung kommt, zeich-
net sich neben schönen Beständen an Kunst-
gewerbe und Mobiliar vor allem durch die Kol-
lektion der Gemälde aus. Genannt seien Ar-
beiten von Salvator Rosa, Jan van der Meer,
C. Saftleven, B. Cuyp, Marten van Cleve,
Slingelandt, Ruysch, Lieder, Ribarz u. a.
KÜNSTLER-
SELBSTBILDNISSE
von MENZEL bis KLEE
in der Graphik.
Ca. 250 Portraits — Künstlerverzeichnis
sowie Spezial-Offerte auf Wunsch
GALERIE COMMETER
Hamburg, Hermannstraße 37
Inhalt Nr. 10
März-Auktionen (m. 6 Abb.).1, 2
in Berlin: Lepke
in Düsseldorf: Flechtheim — Stern
in Köln: Lempertz
in München: Helbing
in Wien: Kende
in London: Sotheby & Co.
Dr. K. Kusenberg:
Lebendige deutsche Kunst III. 2
Neuordnung im Landesgewerbemuseum
Stuttgart . . . t . 2, 3
Nachrichten von Überall. 4
S t u 11 u s : Die Rettung. 4
Abbildungen:
D. T e n i e r s d. J., -Bauern in der Schenke.1
G. F1 i n c k, Bildnis einer Dame.1
F. B o 1, Bildnis.2
E. van de Velde, Winterlandschaft.2
G h. S t a r n i n a, Madonna mit Heiligen.4
P. Palame des z, Plünderung eines Dorfes . ... 4
in London:
Sotheby & Co. versteigern am
10. März neben hervorragendem englischem
Mobiliar des 18. Jahrhunderts Ostasiatica,
hauptsächlich chinesische Porzellane, Kera-
miken und Jade-Arbeiten schönster Qualität
und teilweise bester Provenienz. Hervorzuheben
insbesondere die Sammlung der Ming-Por-
zellane mit unterglasurblauen Mustern.
Lebendige deutsche Kunst
Die dritte Ausstellung bei C a s s i r e r - F 1 e c h t h e i m , Berlin
Es ist im ersten Augenblick schwer, kri-
tische Ordnung in das von siebzig Ausstellern
beschickte Material zu bringen. Gliedert man
jedoch die Künstler nach Generationen, so
klärt sich das Bild. Als Ganzes genommen,
zeigt die Ausstellung talentvollen Durch-
schnitt. Ob dieser Eindruck, der durch Aus-
wahl und Anordnung zustande gekommen sein
kann, eine allgemeinere, symptomatische Be-
deutung hat, sei offen gelassen. Negativ ist
Anhänglichkeit von Meistern, die in den beiden
ersten Ausstellungen gezeigt wurden, bemerk-
bar. Da ist Hanns Hubertus von Mer-
v e 1 d t, der sich an Hofer, Karl K1 u t h , der
sich an Kirchner, Fritz K u h r, der sich an
Klee anschließt; mit Ausnahme von Kluth,
dessen „Winterlandschaft“ wir nennen, ist
dieser Anschluß von einer gewissen Erstar-
rung begleitet. Edgar Ende gibt in einer
von Chirico inspirierten Formensprache private
Symbolik, Erwin Graumann
baut ein graues Häuserbild recht
gut, Ernst Wilhelm Nay verirrt
sich aus einst zielvollen Ver-
suchen immer mehr in esoteri-
sche, verspielte Nachtgesichte.
Aus den Bildwerken dieses Jahr-
gangs reihen sich die innigen,
ausdrucksstarken Figuren von
Joachim Kar sch und die ner-
vös gespannten, feingliedrigen
Arbeiten Arno B r e k e r s unter
die Devise der Ausstellung.
Und nun die Jüngsten. Carl
D o e b e 1 und Kurt Roesch
malen dunkle Visionen; der eine
intensiv und leidenschaftlich,
der andere gehaltener, nach-
denklicher, um Form bemüht.
Der Rheinländer Peter Jans-
sen und der Saarländer Edgar
Jene tragen westdeutsche,
heitere, etwas gewichtlose Gra-
zie in die Ausstellung; sie
setzen, wie auch Robert P u d -
lieh und Karl Zerbe, die
impressionistische Linie fort.
Eine sehr sympathische, klare
Begabung ist der junge Erich
Nagel. Roh und unfertig
F. R. Eriksdun, der Nolde
und Feininger kopuliert. Unter
den Bildhauern fallen hier Hans
Mettel, mehr noch Kurt
Zimmermann, der jüngste
Aussteller, auf.
Gemmenringen bestanden. Die Wertgegen-
stände waren sämtlich in Zeitungen aus dem
Jahre 1888 eingewickelt und man konnte fest-
stellen:, daß in der fraglichen Zeit das Haus
einem Antiquar F. Martinetti gehört hat. Der
erste Goldmünzenfund hatte das beträchtliche
Gewicht von 16,5 kg und bestand aus napoleoni-
schen und römisch - republikanischen Münzen.
Der zweite Fund setzte sich aus Gemmen-
ringen aus dem 18. Jahrhundert und Silber-
münzen des 17. und 18. Jahrhunderts zusam-
men. Am dritten Tage stieß man auf einen
weiterem Goldschatz. Diesmal handelte es sich
um eine sehr bedeutsame Kollektion von Gold-
münzen aus der imperialen römischen Zeit und
zwar vornehmlich um Münzen der Flavier. Es
ist dies das dritte Mal, daß die römischen Ab-
brucharbeiten Münzkollektionen zum Vorschein
brachten und man wird nach der Häufigkeit
der Funde auf recht bedeutsame Schätze
schließen können, welche von den uralten
Mauern Roms umgeben sind. Der bloße Gold-
wert des letzten Fundes beläuft sich auf etwas
mehr als 200 000 Lire. -—th.
Neuordnung im
Landesgewerbe-
museum Stuttgart
An die Stelle des am 1. Oktober endgültig
ausgeschiedenen Professors Pazaurek
wurde für die Leitung des Württembergischen
Landesgewerbemuseums in Stuttgart Baurat
Dr. Gretsch berufen. Damit wird für dieses
Institut eine Neuordnung eingeführt, die über
den Einzelfall hinaus für das gesamte Mu-
seumswesen bedeutungsvoll werden kann. Sie
verfolgt eine erfreuliche Vereinfachung der
Stuttgarter Museumsverhältnisse, daneben aber
auch eine neue Aufgabezuteilung der betroffe-
nen Sammlungen, um dadurch besonders das
Gewerbemuseum ausschließlich seinen ur-
sprünglichen Zwecken wieder zuzuführen. Es
ist bezeichnend (und für die Kunstwissenschaft
bedenklich genug), daß für die neue Leitung
des Landesgewerbemuseums ein Architekt
berufen wurde, an Stelle eines Kunsttheoreti-
kers also ein praktisch tätiger Künstler!
Zwei Ziele wurden bekanntlich mit der
Gründung der Kunstgewerbemuseen verfolgt:
ein mehr theoretisches, das der Anerkennung
der kunstgewerblichen Denkmäler in der
Wissenschaft galt und ein praktisches, das der
aufblühenden Industrie aus diesen Gegen-
ständen künstlerische Anregungen vermitteln
Ferdinand Boi, Bildnis
64,5:54 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm
Versteigerung -— Vente — Sale:
Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte 1933
er auf keinen Fall, denn eine ordentliche
Substanz ist ein guter Nährboden. Auch ist
dieser Durchschnitt so unzusammenhängend
nicht, als daß man nicht einzelne Persönlich-
keiten herausgreifen könnte, die ihm merklich
entwachsen. An erster Stelle möchten wir
Charles C r o d e 1 nennen, den wir für den be-
merkenswertesten unter den ausstellenden
Malern halten. Fühlbarer Widerstreit zwischen
einem äußerst differenzierten Farbempfinden
und einer zum Großen strebenden, nicht immer
ausreichenden Form führen bei ihm leicht zum
Fragment. Unweit von Crodel steht Werner
Gilles, dessen sensible, farbenzarte Visionen
lebensvoll und geschlossen sind. Arnold Bode
hätte die Kraft und den richtigen Wurf, Tüch-
tiges hinzustellen; bisher hält er leider nie
durch und beläßt seinen Bildern unverarbeitete
Stellen.
Man faßt heute ziemlich allgemein die
Veristen als legitime Fortsetzer der Romantik
auf. Sie sind es nicht. Die Romantik lebte
aus einer Idee und ging in die Tiefe. Der
Verismus vegetiert beschaulich, konterfeit un-
zeitgemäß naiv und unternimmt es nie die
Erscheinung zu deuten, weil er sie auf Treu
und Glauben für bare Münze nimmt. Es hätte
der Entwicklung der letzten hundert Jahre
nicht bedurft, um Werke, wie der Verismus
sie gibt, hervorzubringen. Eine Malerei,
welche der Entwicklung nicht fest eingeglie-
dert ist und sie nicht weitertreibt, ist im
schlechten Sinne zeitlos und ohne innere Not-
wendigkeit. Sie mag gefallen und gefällt
wohl auch, weil sie geringe Ansprüche an den
Betrachter stellt: wirkend, weisend ist sie nie.
Innerhalb der Grenzen, auf die veristische
Kunst sich bescheidet, bringen Maler, wie
Adolf Dietrich, Josef Ach mann, Josef
P i 1 a r t z , Josef W e d e w e r und Ernst
Thoms, saubere und ansprechende Leistun-
gen hervor. Hier gehört auch Lenk hin, der
sich an der Ausstellung nicht beteiligt, und
Schrimpf, den man ausgelassen hat. Theo
Champion steht den Veristen nahe, läßt
sich aber nicht ohne weiteres in ihre Gruppe
einordnen; seine empfindsamen, sparsam hin-
gesetzten, etwas melancholischen Bildchen
greifen über die genannten Maler hinaus.
Nebenbei gesagt, scheinen uns die wahren
Fortsetzer der deutschen Romantik Crodel und
Gilles zu sein.
Der Maler Christof Drexel und der Bild-
hauer Ewald M a t a r e , 1886 und 1887 ge-
boren, pflegen eine stark vereinfachte Form;
man spürt jedoch, daß diese auf den ersten
Blick wohltuende Einfachheit nicht über die
nötigen Umwege erreicht worden ist, denn sie
gleitet zuweilen ins Leere und Dekorative.
Damit soll aber nichts gegen das im übrigen
recht positische Schaffen beider Künstler ge-
sagt sein. Altersgenossen sind auch die Maler
Max K a u s und Otto F r e y t a g , der erste
schon recht festgelegt und im Begriff, auf
bestechende Art banal zu werden, der zweite
frisch und vielleicht entwicklungsfähig.
Bei der Generation der Jahrhundertwende,
die besonders stark vertreten ist, macht sich
Man merkt der Ausstellung
an, daß sie nicht aus einer inne-
ren Verbundenheit mit dem zeit-
genössischen Schaffen entstan-
den ist. Man merkt ihr an, daß
die Vorarbeit nicht mit dem ge-
duldigen Zeitaufwand und dem unbedingten
Einsatz der Person betrieben worden ist, die
ein derartiges Unternehmen fordert. Die Aus-
stellung gibt einen unverbindlichen Quer-
schnitt, eine indifferente Auslese. Sie will
Allem gerecht werden, setzt keine Akzente und
hat infolgedessen kein rechtes Gesicht. Man
muß, wenn es um junge Kunst geht, einen
entschlossenen Standpunkt einnehmen. Wich-
tige Künstler fehlen. Einige (Fuhr, Lenk,
Scholz) haben sich nicht beteiligt. Andere hat
man übersehen, wieder andere nicht berück-
sichtigt, weil nur Bilder aufgenommen wurden.
Diese Festlegung auf Bilder ist vielleicht der
schwächste Punkt der Ausstellung. In einem
Lande, dessen Kunst von jeher und besonders
in den letzten .Jahrzehnten- gerade in der
Graphik ihr Bestes hervorgebracht hat, darf
man bei einer Ausstellung, die Lebendiges auf-
weisen will, die graphische Kunst nicht über-
gehen. Abschließend sei zu der Ausstellungs-
folge bemerkt, daß sie trotz aller Schönheits-
fehler einen aufschlußreichen Überblick über
die letzte Produktion unserer führenden
Meister (mit Ausnahme von Nolde und Beck-
mann, die nicht gewonnen werden konnten)
gegeben, einige Junge herausgestellt und eine
fruchtbare Diskussion hervorgerufen hat.
Kusenberg
Münzenfund im Hause
eines Antiquars
Bei den Abbrucharbeiten in der römischen
Straße via Alessandrina sind die Arbeiter in
drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Gold-
und Silberschätze gestoßen, die sorgsam in den
Mauern verborgen waren und die durchweg
aus Gold- und Silbermünzen, außerdem aus
wollte. Das theoretische Ziel ist durch eine
ausgedehnte wissenschaftliche Bearbeitung des
Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker er-
reicht. Anders verhält es sich schon mit den
wissenschaftlichen Folgerungen aus dieser
gleichwertigen Geltung der kunstgewerblichen
Denkmäler mit denen der sogenannten „hohen“
Künste. Und es mag vielleicht hierin be-
gründet sein, daß das zweite, das praktische
Ziel der Anregungen auf Industrie und Hand-
werk unerreicht blieb oder von falschen Vor-
aussetzungen aus angestrebt wurde, so daß
eigentlich den Kunstgewerbeschulen und in
jüngster Zeit den Experimentierwerkstätten
des Bauhauses die Fühlung mit der Industrie
überlassen blieb.
Es liegt im Wesen eines Kunstgewerbe-
museums, daß es mit den Fragen und Bedürf-
nissen der Zeit Schritt hält, überhaupt eine
mehr populäre als wissenschaftliche Tätigkeit
entfaltet. Das Stuttgarter Landesgewerbe-
museum ist durch seine Kitschsammlung po-
pulär geworden.
Es war eine aus-
gezeichnete Idee
von Pazaurek,
dem Publikum an
abschreckenden
Beispielen zu zei-
gen, aus welchen
formalen, mate-
rial- oder werk-
artigen Gründen
eine Geschmack-
losigkeit abge-
lehntwerde. Aber
mehr als eine
historische wäre
eine derart päda-
gogische Samm-
lung zur Erörte-
rung von Gegen-
wartsfragen ver-
pflichtet. Da-
durch aber, daß
diese Stuttgarter
Kitschsammlung
zeitlich mit dem
1933 Jahre 1910 etwa
abschloß, hatte
sie in unserer Zeit nur noch historische, aber
keine aktuelle Bedeutung mehr, während die
fruchtbare Idee des Gegenbeispiels gerade für
das heutige Industrie-, Bau- und Kunstgewerbe
ein dankbares Tätigkeitsfeld gehabt hätte.
Denn leider ist die allgemeine Geschmacks-
bildung nicht so sicher, daß unsere gegen-
wärtigen Industrieerzeugnisse und kunst-
gewerblichen Arbeiten einwandfrei wären, im
Gegenteil ist eine gewisse „Modernität“ zu
einer höchst bedenklichen Modeart geworden,
die ebneso sehr dem Kitsch zuzurechnen ist,
wie etwa die Materialungerechtigkeit von 1890.
Durch die Auflösung der kunsthistorischen
Abteilung des Landesgewerbemuseums und
deren Uebertragung an das allein dafür zu-
ständige Schloßmuseum wird nun die Bahn
frei für eine historisch unbelastete Bearbeitung
aktueller Gestaltungsfragen auf dem Gebiet
des Kunstgewerbes, des Handwerks und der
Industrie. Damit würde also neben der nega-
tiven auch die positive Lehr- und Schauaus-
stellung die Hauptaufgabe des Landesgewerbe-
Esaias van de Velde, Winterlandschaft
39 : 64,5 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm
Versteigerung — Vente — Sale:
Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte