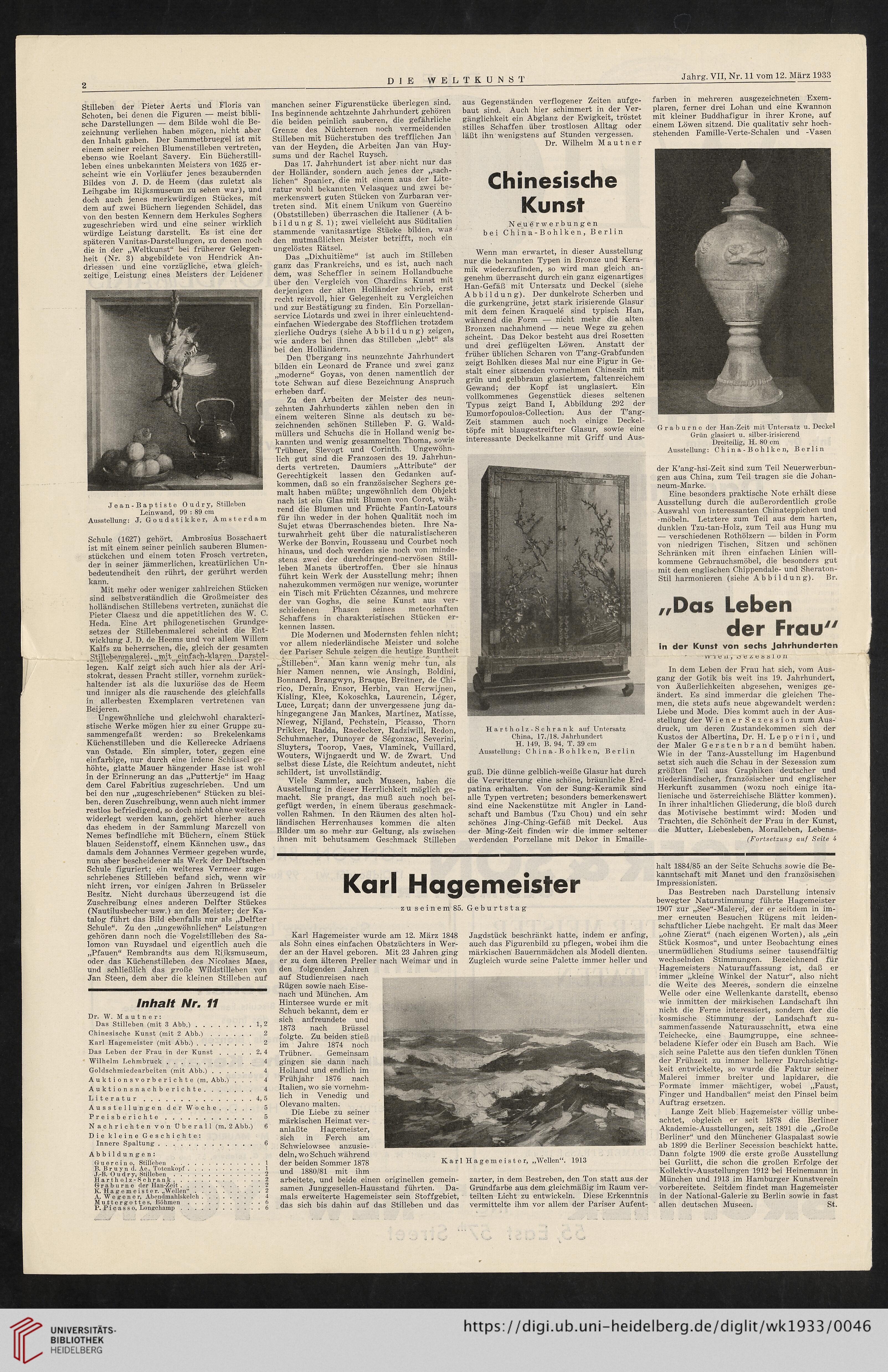2
DIE W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. März 1933
Stilleben der Pieter Aerts und Floris van
Schoten, bei denen die Figuren — meist bibli-
sche Darstellungen —■ dem Bilde wohl die Be-
zeichnung verliehen haben mögen, nicht aber
den Inhalt gaben. Der Sammetbruegel ist mit
einem seiner reichen Blumenstilleben vertreten,
ebenso wie Roelant Savery. Ein Bücherstill-
leben eines unbekannten Meisters von 1625 er-
scheint wie ein Vorläufer jenes bezaubernden
Bildes von J. D. de Heern (das zuletzt als
Leihgabe im Rijksmuseum zu sehen war), und
doch auch jenes merkwürdigen Stückes, mit
dem auf zwei Büchern liegenden Schädel, das
von den besten Kennern dem Herkules Seghers
zugeschrieben wird und eine seiner wirklich
würdige Leistung darstellt. Es ist eine der
späteren Vanitas-Darstellungen, zu denen noch
die in der „Weltkunst“ bei früherer Gelegen-
heit (Nr. 3) abgebildete von Hendrick An-
driessen und eine vorzügliche, etwa gleich-
zeitige . Leistung eines Meisters der Leidener
Jean-Baptiste Oudry, Stilleben
Leinwand, 99 : 89 cm
Ausstellung: J. Goudstikker, Amsterdam
Schule (1627) gehört. Ambrosius Bosschaert
ist mit einem seiner peinlich sauberen Blumen-
stückchen und einem toten Frosch vertreten,
der in seiner jämmerlichen, kreatürlichen Un-
bedeutendheit den rührt, der gerührt werden
kann.
Mit mehr oder weniger zahlreichen Stücken
sind selbstverständlich die Großmeister des
holländischen Stillebens vertreten, zunächst die
Pieter Claesz und die appetitlichen des W. C.
Heda. Eine Art philogenetischen Grundge-
setzes der Stillebenmalerei scheint die Ent-
wicklung J. D. de Heems und vor allem Willem
Kalfs zu beherrschen, die, gleich der gesamten
Stillebenmalerei, mit einfach-klaren Darstel-
„»pAA.llVll. M-llvl X 1UV1XU »> Cx V
legen. Kalf zeigt sich auch hier als der Ari-
stokrat, dessen Pracht stiller, vornehm zurück-
haltender ist als die luxuriöse des de Heern
und inniger als die rauschende des gleichfalls
in allerbesten Exemplaren vertretenen van
Beijeren.
Ungewöhnliche und gleichwohl charakteri-
stische Werke mögen hier zu einer Gruppe zu-
sammengefaßt werden: so Brekelenkams
Küchenstilleben und die Kellerecke Adriaens
van Ostade. Ein simpler, toter, gegen eine
einfarbige, nur durch eine irdene Schüssel ge-
höhte, glatte Mauer hängender Hase ist wohl
in der Erinnerung an das „Puttertje“ im Haag
dem Carei Fabritius zugeschrieben. Und um
bei den nur „zugeschriebenen“ Stücken zu blei-
ben, deren Zuschreibung, wenn auch nicht immer
restlos befriedigend, so doch nicht ohne weiteres
widerlegt werden kann, gehört hierher auch
das ehedem in der Sammlung Marczell von
Nemes befindliche mit Büchern, einem Stück
blauen Seidenstoff, einem Kännchen usw., das
damals dem Johannes Vermeer gegeben wurde,
nun aber bescheidener als Werk der Delftschen
Schule figuriert; ein weiteres Vermeer zuge-
schriebenes Stilleben befand sich, wenn wir
nicht irren, vor einigen Jahren in Brüsseler
Besitz. Nicht durchaus überzeugend ist die
Zuschreibung eines anderen Delfter Stückes
(Nautilusbecher usw.) an den Meister; der Ka-
talog führt das Bild ebenfalls nur als „Delfter
Schule“. Zu den „ungewöhnlichen“ Leistungen
gehören dann noch die Vogelstilleben des Sa-
lomon van Ruysdael und eigentlich auch die
„Pfauen“ Rembrandts aus dem Rijksmuseum,
oder das Küchenstilleben des Nicolaes Maes,
und schließlich das große Wildstilleben von
Jan Steen, dem aber die kleinen Stilleben auf
Inhalt Nr. 11
Dr. W. Mautner:
Das Stilleben (mit 3 Abb.).1, 2
Chinesische Kunst (mit 2 Abb.). 2
Karl Hagemeister (mit Abb.). 2
Das Leben der Frau in der Kunst.2, 4
Wilhelm Lehmbruck .. 4
Goldschmiedearbeiten (mit Abb.). 4
Auktionsvorberichte (m. Abb.) ... 4
Auktionsnachberichte. 4
Literatur.4, 5
Ausstellungen der Woche. 5
Preisberichte . 5
N ac hrichten von Überall (m. 2 Abb.) 6
Die kleine Geschichte:
Innere Spaltung. 6
Abbildungen:
Guercino, Stilleben.1
B. Bruyn d. Ae., Totenkopf.1
J. -B. Oudry, Stilleben.2
Hartholz-Schrank.2
Graburne der Han-Zeit.2
K. Ha g e m e i s t er. „Wellen“ ..2
A. Wegener, Abendmahlskelch.. 4
Muttergottes, Böhmen.6
P. P i c a s s o, Longchamp.6
manchen seiner Figurenstücke überlegen sind.
Ins beginnende achtzehnte Jahrhundert gehören
die beiden peinlich sauberen, die gefährliche
Grenze des Nüchternen noch vermeidenden
Stilleben mit Bücherstuben des trefflichen Jan
van der Heyden, die Arbeiten Jan van Huy-
sums und der Rachel Ruysch.
Das 17. Jahrhundert ist aber nicht nur das
der Holländer, sondern auch jenes der „sach-
lichen“ Spanier, die mit einem aus der Lite-
ratur wohl bekannten Velasquez und zwei be-
merkenswert guten Stücken von Zurbaran ver-
treten sind. Mit einem Unikum von Guercino
(Obststilleben) überraschen die. Italiener (Ab-
bildung S. 1); zwei vielleicht aus Süditalien
stammende vanitasartige Stücke bilden, was
den mutmaßlichen Meister betrifft, noch ein
ungelöstes Rätsel.
Das „Dixhuitieme“ ist auch im Stilleben
ganz das Frankreichs, und es ist, auch nach
dem, was Scheffler in seinem Hollandbuche
über den Vergleich von Chardins Kunst mit
derjenigen der alten Holländer schrieb, erst
recht reizvoll, hier Gelegenheit zu Vergleichen
und zur Bestätigung zu finden. Ein Porzellan-
service Liotards und zwei in ihrer einleuchtend-
einfachen Wiedergabe des Stofflichen trotzdem
zierliche Oudrys (siehe Abbildung) zeigen,
wie anders bei ihnen das Stilleben „lebt“ als
bei den Holländern.
Den Übergang ins neunzehnte Jahrhundert
bilden ein Leonard de France und zwei ganz
„moderne“ Goyas, von denen namentlich der
tote Schwan auf diese Bezeichnung Anspruch
erheben darf.
Zu den Arbeiten der Meister des neun-
zehnten Jahrhunderts zählen neben den in
einem weiteren Sinne als deutsch zu be-
zeichnenden schönen Stilleben F. G. Wald-
müllers und Schuchs die in Holland wenig be-
kannten und wenig gesammelten Thoma, sowie
Trübner, Slevogt und Corinth. Ungewöhn-
lich gut sind die Franzosen des 19. Jahrhun-
derts vertreten. Daumiers „Attribute“ der
Gerechtigkeit lassen den Gedanken auf-
kommen, daß so ein französischer Seghers ge-
malt haben müßte; ungewöhnlich dem Objekt
nach ist ein Glas mit Blumen von Corot, wäh-
rend die Blumen und Früchte Fantin-Latours
für ihn weder in der hohen Qualität noch im
Sujet etwas Überraschendes bieten. Ihre Na-
turwahrheit geht über die naturalistischeren
Werke der Bonvin, Rousseau und Courbet noch
hinaus, und doch werden sie noch von minde-
stens zwei der durchdringend-nervösen Still-
leben Manets übertroffen. Über sie hinaus
führt kein Werk der Ausstellung mehr; ihnen
nahezukommen vermögen nur wenige, worunter
ein Tisch mit Früchten Cezannes, und mehrere
der van Goghs, die seine Kunst aus ver-
schiedenen Phasen seines meteorhaften
Schaffens in charakteristischen Stücken er-
kennen lassen.
Die Modernen und Modernsten fehlen nicht;
vor allem niederländische Meister und solche
der Pariser Schule zeigen die heutige Buntheit
„Stilleben“. Man kann wenig mehr tun, als
hier Namen nennen, wie Ansingh, Boldini,
Bonnard, Brangwyn, Braque, Breitner, de Chi-
rico, Derain, Ensor, Herbin, van Herwijnen,
Kisling, Klee, Kokoschka, Laurencin, Leger,
Luce, Lurcat; dann der unvergessene jung da-
hingegangene Jan Mankes, Martinez, Matisse,
Nieweg, Nijland, Pechstein, Picasso, Thorn
Prikker, Radda, Raedecker, Radziwill, Redon,
Schuhmacher, Dunoyer de Segonzac, Severini,
Sluyters, Toorop, Vaes, Vlaminck, Vuillard,
Wouters, Wijngaerdt und W. de Zwart. Und
selbst diese Liste, die Reichtum andeutet, nicht
schildert, ist unvollständig.
Viele Sammler, auch Museen, haben die
Ausstellung in dieser Herrlichkeit möglich ge-
macht. Sie prangt, das muß auch noch bei-
gefügt werden, in einem überaus geschmack-
vollen Rahmen. In den Räumen des alten hol-
ländischen Herrenhauses kommen die alten
Bilder um so mehr zur Geltung, als zwischen
ihnen mit behutsamem Geschmack Stilleben
aus Gegenständen verflogener Zeiten aufge-
baut sind. Auch hier schimmert in der Ver-
gänglichkeit ein Abglanz der Ewigkeit, tröstet
stilles Schaffen über trostlosen Alltag oder
läßt ihn wenigstens auf Stunden vergessen.
Dr. Wilhelm Mautner
Chinesische
Kunst
Neuerwerbungen
bei C h i n a - B o h 1 k e n , Berlin
Wenn man erwartet, in dieser Ausstellung
nur die bekannten Typen in Bronze und Kera-
mik wiederzufinden, so wird man gleich an-
genehm überrascht durch ein ganz eigenartiges
Han-Gefäß mit Untersatz und Deckel (siehe
Abbildung). Der dunkelrote Scherben und
die gurkengrüne, jetzt stark irisierende Glasur
mit dem feinen Kraquele sind typisch Han,
während die Form — nicht mehr die alten
Bronzen nachahmend — neue Wege zu gehen
scheint. Das Dekor besteht aus drei Rosetten
und drei geflügelten Löwen. Anstatt der
früher üblichen Scharen von T’ang-Grabfunden
zeigt Bohlken dieses Mal nur eine Figur in Ge-
stalt einer sitzenden vornehmen Chinesin mit
grün und gelbbraun glasiertem, faltenreichem
Gewand; der Kopf ist unglasiert. Ein
vollkommenes Gegenstück dieses seltenen
Typus zeigt Band I, Abbildung 292 der
Eumorfopoulos-Collection. Aus der T’ang-
Zeit stammen auch noch einige Deckel-
töpfe mit blaugestreifter Glasur, sowie eine
interessante Deckelkanne mit Griff und Aus-
Hartholz-Schrank auf Untersatz
China, 17./18. Jahrhundert
H. 149, B. 94, T. 39 cm
Ausstellung: China -Bohlken, Berlin
guß. Die dünne gelblich-weiße Glasur hat durch
die Verwitterung eine schöne, bräunliche Erd-
patina erhalten. Von der Sung-Keramik sind
alle Typen vertreten; besonders bemerkenswert
sind eine Nackenstütze mit Angler in Land-
schaft und Bambus (Tzu Chou) und ein sehr
schönes Jing-Ching-Gefäß mit Deckel. Aus
der Ming-Zeit finden wir die immer seltener
werdenden Porzellane mit Dekor in Emaille-
farben in mehreren ausgezeichneten Exem-
plaren, ferner drei Lohan und eine Kwannon
mit kleiner Buddhafigur in ihrer Krone, auf
einem Löwen sitzend. Die qualitativ sehr hoch-
stehenden Famille-Verte-Schalen und -Vasen
Graburne der Han-Zeit mit Untersatz u. Deckel
Grün glasiert u. silber-irisierend
Dreiteilig, H. 80 cm
Ausstellung: China-Bohlken, Berlin
der K’ang-hsi-Zeit sind zum Teil Neuerwerbun-
gen aus China, zum Teil tragen sie die Johan-
neum-Marke.
Eine besonders praktische Note erhält diese
Ausstellung durch die außerordentlich große
Auswahl von interessanten Chinateppichen und
-möbeln. Letztere zum Teil aus dem harten,
dunklen Tzu-tan-Holz, zum Teil aus Hung mu
— verschiedenen Rothölzern — bilden in Form
von niedrigen Tischen, Sitzen und schönen
Schränken mit ihren einfachen Linien will-
kommene Gebrauchsmöbel, die besonders gut
mit dem englischen Chippendale- und Sheraton-
Stil harmonieren (siehe Abbildung). Br.
„Das Leben
der Frau"
in der Kunst von sechs Jahrhunderten
* wi u xi, oezeöbluii
In dem Leben der Frau hat sich, vom Aus-
gang der Gotik bis weit ins 19. Jahrhundert,
von Äußerlichkeiten abgesehen, weniges ge-
ändert. Es sind immerdar die gleichen The-
men, die stets aufs neue abgewandelt werden:
Liebe und Mode. Dies kommt auch in der Aus-
stellung der Wiener Sezession zum Aus-
druck, um deren Zustandekommen sich der
Kustos der Albertina, Dr. H. L e p o r i n i, und
der Maler Gerstenbrand bemüht haben.
Wie in der Tanz-Ausstellung im Hagenbund
setzt sich auch die Schau in der Sezession zum
größten Teil aus Graphiken deutscher und
niederländischer, französischer und englischer
Herkunft zusammen (wozu noch einige ita-
lienische und österreichische Blätter kommen).
In ihrer inhaltlichen Gliederung, die bloß durch
das Motivische bestimmt wird: Moden und
Trachten, die Schönheit der Frau in der Kunst,
die Mutter, Liebesleben, Moralleben, Lebens-
(Fortsetzung auf Seite 4
Karl Hagemeister
zu seinem 85. Geburtstag
Karl Hagemeister wurde am 12. März 1848
als Sohn eines einfachen Obstzüchters in Wer-
der an der Havel geboren. Mit 23 Jahren ging
er zu dem älteren Preller nach Weimar und in
den folgenden Jahren
auf Studienreisen nach
Rügen sowie nach Eise-
nach und München. Am
Hintersee wurde er mit
Schuch bekannt, dem er
sich anfreundete und
1873 nach Brüssel
folgte. Zu beiden stieß
im Jahre 1874 noch
Trübner. Gemeinsam
gingen sie dann nach
Holland und endlich im
Frühjahr 1876 nach
Italien, wo sie vornehm-
lich in Venedig und
Olevano malten.
Die Liebe zu seiner
märkischen Heimat ver-
anlaßte Hagemeister,
sich in Ferch am
Schwielowsee anzusie-
deln, wo Schuch während
der beiden Sommer 1878
und 1880/81 mit ihm
arbeitete, und beide einen originellen gemein-
samen Junggesellen-Hausstand führten. Da-
mals erweiterte Hagemeister sein Stoffgebiet,
das sich bis dahin auf das Stilleben und das
Jagdstück beschränkt hatte, indem er anfing,
auch das Figurenbild zu pflegen, wobei ihm die
märkischen Bauernmädchen als Modell dienten.
Zugleich wurde seine Palette immer heller und
zarter, in dem Bestreben, den Ton statt aus der
Grundfarbe aus dem gleichmäßig im Raum ver-
teilten Licht zu entwickeln. Diese Erkenntnis
vermittelte ihm vor allem der Pariser Aufent-
Karl Hagemeister, „Wellen“. 1913
halt 1884/85 an der Seite Schuchs sowie die Be-
kanntschaft mit Manet und den französischen
Impressionisten.
Das Bestreben nach Darstellung intensiv
bewegter Naturstimmung führte Hagemeister
1907 zur „See“-Malerei, der er seitdem in im-
mer erneuten Besuchen Rügens mit leiden-
schaftlicher Liebe nachgeht. Er malt das Meer
„ohne Zierat“ (nach eigenen Worten), als „ein
Stück Kosmos“, und unter Beobachtung eines
unermüdlichen Studiums seiner tausendfältig
wechselnden Stimmungen. Bezeichnend für
Hagemeisters Naturauffassung ist, daß er
immer „kleine Winkel der Natur“, also nicht
die Weite des Meeres, sondern die einzelne
Welle oder eine Wellenkante darstellt, ebenso
wie inmitten der märkischen Landschaft ihn
nicht die Ferne interessiert, sondern der die
kosmische Stimmung der Landschaft zu-
sammenfassende Naturausschnitt, etwa eine
Teichecke, eine Baumgruppe, eine schnee-
beladene Kiefer oder ein Busch am Bach. Wie
sich seine Palette aus den tiefen dunklen Tönen
der Frühzeit zu immer hellerer Durchsichtig-
keit entwickelte, so wurde die Faktur seiner
Malerei immer breiter und lapidarer, die
Formate immer mächtiger, wobei „Faust,
Finger und Handballen“ meist den Pinsel beim
Auftrag ersetzen.
Lange Zeit blieb Hagemeister völlig unbe-
achtet, obgleich er seit 1878 die Berliner
Akademie-Ausstellungen, seit 1891 die „Große
Berliner“ und den Münchener Glaspalast sowie
ab 1899 die Berliner Secession beschickt hatte.
Dann folgte 1909 die erste große Ausstellung
bei Gurlitt, die schon die großen Erfolge der
Kollektiv-Ausstellungen 1912 bei Heinemann in
München und 1913 im Hamburger Kunstverein
vorbereitete. Seitdem findet man Hagemeister
in der National-Galerie zu Berlin sowie in fast
allen deutschen Museen. St.
DIE W E L T K U N 8 T
Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. März 1933
Stilleben der Pieter Aerts und Floris van
Schoten, bei denen die Figuren — meist bibli-
sche Darstellungen —■ dem Bilde wohl die Be-
zeichnung verliehen haben mögen, nicht aber
den Inhalt gaben. Der Sammetbruegel ist mit
einem seiner reichen Blumenstilleben vertreten,
ebenso wie Roelant Savery. Ein Bücherstill-
leben eines unbekannten Meisters von 1625 er-
scheint wie ein Vorläufer jenes bezaubernden
Bildes von J. D. de Heern (das zuletzt als
Leihgabe im Rijksmuseum zu sehen war), und
doch auch jenes merkwürdigen Stückes, mit
dem auf zwei Büchern liegenden Schädel, das
von den besten Kennern dem Herkules Seghers
zugeschrieben wird und eine seiner wirklich
würdige Leistung darstellt. Es ist eine der
späteren Vanitas-Darstellungen, zu denen noch
die in der „Weltkunst“ bei früherer Gelegen-
heit (Nr. 3) abgebildete von Hendrick An-
driessen und eine vorzügliche, etwa gleich-
zeitige . Leistung eines Meisters der Leidener
Jean-Baptiste Oudry, Stilleben
Leinwand, 99 : 89 cm
Ausstellung: J. Goudstikker, Amsterdam
Schule (1627) gehört. Ambrosius Bosschaert
ist mit einem seiner peinlich sauberen Blumen-
stückchen und einem toten Frosch vertreten,
der in seiner jämmerlichen, kreatürlichen Un-
bedeutendheit den rührt, der gerührt werden
kann.
Mit mehr oder weniger zahlreichen Stücken
sind selbstverständlich die Großmeister des
holländischen Stillebens vertreten, zunächst die
Pieter Claesz und die appetitlichen des W. C.
Heda. Eine Art philogenetischen Grundge-
setzes der Stillebenmalerei scheint die Ent-
wicklung J. D. de Heems und vor allem Willem
Kalfs zu beherrschen, die, gleich der gesamten
Stillebenmalerei, mit einfach-klaren Darstel-
„»pAA.llVll. M-llvl X 1UV1XU »> Cx V
legen. Kalf zeigt sich auch hier als der Ari-
stokrat, dessen Pracht stiller, vornehm zurück-
haltender ist als die luxuriöse des de Heern
und inniger als die rauschende des gleichfalls
in allerbesten Exemplaren vertretenen van
Beijeren.
Ungewöhnliche und gleichwohl charakteri-
stische Werke mögen hier zu einer Gruppe zu-
sammengefaßt werden: so Brekelenkams
Küchenstilleben und die Kellerecke Adriaens
van Ostade. Ein simpler, toter, gegen eine
einfarbige, nur durch eine irdene Schüssel ge-
höhte, glatte Mauer hängender Hase ist wohl
in der Erinnerung an das „Puttertje“ im Haag
dem Carei Fabritius zugeschrieben. Und um
bei den nur „zugeschriebenen“ Stücken zu blei-
ben, deren Zuschreibung, wenn auch nicht immer
restlos befriedigend, so doch nicht ohne weiteres
widerlegt werden kann, gehört hierher auch
das ehedem in der Sammlung Marczell von
Nemes befindliche mit Büchern, einem Stück
blauen Seidenstoff, einem Kännchen usw., das
damals dem Johannes Vermeer gegeben wurde,
nun aber bescheidener als Werk der Delftschen
Schule figuriert; ein weiteres Vermeer zuge-
schriebenes Stilleben befand sich, wenn wir
nicht irren, vor einigen Jahren in Brüsseler
Besitz. Nicht durchaus überzeugend ist die
Zuschreibung eines anderen Delfter Stückes
(Nautilusbecher usw.) an den Meister; der Ka-
talog führt das Bild ebenfalls nur als „Delfter
Schule“. Zu den „ungewöhnlichen“ Leistungen
gehören dann noch die Vogelstilleben des Sa-
lomon van Ruysdael und eigentlich auch die
„Pfauen“ Rembrandts aus dem Rijksmuseum,
oder das Küchenstilleben des Nicolaes Maes,
und schließlich das große Wildstilleben von
Jan Steen, dem aber die kleinen Stilleben auf
Inhalt Nr. 11
Dr. W. Mautner:
Das Stilleben (mit 3 Abb.).1, 2
Chinesische Kunst (mit 2 Abb.). 2
Karl Hagemeister (mit Abb.). 2
Das Leben der Frau in der Kunst.2, 4
Wilhelm Lehmbruck .. 4
Goldschmiedearbeiten (mit Abb.). 4
Auktionsvorberichte (m. Abb.) ... 4
Auktionsnachberichte. 4
Literatur.4, 5
Ausstellungen der Woche. 5
Preisberichte . 5
N ac hrichten von Überall (m. 2 Abb.) 6
Die kleine Geschichte:
Innere Spaltung. 6
Abbildungen:
Guercino, Stilleben.1
B. Bruyn d. Ae., Totenkopf.1
J. -B. Oudry, Stilleben.2
Hartholz-Schrank.2
Graburne der Han-Zeit.2
K. Ha g e m e i s t er. „Wellen“ ..2
A. Wegener, Abendmahlskelch.. 4
Muttergottes, Böhmen.6
P. P i c a s s o, Longchamp.6
manchen seiner Figurenstücke überlegen sind.
Ins beginnende achtzehnte Jahrhundert gehören
die beiden peinlich sauberen, die gefährliche
Grenze des Nüchternen noch vermeidenden
Stilleben mit Bücherstuben des trefflichen Jan
van der Heyden, die Arbeiten Jan van Huy-
sums und der Rachel Ruysch.
Das 17. Jahrhundert ist aber nicht nur das
der Holländer, sondern auch jenes der „sach-
lichen“ Spanier, die mit einem aus der Lite-
ratur wohl bekannten Velasquez und zwei be-
merkenswert guten Stücken von Zurbaran ver-
treten sind. Mit einem Unikum von Guercino
(Obststilleben) überraschen die. Italiener (Ab-
bildung S. 1); zwei vielleicht aus Süditalien
stammende vanitasartige Stücke bilden, was
den mutmaßlichen Meister betrifft, noch ein
ungelöstes Rätsel.
Das „Dixhuitieme“ ist auch im Stilleben
ganz das Frankreichs, und es ist, auch nach
dem, was Scheffler in seinem Hollandbuche
über den Vergleich von Chardins Kunst mit
derjenigen der alten Holländer schrieb, erst
recht reizvoll, hier Gelegenheit zu Vergleichen
und zur Bestätigung zu finden. Ein Porzellan-
service Liotards und zwei in ihrer einleuchtend-
einfachen Wiedergabe des Stofflichen trotzdem
zierliche Oudrys (siehe Abbildung) zeigen,
wie anders bei ihnen das Stilleben „lebt“ als
bei den Holländern.
Den Übergang ins neunzehnte Jahrhundert
bilden ein Leonard de France und zwei ganz
„moderne“ Goyas, von denen namentlich der
tote Schwan auf diese Bezeichnung Anspruch
erheben darf.
Zu den Arbeiten der Meister des neun-
zehnten Jahrhunderts zählen neben den in
einem weiteren Sinne als deutsch zu be-
zeichnenden schönen Stilleben F. G. Wald-
müllers und Schuchs die in Holland wenig be-
kannten und wenig gesammelten Thoma, sowie
Trübner, Slevogt und Corinth. Ungewöhn-
lich gut sind die Franzosen des 19. Jahrhun-
derts vertreten. Daumiers „Attribute“ der
Gerechtigkeit lassen den Gedanken auf-
kommen, daß so ein französischer Seghers ge-
malt haben müßte; ungewöhnlich dem Objekt
nach ist ein Glas mit Blumen von Corot, wäh-
rend die Blumen und Früchte Fantin-Latours
für ihn weder in der hohen Qualität noch im
Sujet etwas Überraschendes bieten. Ihre Na-
turwahrheit geht über die naturalistischeren
Werke der Bonvin, Rousseau und Courbet noch
hinaus, und doch werden sie noch von minde-
stens zwei der durchdringend-nervösen Still-
leben Manets übertroffen. Über sie hinaus
führt kein Werk der Ausstellung mehr; ihnen
nahezukommen vermögen nur wenige, worunter
ein Tisch mit Früchten Cezannes, und mehrere
der van Goghs, die seine Kunst aus ver-
schiedenen Phasen seines meteorhaften
Schaffens in charakteristischen Stücken er-
kennen lassen.
Die Modernen und Modernsten fehlen nicht;
vor allem niederländische Meister und solche
der Pariser Schule zeigen die heutige Buntheit
„Stilleben“. Man kann wenig mehr tun, als
hier Namen nennen, wie Ansingh, Boldini,
Bonnard, Brangwyn, Braque, Breitner, de Chi-
rico, Derain, Ensor, Herbin, van Herwijnen,
Kisling, Klee, Kokoschka, Laurencin, Leger,
Luce, Lurcat; dann der unvergessene jung da-
hingegangene Jan Mankes, Martinez, Matisse,
Nieweg, Nijland, Pechstein, Picasso, Thorn
Prikker, Radda, Raedecker, Radziwill, Redon,
Schuhmacher, Dunoyer de Segonzac, Severini,
Sluyters, Toorop, Vaes, Vlaminck, Vuillard,
Wouters, Wijngaerdt und W. de Zwart. Und
selbst diese Liste, die Reichtum andeutet, nicht
schildert, ist unvollständig.
Viele Sammler, auch Museen, haben die
Ausstellung in dieser Herrlichkeit möglich ge-
macht. Sie prangt, das muß auch noch bei-
gefügt werden, in einem überaus geschmack-
vollen Rahmen. In den Räumen des alten hol-
ländischen Herrenhauses kommen die alten
Bilder um so mehr zur Geltung, als zwischen
ihnen mit behutsamem Geschmack Stilleben
aus Gegenständen verflogener Zeiten aufge-
baut sind. Auch hier schimmert in der Ver-
gänglichkeit ein Abglanz der Ewigkeit, tröstet
stilles Schaffen über trostlosen Alltag oder
läßt ihn wenigstens auf Stunden vergessen.
Dr. Wilhelm Mautner
Chinesische
Kunst
Neuerwerbungen
bei C h i n a - B o h 1 k e n , Berlin
Wenn man erwartet, in dieser Ausstellung
nur die bekannten Typen in Bronze und Kera-
mik wiederzufinden, so wird man gleich an-
genehm überrascht durch ein ganz eigenartiges
Han-Gefäß mit Untersatz und Deckel (siehe
Abbildung). Der dunkelrote Scherben und
die gurkengrüne, jetzt stark irisierende Glasur
mit dem feinen Kraquele sind typisch Han,
während die Form — nicht mehr die alten
Bronzen nachahmend — neue Wege zu gehen
scheint. Das Dekor besteht aus drei Rosetten
und drei geflügelten Löwen. Anstatt der
früher üblichen Scharen von T’ang-Grabfunden
zeigt Bohlken dieses Mal nur eine Figur in Ge-
stalt einer sitzenden vornehmen Chinesin mit
grün und gelbbraun glasiertem, faltenreichem
Gewand; der Kopf ist unglasiert. Ein
vollkommenes Gegenstück dieses seltenen
Typus zeigt Band I, Abbildung 292 der
Eumorfopoulos-Collection. Aus der T’ang-
Zeit stammen auch noch einige Deckel-
töpfe mit blaugestreifter Glasur, sowie eine
interessante Deckelkanne mit Griff und Aus-
Hartholz-Schrank auf Untersatz
China, 17./18. Jahrhundert
H. 149, B. 94, T. 39 cm
Ausstellung: China -Bohlken, Berlin
guß. Die dünne gelblich-weiße Glasur hat durch
die Verwitterung eine schöne, bräunliche Erd-
patina erhalten. Von der Sung-Keramik sind
alle Typen vertreten; besonders bemerkenswert
sind eine Nackenstütze mit Angler in Land-
schaft und Bambus (Tzu Chou) und ein sehr
schönes Jing-Ching-Gefäß mit Deckel. Aus
der Ming-Zeit finden wir die immer seltener
werdenden Porzellane mit Dekor in Emaille-
farben in mehreren ausgezeichneten Exem-
plaren, ferner drei Lohan und eine Kwannon
mit kleiner Buddhafigur in ihrer Krone, auf
einem Löwen sitzend. Die qualitativ sehr hoch-
stehenden Famille-Verte-Schalen und -Vasen
Graburne der Han-Zeit mit Untersatz u. Deckel
Grün glasiert u. silber-irisierend
Dreiteilig, H. 80 cm
Ausstellung: China-Bohlken, Berlin
der K’ang-hsi-Zeit sind zum Teil Neuerwerbun-
gen aus China, zum Teil tragen sie die Johan-
neum-Marke.
Eine besonders praktische Note erhält diese
Ausstellung durch die außerordentlich große
Auswahl von interessanten Chinateppichen und
-möbeln. Letztere zum Teil aus dem harten,
dunklen Tzu-tan-Holz, zum Teil aus Hung mu
— verschiedenen Rothölzern — bilden in Form
von niedrigen Tischen, Sitzen und schönen
Schränken mit ihren einfachen Linien will-
kommene Gebrauchsmöbel, die besonders gut
mit dem englischen Chippendale- und Sheraton-
Stil harmonieren (siehe Abbildung). Br.
„Das Leben
der Frau"
in der Kunst von sechs Jahrhunderten
* wi u xi, oezeöbluii
In dem Leben der Frau hat sich, vom Aus-
gang der Gotik bis weit ins 19. Jahrhundert,
von Äußerlichkeiten abgesehen, weniges ge-
ändert. Es sind immerdar die gleichen The-
men, die stets aufs neue abgewandelt werden:
Liebe und Mode. Dies kommt auch in der Aus-
stellung der Wiener Sezession zum Aus-
druck, um deren Zustandekommen sich der
Kustos der Albertina, Dr. H. L e p o r i n i, und
der Maler Gerstenbrand bemüht haben.
Wie in der Tanz-Ausstellung im Hagenbund
setzt sich auch die Schau in der Sezession zum
größten Teil aus Graphiken deutscher und
niederländischer, französischer und englischer
Herkunft zusammen (wozu noch einige ita-
lienische und österreichische Blätter kommen).
In ihrer inhaltlichen Gliederung, die bloß durch
das Motivische bestimmt wird: Moden und
Trachten, die Schönheit der Frau in der Kunst,
die Mutter, Liebesleben, Moralleben, Lebens-
(Fortsetzung auf Seite 4
Karl Hagemeister
zu seinem 85. Geburtstag
Karl Hagemeister wurde am 12. März 1848
als Sohn eines einfachen Obstzüchters in Wer-
der an der Havel geboren. Mit 23 Jahren ging
er zu dem älteren Preller nach Weimar und in
den folgenden Jahren
auf Studienreisen nach
Rügen sowie nach Eise-
nach und München. Am
Hintersee wurde er mit
Schuch bekannt, dem er
sich anfreundete und
1873 nach Brüssel
folgte. Zu beiden stieß
im Jahre 1874 noch
Trübner. Gemeinsam
gingen sie dann nach
Holland und endlich im
Frühjahr 1876 nach
Italien, wo sie vornehm-
lich in Venedig und
Olevano malten.
Die Liebe zu seiner
märkischen Heimat ver-
anlaßte Hagemeister,
sich in Ferch am
Schwielowsee anzusie-
deln, wo Schuch während
der beiden Sommer 1878
und 1880/81 mit ihm
arbeitete, und beide einen originellen gemein-
samen Junggesellen-Hausstand führten. Da-
mals erweiterte Hagemeister sein Stoffgebiet,
das sich bis dahin auf das Stilleben und das
Jagdstück beschränkt hatte, indem er anfing,
auch das Figurenbild zu pflegen, wobei ihm die
märkischen Bauernmädchen als Modell dienten.
Zugleich wurde seine Palette immer heller und
zarter, in dem Bestreben, den Ton statt aus der
Grundfarbe aus dem gleichmäßig im Raum ver-
teilten Licht zu entwickeln. Diese Erkenntnis
vermittelte ihm vor allem der Pariser Aufent-
Karl Hagemeister, „Wellen“. 1913
halt 1884/85 an der Seite Schuchs sowie die Be-
kanntschaft mit Manet und den französischen
Impressionisten.
Das Bestreben nach Darstellung intensiv
bewegter Naturstimmung führte Hagemeister
1907 zur „See“-Malerei, der er seitdem in im-
mer erneuten Besuchen Rügens mit leiden-
schaftlicher Liebe nachgeht. Er malt das Meer
„ohne Zierat“ (nach eigenen Worten), als „ein
Stück Kosmos“, und unter Beobachtung eines
unermüdlichen Studiums seiner tausendfältig
wechselnden Stimmungen. Bezeichnend für
Hagemeisters Naturauffassung ist, daß er
immer „kleine Winkel der Natur“, also nicht
die Weite des Meeres, sondern die einzelne
Welle oder eine Wellenkante darstellt, ebenso
wie inmitten der märkischen Landschaft ihn
nicht die Ferne interessiert, sondern der die
kosmische Stimmung der Landschaft zu-
sammenfassende Naturausschnitt, etwa eine
Teichecke, eine Baumgruppe, eine schnee-
beladene Kiefer oder ein Busch am Bach. Wie
sich seine Palette aus den tiefen dunklen Tönen
der Frühzeit zu immer hellerer Durchsichtig-
keit entwickelte, so wurde die Faktur seiner
Malerei immer breiter und lapidarer, die
Formate immer mächtiger, wobei „Faust,
Finger und Handballen“ meist den Pinsel beim
Auftrag ersetzen.
Lange Zeit blieb Hagemeister völlig unbe-
achtet, obgleich er seit 1878 die Berliner
Akademie-Ausstellungen, seit 1891 die „Große
Berliner“ und den Münchener Glaspalast sowie
ab 1899 die Berliner Secession beschickt hatte.
Dann folgte 1909 die erste große Ausstellung
bei Gurlitt, die schon die großen Erfolge der
Kollektiv-Ausstellungen 1912 bei Heinemann in
München und 1913 im Hamburger Kunstverein
vorbereitete. Seitdem findet man Hagemeister
in der National-Galerie zu Berlin sowie in fast
allen deutschen Museen. St.