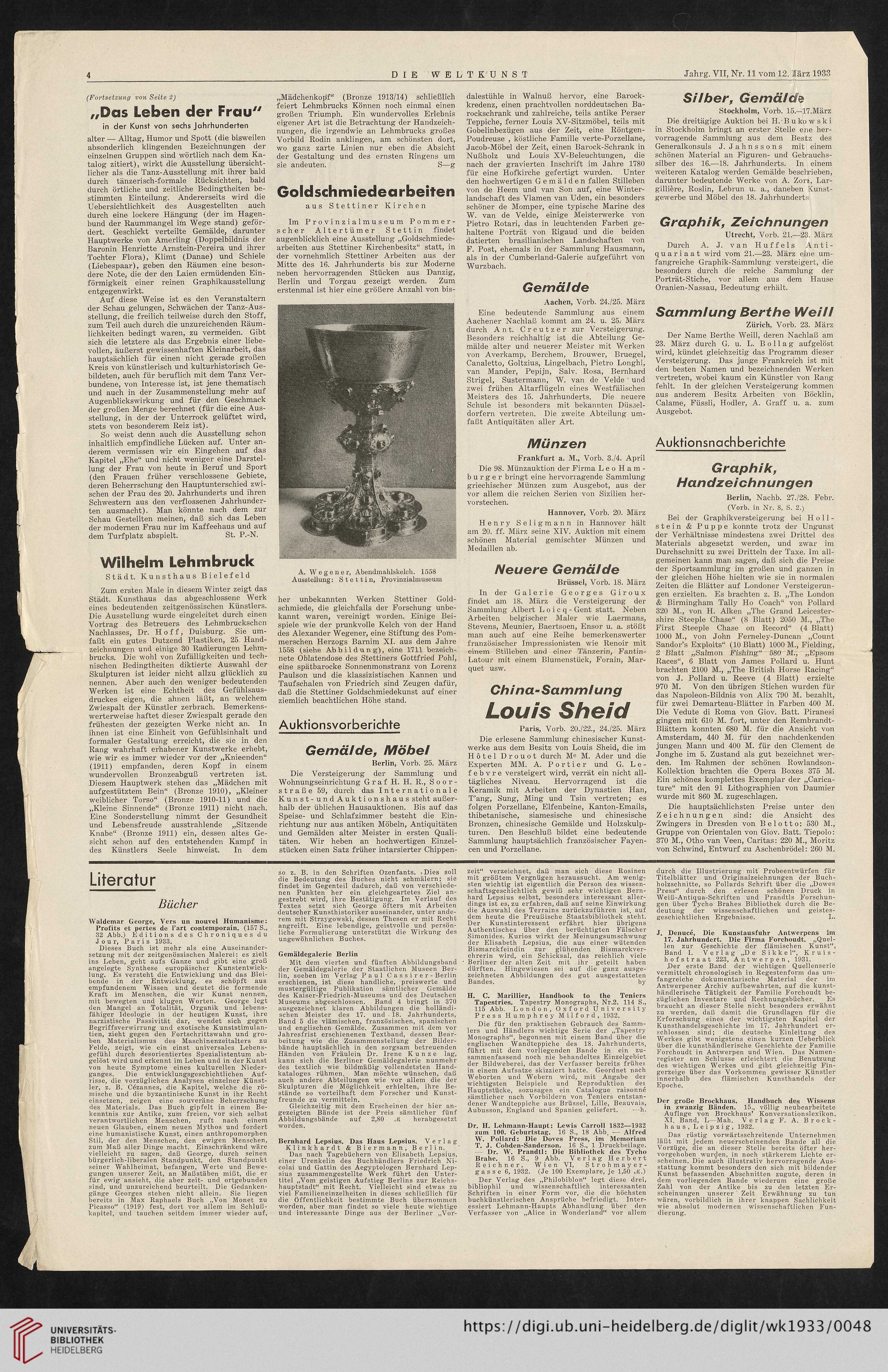4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. Järz 1933
(Fortsetzung von Seite 2)
„Das Leben der Frau"
in der Kunst von sechs Jahrhunderten
alter — Alltag, Humor und Spott (die bisweilen
absonderlich klingenden Bezeichnungen der
einzelnen Gruppen sind wörtlich nach dem Ka-
talog zitiert), wirkt die Ausstellung übersicht-
licher als die Tanz-Ausstellung mit ihrer bald
durch tänzerisch-formale Rücksichten, bald
durch örtliche und zeitliche Bedingtheiten be-
stimmten Einteilung. Andererseits wird die
Uebersichtlichkeit des Ausgestellten auch
durch eine lockere Hängung (der im Hagen-
bund der Raummangel im Wege stand) geför-
dert. Geschickt verteilte Gemälde, darunter
Hauptwerke von Amerling (Doppelbildnis dei-
Baronin Henriette Arnstein-Pereira und ihrer
Tochter Flora), Klimt (Danae) und Schiele
(Liebespaar), geben den Räumen eine beson-
dere Note, die der den Laien ermüdenden Ein-
förmigkeit einer reinen Graphikausstellung
entgegenwirkt.
Auf diese Weise ist es den Veranstaltern
der Schau gelungen, Schwächen der Tanz-Aus-
stellung, die freilich teilweise durch den Stoff,
zum Teil auch durch die unzureichenden Räum-
lichkeiten bedingt waren, zu vermeiden. Gibt
sich die letztere als das Ergebnis einer liebe-
vollen, äußerst gewissenhaften Kleinarbeit, das
hauptsächlich für einen nicht gerade großen
Kreis von künstlerisch und kulturhistorisch Ge-
bildeten, auch für beruflich mit dem Tanz Ver-
bundene, von Interesse ist, ist jene thematisch
und auch in der Zusammenstellung mehr auf
Augenblickswirkung und für den Geschmack
der großen Menge berechnet (für die eine Aus-
stellung, in der der Unterrock gelüftet wird,
stets von besonderem Reiz ist).
So weist denn auch die Ausstellung schon
inhaltlich empfindliche Lücken auf. Unter an-
derem vermissen wir ein Eingehen auf das
Kapitel „Ehe“ und nicht weniger eine Darstel-
lung der Frau von heute in Beruf und Sport
(den Frauen früher verschlossene Gebiete,
deren Beherrschung den Hauptunterschied zwi-
schen der Frau des 20. Jahrhunderts und ihren
Schwestern aus den verflossenen Jahrhunder-
ten ausmacht). Man könnte nach dem zur
Schau Gestellten meinen, daß sich das Leben
der modernen Frau nur im Kaffeehaus und auf
dem Turfplatz abspielt. St. P.-N.
Wilhelm Lehmbruck
Städt. Kunsthaus Bielefeld
Zum ersten Male in diesem Winter zeigt das
Städt. Kunsthaus das abgeschlossene Werk
eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers.
Die Ausstellung wurde eingeleitet durch einen
Vortrag des Betreuers des Lehmbruckschen
Nachlasses, Dr. Hoff, Duisburg. Sie um-
faßt ein gutes Dutzend Plastiken, 25 Hand-
zeichnungen und einige 30 Radierungen Lehm-
brucks. Die wohl von Zufälligkeiten und tech-
nischen Bedingtheiten diktierte Auswahl der
Skulpturen ist leider nicht allzu glücklich zu
nennen. Aber auch den weniger bedeutenden
Werken ist eine Echtheit des Gefühlsaus-
druckes eigen, die ahnen läßt, an welchem
Zwiespalt der Künstler zerbrach. Bemerkens-
werterweise haftet dieser Zwiespalt gerade den
frühesten der gezeigten Werke nicht an. In
ihnen ist eine Einheit von Gefühlsinhalt und
formaler Gestaltung erreicht, die sie in den
Rang wahrhaft erhabener Kunstwerke erhebt,
wie wir es immer wieder vor der „Knieenden“
(1911) empfanden, deren Kopf in einem
wundervollen Bronzeabguß vertreten ist.
Diesem Hauptwerk stehen das „Mädchen mit
aufgestütztem Bein“ (Bronze 1910), „Kleiner
weiblicher Torso“ (Bronze 1910-11) und die
„Kleine Sinnende“ (Bronze 1911) nicht nach.
Eine Sonderstellung nimmt der Gesundheit
und Lebensfreude ausstrahlende „Sitzende
Knabe“ (Bronze 1911) ein, dessen altes Ge-
sicht schon auf den entstehenden Kampf in
des Künstlers Seele hinweist. In dem
„Mädchenkopf“ (Bronze 1913/14) schließlich
feiert Lehmbrucks Können noch einmal einen
großen Triumph. Ein wundervolles Erlebnis
eigener Art ist die Betrachtung der Handzeich-
nungen, die irgendwie an Lehmbrucks großes
Vorbild Rodin anklingen, am schönsten dort,
wo ganz zarte Linien nur eben die Absicht
der Gestaltung und des ernsten Ringens um
sie andeuten. S—g
Goldschmiedearbeiten
aus Stettiner Kirchen
Im Provinzialmuseum Pommer-
scher Altertümer Stettin findet
augenblicklich eine Ausstellung „Goldschmiede-
arbeiten aus Stettiner Kirchenbesitz“ statt, in
der vornehmlich Stettiner Arbeiten aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Moderne
neben hervorragenden Stücken aus Danzig,
Berlin und Torgau gezeigt werden. Zum
erstenmal ist hier eine größere Anzahl von bis-
A. Wegener, Abendmahlskelch. 1558
Ausstellung: Stettin, Provinzialmuseum
her unbekannten Werken Stettiner Gold-
schmiede, die gleichfalls der Forschung unbe-
kannt waren, vereinigt worden. Einige Bei-
spiele wie der prunkvolle Kelch von der Hand
des Alexander Wegener, eine Stiftung des Pom-
merschen Herzogs Barnim XI. aus dem Jahre
1558 (siehe Abbildung), eine 1711 bezeich-
nete Oblatendose des Stettiners Gottfried Pohl,
eine spätbarocke Sonnenmonstranz von Lorenz
Paulson und die klassizistischen Kannen und
Taufschalen von Friedrich sind Zeugen dafür,
daß die Stettiner Goldschmiedekunst auf einer
ziemlich beachtlichen Höhe stand.
Auktionsvorberichte
Gemälde, Möbel
Berlin, Vorb. 25. März
Die Versteigerung der Sammlung und
Wohnungseinrichtung Graf H. H. R., Soor-
straße 59, durch das Internationale
Kunst-undAuktionshaus steht außer-
halb der üblichen Hausauktionen. Bis auf das
Speise- und Schlafzimmer besteht die Ein-
richtung nur aus antiken Möbeln, Antiquitäten
und Gemälden alter Meister in ersten Quali-
täten. Wir heben an hochwertigen Einzel-
stücken einen Satz früher intarsierter Chippen-
dalestühle in Walnuß hervor, eine Barock-
kredenz, einen prachtvollen norddeutschen Ba-
rockschrank und zahlreiche, teils antike Perser
Teppiche, ferner Louis XV-Sitzmöbel, teils mit
Gobelinbezügen aus der Zeit, eine Röntgen-
Poudreuse , köstliche Familie verte-Porzellane,
Jacob-Möbel der Zeit, einen Barock-Schrank in
Nußholz und Louis XV-Beleuchtungen, die
nach der gravierten Inschrift im Jahre 1780
für eine Hofkirche gefertigt wurden. Unter
den hochwertigen Gemälden fallen Stilleben
von de Heem und van Son auf, eine Winter-
landschaft des Vlamen van Uden, ein besonders
schöner de Momper, eine typische Marine des
W. van de Velde, einige Meisterwerke von
Pietro Rotari, das in leuchtenden Farben ge-
haltene Porträt von Rigaud und die beiden
datierten brasilianischen Landschaften von
F. Post, ehemals in der Sammlung Hausmann,
als in der Cumberland-Galerie aufgeführt von
Wurzbach.
Gemälde
Aachen, Vorb. 24./25. März
Eine bedeutende Sammlung aus einem
Aachener Nachlaß kommt am 24. u. 25.- März
durch Ant. Creutzer zur Versteigerung.
Besonders reichhaltig ist die Abteilung Ge-
mälde alter und neuerer Meister mit Werken
von Averkamp, Berchem, Brouwer, Bruegel,
Canaletto, Goltzius, Lingelbach, Pietro Longhi,
van Mander, Pepijn, Salv. Rosa, Bernhard
Strigel, Sustermann, W. van de Velde ' und
zwei frühen Altarflügeln eines Westfälischen
Meisters des 15. Jahrhunderts. Die neuere
Schule ist besonders mit bekannten Düssel-
dorfern vertreten. Die zweite Abteilung um-
faßt Antiquitäten aller Art.
Münzen
Frankfurt a. M„ Vorb. 3-/4. April
Die 98. Münzauktion der Firma L e o Ham-
burger bringt eine hervorragende Sammlung
griechischer Münzen zum Ausgebot, aus der
vor allem die reichen Serien von Sizilien her-
vorstechen.
Hannover, Vorb. 20. März
Henry Seligmann in Hannover hält
am 20. ff. März seine XIV. Auktion mit einem
schönen Material gemischter Münzen und
Medaillen ab.
Neuere Gemälde
Brüssel, Vorb. 18. März
In der Galerie Georges Giroux
findet am 18. März die Versteigerung der
Sammlung Albert L o i c q - Gent statt. Neben
Arbeiten belgischer Maler wie Laermans,
Stevens, Meunier, Baertsoen, Ensor u. a. stößt
man auch auf eine Reihe bemerkenswerter
französischer Impressionisten wie Renoir mit
einem Stilleben und einer Tänzerin, Fantin-
Latour mit einem Blumenstück, Forain, Mar-
quet usw.
Chi na-Sammlung
Louis Sheid
Paris, Vorb. 20.122., 24./25. März
Die erlesene Sammlung chinesischer Kunst-
werke aus dem Besitz von Louis Sheid, die im
Hotel Drouot durch Me M. Ader und die
Experten MM. A. Portier und G. Le-
febvre versteigert wird, verrät ein nicht all-
tägliches Niveau. Hervorragend ist die
Keramik mit Arbeiten der Dynastien Han,
T’ang, Sung, Ming und Tsin vertreten; es
folgen Porzellane, Elfenbeine, Kanton-Emails,
thibetanische, siamesische und chinesische
Bronzen, chinesische Gemälde und Holzskulp-
turen. Den Beschluß bildet eine bedeutende
Sammlung hauptsächlich französischer Fayen-
cen und Porzellane.
Silber, Gemälde
Stockholm, Vorb. 15.—17.März
Die dreitägige Auktion bei H.-Bukowski
in Stockholm bringt an erster Stelle ene her-
vorragende Sammlung aus dem Bestz des
Generalkonsuls J. Jahnssons mit einem
schönen Material an Figuren- und Gebrauchs-
silber des 16.—18. Jahrhunderts. In einem
weiteren Katalog werden Gemälde beschrieben,
darunter bedeutende Werke von A. Zorn, Lar-
gilliere, Roslin, Lebrun u. a., daneben Kunst-
gewerbe und Möbel des 18. Jahrhunderts.
Graphik, Zeichnungen
Utrecht, Vorb. 21.—23. März
Durch A. J. van Huffels Anti-
qua r i a a t wird vom 21.—23. März eine um-
fangreiche Graphik-Sammlung versteigert, die
besonders durch die reiche Sammlung der
Porträt-Stiche, vor allem aus dem Hause
Oranien-Nassau, Bedeutung erhält.
Sammlung Berthe Weill
Zürich, Vorb. 23. März
Der Name Berthe Weill, deren Nachlaß am
23. März durch G. u. L. B o 11 a g aufgelöst
wird, kündet gleichzeitig das Programm dieser
Versteigerung. Das junge Frankreich ist mit
den besten Namen und bezeichnenden Werken
vertreten, wobei kaum ein Künstler von Rang
fehlt. In der gleichen Versteigerung kommen
aus anderem Besitz Arbeiten von Böcklin,
Calame, Füssli, Hodler, A. Graff u. a. zum
Ausgebot.
Auktionsnach berichte
Graphik,
Handzeichnungen
Berlin, Nachb. 27./28. Febr.
(Vorb. in Nr. 8, S. 2.)
Bei der Graphik Versteigerung bei Holl-
stein & Puppe konnte trotz der Ungunst
der Verhältnisse mindestens zwei Drittel des
Materials abgesetzt werden, und zwar im
Durchschnitt zu zwei Dritteln der Taxe. Im all-
gemeinen kann man sagen, daß sich die Preise
der Sportsammlung im großen und ganzen in
der gleichen Höhe hielten wie sie in normalen
Zeiten die Blätter auf Londoner Versteigerun-
gen erzielten. Es brachten z. B. „The London
& Birmingham Tally Ho Coach“ von Pollard
320 M., von H. Alken „The Grand Leicester-
shire Steeple Chase“ (8 Blatt) 2050 M., „The
First Steeple Chase on Record“ (4 Blatt)
1000 M., von John Ferneley-Duncan „Count
Sandor’s Exploits“ (10 Blatt) 1000 M., Fielding,
2 Blatt „Salmon Fishing“ 580 M., „Epsom
Races“, 6 Blatt von James Pollard u. Hunt
brachten 2100 M., „The British Horse Racing“
von J. Pollard u. Reeve (4 Blatt) erzielte
970 M. Von den übrigen Stichen wurden für
das Napoleon-Bildnis von Alix 790 M. bezahlt,
für zwei Demarteau-Blätter in Farben 400 M.
Die Vedute di Roma von Giov. Batt. Piranesi
gingen mit 610 M. fort, unter den Rembrandt-
Blättern konnten 680 M. für die Ansicht von
Amsterdam, 440 M. für den nachdenkenden
jungen Mann und 400 M. für den Clement de
Jonghe im 5. Zustand als gut bezeichnet wer-
den. Im Rahmen der schönen Rowlandson-
Kollektion brachten die Opera Boxes 375 M.
Ein schönes komplettes Exemplar der „Carica-
ture“ mit den 91 Lithographien von Daumier
wurde mit 860 M. zugeschlagen.
Die hauptsächlichsten Preise unter den
Zeichnungen sind: die Ansicht des
Zwingers in Dresden von Belotto: 530 M.,
Gruppe von Orientalen von Giov. Batt. Tiepolo:
370 M., Otho van Veen, Caritas: 220 M., Moritz
von Schwind, Entwurf zu Aschenbrödel: 260 M.
Literatur
Bücher
Waldemar George, Vers un nouvel Humanisme:
Profits et pertes de Part contemporain. (157 S.,
32 Abb.) Editions des Chroniques du
Jour, Paris 1933.
Dieses Buch ist mehr als eine Auseinander-
setzung mit der zeitgenössischen Malerei: es zielt
ins Leben, geht aufs Ganze und gibt eine groß
angelegte Synthese europäischer Kunstentwick-
lung. Es versteht die Entwicklung und das Blei-
bende in der Entwicklung, es schöpft aus
empfundenem Wissen und deutet die formende
Kraft im Menschen, die wir Kunst nennen,
mit bewegten und klugen Worten. George legt
den Mangel an Totalität, Organik und lebens-
fähiger Ideologie in der heutigen Kunst, ihre
narzistische Passivität dar, wendet sich gegen
Begriffsverwirrung und exotische Kunststimulan-
tien, zieht gegen den Fortschrittswahn und gro-
ben Materialismus des Maschinenzeitalters zu
Felde, zeigt, wie ein einst universales Lebens-
gefühl durch desorientiertes Spezialistentum ab-
gelöst wird und erkennt im Leben und in der Kunst
von heute Symptome eines kulturellen Nieder-
ganges. Die entwicklungsgeschichtlichen Auf-
risse, die vorzüglichen Analysen einzelner Künst-
ler, z. B. Cezannes, die Kapitel, welche die rö-
mische und die byzantinische Kunst in ihr Recht
einsetzen, zeigen eine souveräne Beherrschung
des Materials. Das Buch gipfelt in einem Be-
kenntnis ztir Antike, zum freien, vor sich selbst
verantwortlichen Menschen, ruft nach einem
neuen Glauben, einem neuen Mythos und fordert
eine humanistische Kunst, einen anthropomorphen
Stil, der den Menschen, den ewigen Menschen,
zum Maß aller Dinge macht. Einschränkend wäre
vielleicht zu sagen, daß George, durch seinen
bürgerlich-liberalen Standpunkt, den Standpunkt
seiner Wahlheimat, befangen, Werte und Bewe-
gungen unserer Zeit, an Maßstäben mißt, die er
für ewig ansieht, die aber zeit- und ortgebunden
sind, und unzureichend beurteilt. Die Gedanken-
gänge Georges stehen nicht allein. Sie liegen
bereits in Max Raphaels Buch „Von Monet zu
Picasso“ (1919) fest, dort vor allem im Schluß-
kapitel, und tauchen seitdem immer wieder auf,
so z. B. in den Schriften Ozenfants. Dies soll
die Bedeutung des Buches nicht schmälern; sie
findet im Gegenteil dadurch, daß von verschiede-
nen Punkten her ein gleichgeartetes Ziel an-
gestrebt wird, ihre Bestätigung. Im Verlauf des
Textes setzt sich George öfters mit Arbeiten
deutscher Kunsthistoriker auseinander, unter ande-
rem mit Strzygowski, dessen Thesen er mit Recht
angreift. Eine lebendige, geistvolle und persön-
liche Formulierung unterstützt die Wirkung des
ungewöhnlichen Buches.
Gemäldegalerie Berlin
Mit dem vierten und fünften Abbildungsband
der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Ber-
lin, soeben im Verlag Paul C a s s i r e r - Berlin
erschienen, ist diese handliche, preiswerte und
mustergültige Publikation sämtlicher Gemälde
des Kaiser-Friedrich-Museums und des Deutschen
Museums abgeschlossen. Band 4 bringt in 370
ausgezeichnet klaren Abbildungen die holländi-
schen Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,
Band 5 die vlämischen, französischen, spanischen
und englischen Gemälde. Zusammen mit dem vor
Jahresfrist erschienenen Textband, dessen Bear-
beitung wie die Zusammenstellung der Bilder-
bände hauptsächlich in den sorgsam betreuenden
Händen von Fräulein Dr. Irene Kunze lag,
kann sich die Berliner Gemäldegalerie nunmehr
des textlich wie bildmäßig vollendetsten Hand-
kataloges rühmen. Man möchte wünschen, daß
auch andere Abteilungen wie vor allem die der
Skulpturen die Möglichkeit erhielten, ihre Be-
stände so vorteilhaft dem Forscher und Kunst-
freunde zu vermitteln.
Gleichzeitig mit dem Erscheinen der hier an-
gezeigten Bände ist der Preis sämtlicher fünf
Abbildungsbände auf 2,80 Jl herabgesetzt
worden.
Bernhard Lepsius. Das Haus Lepsius. Verlag
Klinkhardt & Bi ermann, Berlin.
Das nach Tagebüchern von Elisabeth Lepsius,
einer Urenkelin des Buchhändlers Friedrich Ni-
colai und Gattin des Aegyptologen Bernhard Lep-
sius zusammengestellte Werk führt den Unter-
titel „Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichs-
hauptstadt“ mit Recht. Vielleicht sind etwas zu
viel Familieneinzelheiten in dieses schließlich für
die Öffentlichkeit bestimmte Buch übernommen
worden, aber man findet so viele heute wichtige
und interessante Dinge aus der Berliner „Vor-
zeit“ verzeichnet, daß man sich diese Rosinen
mit größtem Vergnügen heraussucht. Am wenig-
sten wichtig ist eigentlich die Person des wissen-
schaftsgeschichtlich gewiß sehr wichtigen Bern-
hard Lepsius selbst, besonders interessant aller-
dings ist es, zu erfahren, daß auf seine Einwirkung
die Auswahl des Terrains zurückzuführen ist, auf
dem heute die Preußische Staatsbibliothek steht.
Der Kunstinteressent erfährt hier übrigens
Authentisches über den berüchtigten Fälscher
Simonides. Kurios wirkt der Meinungsumschwung
der Elisabeth Lepsius, die aus einer wütenden
Bismarckfeindin zur glühenden Bismarckver-
ehrerin wird, ein Schicksal, das reichlich viele
Berliner der alten Zeit mit ihr geteilt haben
dürften. Hingewiesen sei auf die ganz ausge-
zeichneten Abbildungen des gut ausgestatteten
Bandes. by
H. C. Marillier, Handbook to the Teniers
Tapestries. Tapestry Monographs, Nr.2. 114 S.,
115 Abb. London, Oxford University
Press Humphrey Milford, 1932.
Die für den praktischen Gebrauch des Samm-
lers und Händlers wichtige Serie der „Tapestry
Monographs“, begonnen mit einem Band über die
englischen Wandteppiche des 18. JahrhundertSi
führt mit dem vorliegenden Bande in ein zu-
sammenfassend noch nie behandeltes Einzelgebiet
der Bildweberei, das der Verfasser bereits frühei
in einem Aufsatze skizziert hatte. Geordnet nach
Weborten und Webern wird, mit Angabe der
wichtigsten Beispiele und Reproduktion dei
Hauptstücke, sozusagen ein Catalogue raisonne
sämtlicher nach Vorbildern von Teniers entstan-
dener Wandteppiche aus Brüssel, Lille, Beauvais,
Aubusson, England und Spanien geliefert. —h.
Dr. H. Lehmann-Haupt: Lewis Carroll 1832—1932
zum 100. Geburtstag. 16 S., 18 Abb. — Alfred
W. Pollard: Die Doves Press, im Memoriam
T. J. Cobden-Sanderson. 16 S., 1 Druckbeilage.
Dr. W. Prandtl: Die Bibliothek des Tycho
Brahe. 16 S., 9 Abb. Verlag Herbert
Reichner, Wien VI, Strohmayer-
gasse 6, 1932. (Je 100 Exemplare, je 1,50 Jl.)
Der Verlag des „Philobiblon“ legt diese drei,
bibliophil und wissenschaftlich interessanten
Schriften in einer Form vor, die die höchsten
buchkünstlerischen Ansprüche befriedigt. Inter-
essiert Lehmann-Haupts Abhandlung über den
Verfasser von „Alice in Wonderland“ vor allem
durch die Illustrierung mit Probeentwürfen für
Titelblätter und Originalzeichnungen der Buch-
holzschnitte, so Pollards Schrift über die „Dowes
Press“ durch den erlesen schönen Druck in
Weiß-Antiqua-Schriften und Prandtls Forschun-
gen über Tycho Brahes Bibliothek durch die Be-
deutung der wissenschaftlichen und geistes-
geschichtlichen Ergebnisse. L.
J. Denuce, Die Kunstausfuhr Antwerpens im
17. Jahrhundert. Die Firma Forchoudt. „Quel-
len zur Geschichte der flämischen Kunst“,
Band I. Verlag „De Sikkel“, Kruis-
hofstraat 223, Antwerpen, 1931.
Der erste Band der wichtigen Quellenserie
vermittelt chronologisch in Regestenform das um-
fangreiche dokumentarische Material der im
Antwerpener Archiv aufbewahrten, auf die kunst-
händlerische Tätigkeit der Familie Forchoudt be-
züglichen Inventare und Rechnungsbücher. Es
braucht an dieser Stelle nicht besonders erwähnt
zu werden, daß damit die Grundlagen für die
Erforschung eines der wichtigsten Kapitel der
Kunsthandelsgeschichte im 17. Jahrhundert er-
schlossen sind; die deutsche Einleitung des
Werkes gibt wenigstens einen kurzen Ueberblick
über die kunsthändlerische Geschichte der Familie
Forchoudt in Antwerpen und Wien. Das Namen-
register am Schlüsse erleichtert die Benutzung
des wichtigen Werkes und gibt gleichzeitig Fin-
gerzeige über das Vorkommen gewisser Künstler
innerhalb des flämischen Kunsthandels der
Epoche.
Der große Brockhaus. Handbuch des Wissens
in zwanzig Bänden. 15., völlig neubearbeitete
Auflage von Brockhaus’ Konversationslexikon.
XI. Band, L—Mah. Verlag F. A. Brock-
haus, Leipzig, 1932.
Das rüstig vorwärtsschreitende Unternehmen
läßt mit jedem neuerscheinenden Bande all die
Vorzüge, die an dieser Stelle bereits öfter her-
vorgehoben wurden, in noch stärkerem Lichte er-
scheinen. Die auch illustrativ hervorragende Aus-
stattung kommt besonders den sich mit bildender
Kunst befassenden Abschnitten zugute, deren in
dem vorliegenden Bande wiederum eine große
Zahl von der Antike bis zu den letzten Er-
scheinungen unserer Zeit Erwähnung zu tun
wären, vorbildlich in ihrer knappen Sachlichkeit
wie absolut modernen wissenschaftlichen Fun-
dierung.
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. Järz 1933
(Fortsetzung von Seite 2)
„Das Leben der Frau"
in der Kunst von sechs Jahrhunderten
alter — Alltag, Humor und Spott (die bisweilen
absonderlich klingenden Bezeichnungen der
einzelnen Gruppen sind wörtlich nach dem Ka-
talog zitiert), wirkt die Ausstellung übersicht-
licher als die Tanz-Ausstellung mit ihrer bald
durch tänzerisch-formale Rücksichten, bald
durch örtliche und zeitliche Bedingtheiten be-
stimmten Einteilung. Andererseits wird die
Uebersichtlichkeit des Ausgestellten auch
durch eine lockere Hängung (der im Hagen-
bund der Raummangel im Wege stand) geför-
dert. Geschickt verteilte Gemälde, darunter
Hauptwerke von Amerling (Doppelbildnis dei-
Baronin Henriette Arnstein-Pereira und ihrer
Tochter Flora), Klimt (Danae) und Schiele
(Liebespaar), geben den Räumen eine beson-
dere Note, die der den Laien ermüdenden Ein-
förmigkeit einer reinen Graphikausstellung
entgegenwirkt.
Auf diese Weise ist es den Veranstaltern
der Schau gelungen, Schwächen der Tanz-Aus-
stellung, die freilich teilweise durch den Stoff,
zum Teil auch durch die unzureichenden Räum-
lichkeiten bedingt waren, zu vermeiden. Gibt
sich die letztere als das Ergebnis einer liebe-
vollen, äußerst gewissenhaften Kleinarbeit, das
hauptsächlich für einen nicht gerade großen
Kreis von künstlerisch und kulturhistorisch Ge-
bildeten, auch für beruflich mit dem Tanz Ver-
bundene, von Interesse ist, ist jene thematisch
und auch in der Zusammenstellung mehr auf
Augenblickswirkung und für den Geschmack
der großen Menge berechnet (für die eine Aus-
stellung, in der der Unterrock gelüftet wird,
stets von besonderem Reiz ist).
So weist denn auch die Ausstellung schon
inhaltlich empfindliche Lücken auf. Unter an-
derem vermissen wir ein Eingehen auf das
Kapitel „Ehe“ und nicht weniger eine Darstel-
lung der Frau von heute in Beruf und Sport
(den Frauen früher verschlossene Gebiete,
deren Beherrschung den Hauptunterschied zwi-
schen der Frau des 20. Jahrhunderts und ihren
Schwestern aus den verflossenen Jahrhunder-
ten ausmacht). Man könnte nach dem zur
Schau Gestellten meinen, daß sich das Leben
der modernen Frau nur im Kaffeehaus und auf
dem Turfplatz abspielt. St. P.-N.
Wilhelm Lehmbruck
Städt. Kunsthaus Bielefeld
Zum ersten Male in diesem Winter zeigt das
Städt. Kunsthaus das abgeschlossene Werk
eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers.
Die Ausstellung wurde eingeleitet durch einen
Vortrag des Betreuers des Lehmbruckschen
Nachlasses, Dr. Hoff, Duisburg. Sie um-
faßt ein gutes Dutzend Plastiken, 25 Hand-
zeichnungen und einige 30 Radierungen Lehm-
brucks. Die wohl von Zufälligkeiten und tech-
nischen Bedingtheiten diktierte Auswahl der
Skulpturen ist leider nicht allzu glücklich zu
nennen. Aber auch den weniger bedeutenden
Werken ist eine Echtheit des Gefühlsaus-
druckes eigen, die ahnen läßt, an welchem
Zwiespalt der Künstler zerbrach. Bemerkens-
werterweise haftet dieser Zwiespalt gerade den
frühesten der gezeigten Werke nicht an. In
ihnen ist eine Einheit von Gefühlsinhalt und
formaler Gestaltung erreicht, die sie in den
Rang wahrhaft erhabener Kunstwerke erhebt,
wie wir es immer wieder vor der „Knieenden“
(1911) empfanden, deren Kopf in einem
wundervollen Bronzeabguß vertreten ist.
Diesem Hauptwerk stehen das „Mädchen mit
aufgestütztem Bein“ (Bronze 1910), „Kleiner
weiblicher Torso“ (Bronze 1910-11) und die
„Kleine Sinnende“ (Bronze 1911) nicht nach.
Eine Sonderstellung nimmt der Gesundheit
und Lebensfreude ausstrahlende „Sitzende
Knabe“ (Bronze 1911) ein, dessen altes Ge-
sicht schon auf den entstehenden Kampf in
des Künstlers Seele hinweist. In dem
„Mädchenkopf“ (Bronze 1913/14) schließlich
feiert Lehmbrucks Können noch einmal einen
großen Triumph. Ein wundervolles Erlebnis
eigener Art ist die Betrachtung der Handzeich-
nungen, die irgendwie an Lehmbrucks großes
Vorbild Rodin anklingen, am schönsten dort,
wo ganz zarte Linien nur eben die Absicht
der Gestaltung und des ernsten Ringens um
sie andeuten. S—g
Goldschmiedearbeiten
aus Stettiner Kirchen
Im Provinzialmuseum Pommer-
scher Altertümer Stettin findet
augenblicklich eine Ausstellung „Goldschmiede-
arbeiten aus Stettiner Kirchenbesitz“ statt, in
der vornehmlich Stettiner Arbeiten aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Moderne
neben hervorragenden Stücken aus Danzig,
Berlin und Torgau gezeigt werden. Zum
erstenmal ist hier eine größere Anzahl von bis-
A. Wegener, Abendmahlskelch. 1558
Ausstellung: Stettin, Provinzialmuseum
her unbekannten Werken Stettiner Gold-
schmiede, die gleichfalls der Forschung unbe-
kannt waren, vereinigt worden. Einige Bei-
spiele wie der prunkvolle Kelch von der Hand
des Alexander Wegener, eine Stiftung des Pom-
merschen Herzogs Barnim XI. aus dem Jahre
1558 (siehe Abbildung), eine 1711 bezeich-
nete Oblatendose des Stettiners Gottfried Pohl,
eine spätbarocke Sonnenmonstranz von Lorenz
Paulson und die klassizistischen Kannen und
Taufschalen von Friedrich sind Zeugen dafür,
daß die Stettiner Goldschmiedekunst auf einer
ziemlich beachtlichen Höhe stand.
Auktionsvorberichte
Gemälde, Möbel
Berlin, Vorb. 25. März
Die Versteigerung der Sammlung und
Wohnungseinrichtung Graf H. H. R., Soor-
straße 59, durch das Internationale
Kunst-undAuktionshaus steht außer-
halb der üblichen Hausauktionen. Bis auf das
Speise- und Schlafzimmer besteht die Ein-
richtung nur aus antiken Möbeln, Antiquitäten
und Gemälden alter Meister in ersten Quali-
täten. Wir heben an hochwertigen Einzel-
stücken einen Satz früher intarsierter Chippen-
dalestühle in Walnuß hervor, eine Barock-
kredenz, einen prachtvollen norddeutschen Ba-
rockschrank und zahlreiche, teils antike Perser
Teppiche, ferner Louis XV-Sitzmöbel, teils mit
Gobelinbezügen aus der Zeit, eine Röntgen-
Poudreuse , köstliche Familie verte-Porzellane,
Jacob-Möbel der Zeit, einen Barock-Schrank in
Nußholz und Louis XV-Beleuchtungen, die
nach der gravierten Inschrift im Jahre 1780
für eine Hofkirche gefertigt wurden. Unter
den hochwertigen Gemälden fallen Stilleben
von de Heem und van Son auf, eine Winter-
landschaft des Vlamen van Uden, ein besonders
schöner de Momper, eine typische Marine des
W. van de Velde, einige Meisterwerke von
Pietro Rotari, das in leuchtenden Farben ge-
haltene Porträt von Rigaud und die beiden
datierten brasilianischen Landschaften von
F. Post, ehemals in der Sammlung Hausmann,
als in der Cumberland-Galerie aufgeführt von
Wurzbach.
Gemälde
Aachen, Vorb. 24./25. März
Eine bedeutende Sammlung aus einem
Aachener Nachlaß kommt am 24. u. 25.- März
durch Ant. Creutzer zur Versteigerung.
Besonders reichhaltig ist die Abteilung Ge-
mälde alter und neuerer Meister mit Werken
von Averkamp, Berchem, Brouwer, Bruegel,
Canaletto, Goltzius, Lingelbach, Pietro Longhi,
van Mander, Pepijn, Salv. Rosa, Bernhard
Strigel, Sustermann, W. van de Velde ' und
zwei frühen Altarflügeln eines Westfälischen
Meisters des 15. Jahrhunderts. Die neuere
Schule ist besonders mit bekannten Düssel-
dorfern vertreten. Die zweite Abteilung um-
faßt Antiquitäten aller Art.
Münzen
Frankfurt a. M„ Vorb. 3-/4. April
Die 98. Münzauktion der Firma L e o Ham-
burger bringt eine hervorragende Sammlung
griechischer Münzen zum Ausgebot, aus der
vor allem die reichen Serien von Sizilien her-
vorstechen.
Hannover, Vorb. 20. März
Henry Seligmann in Hannover hält
am 20. ff. März seine XIV. Auktion mit einem
schönen Material gemischter Münzen und
Medaillen ab.
Neuere Gemälde
Brüssel, Vorb. 18. März
In der Galerie Georges Giroux
findet am 18. März die Versteigerung der
Sammlung Albert L o i c q - Gent statt. Neben
Arbeiten belgischer Maler wie Laermans,
Stevens, Meunier, Baertsoen, Ensor u. a. stößt
man auch auf eine Reihe bemerkenswerter
französischer Impressionisten wie Renoir mit
einem Stilleben und einer Tänzerin, Fantin-
Latour mit einem Blumenstück, Forain, Mar-
quet usw.
Chi na-Sammlung
Louis Sheid
Paris, Vorb. 20.122., 24./25. März
Die erlesene Sammlung chinesischer Kunst-
werke aus dem Besitz von Louis Sheid, die im
Hotel Drouot durch Me M. Ader und die
Experten MM. A. Portier und G. Le-
febvre versteigert wird, verrät ein nicht all-
tägliches Niveau. Hervorragend ist die
Keramik mit Arbeiten der Dynastien Han,
T’ang, Sung, Ming und Tsin vertreten; es
folgen Porzellane, Elfenbeine, Kanton-Emails,
thibetanische, siamesische und chinesische
Bronzen, chinesische Gemälde und Holzskulp-
turen. Den Beschluß bildet eine bedeutende
Sammlung hauptsächlich französischer Fayen-
cen und Porzellane.
Silber, Gemälde
Stockholm, Vorb. 15.—17.März
Die dreitägige Auktion bei H.-Bukowski
in Stockholm bringt an erster Stelle ene her-
vorragende Sammlung aus dem Bestz des
Generalkonsuls J. Jahnssons mit einem
schönen Material an Figuren- und Gebrauchs-
silber des 16.—18. Jahrhunderts. In einem
weiteren Katalog werden Gemälde beschrieben,
darunter bedeutende Werke von A. Zorn, Lar-
gilliere, Roslin, Lebrun u. a., daneben Kunst-
gewerbe und Möbel des 18. Jahrhunderts.
Graphik, Zeichnungen
Utrecht, Vorb. 21.—23. März
Durch A. J. van Huffels Anti-
qua r i a a t wird vom 21.—23. März eine um-
fangreiche Graphik-Sammlung versteigert, die
besonders durch die reiche Sammlung der
Porträt-Stiche, vor allem aus dem Hause
Oranien-Nassau, Bedeutung erhält.
Sammlung Berthe Weill
Zürich, Vorb. 23. März
Der Name Berthe Weill, deren Nachlaß am
23. März durch G. u. L. B o 11 a g aufgelöst
wird, kündet gleichzeitig das Programm dieser
Versteigerung. Das junge Frankreich ist mit
den besten Namen und bezeichnenden Werken
vertreten, wobei kaum ein Künstler von Rang
fehlt. In der gleichen Versteigerung kommen
aus anderem Besitz Arbeiten von Böcklin,
Calame, Füssli, Hodler, A. Graff u. a. zum
Ausgebot.
Auktionsnach berichte
Graphik,
Handzeichnungen
Berlin, Nachb. 27./28. Febr.
(Vorb. in Nr. 8, S. 2.)
Bei der Graphik Versteigerung bei Holl-
stein & Puppe konnte trotz der Ungunst
der Verhältnisse mindestens zwei Drittel des
Materials abgesetzt werden, und zwar im
Durchschnitt zu zwei Dritteln der Taxe. Im all-
gemeinen kann man sagen, daß sich die Preise
der Sportsammlung im großen und ganzen in
der gleichen Höhe hielten wie sie in normalen
Zeiten die Blätter auf Londoner Versteigerun-
gen erzielten. Es brachten z. B. „The London
& Birmingham Tally Ho Coach“ von Pollard
320 M., von H. Alken „The Grand Leicester-
shire Steeple Chase“ (8 Blatt) 2050 M., „The
First Steeple Chase on Record“ (4 Blatt)
1000 M., von John Ferneley-Duncan „Count
Sandor’s Exploits“ (10 Blatt) 1000 M., Fielding,
2 Blatt „Salmon Fishing“ 580 M., „Epsom
Races“, 6 Blatt von James Pollard u. Hunt
brachten 2100 M., „The British Horse Racing“
von J. Pollard u. Reeve (4 Blatt) erzielte
970 M. Von den übrigen Stichen wurden für
das Napoleon-Bildnis von Alix 790 M. bezahlt,
für zwei Demarteau-Blätter in Farben 400 M.
Die Vedute di Roma von Giov. Batt. Piranesi
gingen mit 610 M. fort, unter den Rembrandt-
Blättern konnten 680 M. für die Ansicht von
Amsterdam, 440 M. für den nachdenkenden
jungen Mann und 400 M. für den Clement de
Jonghe im 5. Zustand als gut bezeichnet wer-
den. Im Rahmen der schönen Rowlandson-
Kollektion brachten die Opera Boxes 375 M.
Ein schönes komplettes Exemplar der „Carica-
ture“ mit den 91 Lithographien von Daumier
wurde mit 860 M. zugeschlagen.
Die hauptsächlichsten Preise unter den
Zeichnungen sind: die Ansicht des
Zwingers in Dresden von Belotto: 530 M.,
Gruppe von Orientalen von Giov. Batt. Tiepolo:
370 M., Otho van Veen, Caritas: 220 M., Moritz
von Schwind, Entwurf zu Aschenbrödel: 260 M.
Literatur
Bücher
Waldemar George, Vers un nouvel Humanisme:
Profits et pertes de Part contemporain. (157 S.,
32 Abb.) Editions des Chroniques du
Jour, Paris 1933.
Dieses Buch ist mehr als eine Auseinander-
setzung mit der zeitgenössischen Malerei: es zielt
ins Leben, geht aufs Ganze und gibt eine groß
angelegte Synthese europäischer Kunstentwick-
lung. Es versteht die Entwicklung und das Blei-
bende in der Entwicklung, es schöpft aus
empfundenem Wissen und deutet die formende
Kraft im Menschen, die wir Kunst nennen,
mit bewegten und klugen Worten. George legt
den Mangel an Totalität, Organik und lebens-
fähiger Ideologie in der heutigen Kunst, ihre
narzistische Passivität dar, wendet sich gegen
Begriffsverwirrung und exotische Kunststimulan-
tien, zieht gegen den Fortschrittswahn und gro-
ben Materialismus des Maschinenzeitalters zu
Felde, zeigt, wie ein einst universales Lebens-
gefühl durch desorientiertes Spezialistentum ab-
gelöst wird und erkennt im Leben und in der Kunst
von heute Symptome eines kulturellen Nieder-
ganges. Die entwicklungsgeschichtlichen Auf-
risse, die vorzüglichen Analysen einzelner Künst-
ler, z. B. Cezannes, die Kapitel, welche die rö-
mische und die byzantinische Kunst in ihr Recht
einsetzen, zeigen eine souveräne Beherrschung
des Materials. Das Buch gipfelt in einem Be-
kenntnis ztir Antike, zum freien, vor sich selbst
verantwortlichen Menschen, ruft nach einem
neuen Glauben, einem neuen Mythos und fordert
eine humanistische Kunst, einen anthropomorphen
Stil, der den Menschen, den ewigen Menschen,
zum Maß aller Dinge macht. Einschränkend wäre
vielleicht zu sagen, daß George, durch seinen
bürgerlich-liberalen Standpunkt, den Standpunkt
seiner Wahlheimat, befangen, Werte und Bewe-
gungen unserer Zeit, an Maßstäben mißt, die er
für ewig ansieht, die aber zeit- und ortgebunden
sind, und unzureichend beurteilt. Die Gedanken-
gänge Georges stehen nicht allein. Sie liegen
bereits in Max Raphaels Buch „Von Monet zu
Picasso“ (1919) fest, dort vor allem im Schluß-
kapitel, und tauchen seitdem immer wieder auf,
so z. B. in den Schriften Ozenfants. Dies soll
die Bedeutung des Buches nicht schmälern; sie
findet im Gegenteil dadurch, daß von verschiede-
nen Punkten her ein gleichgeartetes Ziel an-
gestrebt wird, ihre Bestätigung. Im Verlauf des
Textes setzt sich George öfters mit Arbeiten
deutscher Kunsthistoriker auseinander, unter ande-
rem mit Strzygowski, dessen Thesen er mit Recht
angreift. Eine lebendige, geistvolle und persön-
liche Formulierung unterstützt die Wirkung des
ungewöhnlichen Buches.
Gemäldegalerie Berlin
Mit dem vierten und fünften Abbildungsband
der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Ber-
lin, soeben im Verlag Paul C a s s i r e r - Berlin
erschienen, ist diese handliche, preiswerte und
mustergültige Publikation sämtlicher Gemälde
des Kaiser-Friedrich-Museums und des Deutschen
Museums abgeschlossen. Band 4 bringt in 370
ausgezeichnet klaren Abbildungen die holländi-
schen Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,
Band 5 die vlämischen, französischen, spanischen
und englischen Gemälde. Zusammen mit dem vor
Jahresfrist erschienenen Textband, dessen Bear-
beitung wie die Zusammenstellung der Bilder-
bände hauptsächlich in den sorgsam betreuenden
Händen von Fräulein Dr. Irene Kunze lag,
kann sich die Berliner Gemäldegalerie nunmehr
des textlich wie bildmäßig vollendetsten Hand-
kataloges rühmen. Man möchte wünschen, daß
auch andere Abteilungen wie vor allem die der
Skulpturen die Möglichkeit erhielten, ihre Be-
stände so vorteilhaft dem Forscher und Kunst-
freunde zu vermitteln.
Gleichzeitig mit dem Erscheinen der hier an-
gezeigten Bände ist der Preis sämtlicher fünf
Abbildungsbände auf 2,80 Jl herabgesetzt
worden.
Bernhard Lepsius. Das Haus Lepsius. Verlag
Klinkhardt & Bi ermann, Berlin.
Das nach Tagebüchern von Elisabeth Lepsius,
einer Urenkelin des Buchhändlers Friedrich Ni-
colai und Gattin des Aegyptologen Bernhard Lep-
sius zusammengestellte Werk führt den Unter-
titel „Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichs-
hauptstadt“ mit Recht. Vielleicht sind etwas zu
viel Familieneinzelheiten in dieses schließlich für
die Öffentlichkeit bestimmte Buch übernommen
worden, aber man findet so viele heute wichtige
und interessante Dinge aus der Berliner „Vor-
zeit“ verzeichnet, daß man sich diese Rosinen
mit größtem Vergnügen heraussucht. Am wenig-
sten wichtig ist eigentlich die Person des wissen-
schaftsgeschichtlich gewiß sehr wichtigen Bern-
hard Lepsius selbst, besonders interessant aller-
dings ist es, zu erfahren, daß auf seine Einwirkung
die Auswahl des Terrains zurückzuführen ist, auf
dem heute die Preußische Staatsbibliothek steht.
Der Kunstinteressent erfährt hier übrigens
Authentisches über den berüchtigten Fälscher
Simonides. Kurios wirkt der Meinungsumschwung
der Elisabeth Lepsius, die aus einer wütenden
Bismarckfeindin zur glühenden Bismarckver-
ehrerin wird, ein Schicksal, das reichlich viele
Berliner der alten Zeit mit ihr geteilt haben
dürften. Hingewiesen sei auf die ganz ausge-
zeichneten Abbildungen des gut ausgestatteten
Bandes. by
H. C. Marillier, Handbook to the Teniers
Tapestries. Tapestry Monographs, Nr.2. 114 S.,
115 Abb. London, Oxford University
Press Humphrey Milford, 1932.
Die für den praktischen Gebrauch des Samm-
lers und Händlers wichtige Serie der „Tapestry
Monographs“, begonnen mit einem Band über die
englischen Wandteppiche des 18. JahrhundertSi
führt mit dem vorliegenden Bande in ein zu-
sammenfassend noch nie behandeltes Einzelgebiet
der Bildweberei, das der Verfasser bereits frühei
in einem Aufsatze skizziert hatte. Geordnet nach
Weborten und Webern wird, mit Angabe der
wichtigsten Beispiele und Reproduktion dei
Hauptstücke, sozusagen ein Catalogue raisonne
sämtlicher nach Vorbildern von Teniers entstan-
dener Wandteppiche aus Brüssel, Lille, Beauvais,
Aubusson, England und Spanien geliefert. —h.
Dr. H. Lehmann-Haupt: Lewis Carroll 1832—1932
zum 100. Geburtstag. 16 S., 18 Abb. — Alfred
W. Pollard: Die Doves Press, im Memoriam
T. J. Cobden-Sanderson. 16 S., 1 Druckbeilage.
Dr. W. Prandtl: Die Bibliothek des Tycho
Brahe. 16 S., 9 Abb. Verlag Herbert
Reichner, Wien VI, Strohmayer-
gasse 6, 1932. (Je 100 Exemplare, je 1,50 Jl.)
Der Verlag des „Philobiblon“ legt diese drei,
bibliophil und wissenschaftlich interessanten
Schriften in einer Form vor, die die höchsten
buchkünstlerischen Ansprüche befriedigt. Inter-
essiert Lehmann-Haupts Abhandlung über den
Verfasser von „Alice in Wonderland“ vor allem
durch die Illustrierung mit Probeentwürfen für
Titelblätter und Originalzeichnungen der Buch-
holzschnitte, so Pollards Schrift über die „Dowes
Press“ durch den erlesen schönen Druck in
Weiß-Antiqua-Schriften und Prandtls Forschun-
gen über Tycho Brahes Bibliothek durch die Be-
deutung der wissenschaftlichen und geistes-
geschichtlichen Ergebnisse. L.
J. Denuce, Die Kunstausfuhr Antwerpens im
17. Jahrhundert. Die Firma Forchoudt. „Quel-
len zur Geschichte der flämischen Kunst“,
Band I. Verlag „De Sikkel“, Kruis-
hofstraat 223, Antwerpen, 1931.
Der erste Band der wichtigen Quellenserie
vermittelt chronologisch in Regestenform das um-
fangreiche dokumentarische Material der im
Antwerpener Archiv aufbewahrten, auf die kunst-
händlerische Tätigkeit der Familie Forchoudt be-
züglichen Inventare und Rechnungsbücher. Es
braucht an dieser Stelle nicht besonders erwähnt
zu werden, daß damit die Grundlagen für die
Erforschung eines der wichtigsten Kapitel der
Kunsthandelsgeschichte im 17. Jahrhundert er-
schlossen sind; die deutsche Einleitung des
Werkes gibt wenigstens einen kurzen Ueberblick
über die kunsthändlerische Geschichte der Familie
Forchoudt in Antwerpen und Wien. Das Namen-
register am Schlüsse erleichtert die Benutzung
des wichtigen Werkes und gibt gleichzeitig Fin-
gerzeige über das Vorkommen gewisser Künstler
innerhalb des flämischen Kunsthandels der
Epoche.
Der große Brockhaus. Handbuch des Wissens
in zwanzig Bänden. 15., völlig neubearbeitete
Auflage von Brockhaus’ Konversationslexikon.
XI. Band, L—Mah. Verlag F. A. Brock-
haus, Leipzig, 1932.
Das rüstig vorwärtsschreitende Unternehmen
läßt mit jedem neuerscheinenden Bande all die
Vorzüge, die an dieser Stelle bereits öfter her-
vorgehoben wurden, in noch stärkerem Lichte er-
scheinen. Die auch illustrativ hervorragende Aus-
stattung kommt besonders den sich mit bildender
Kunst befassenden Abschnitten zugute, deren in
dem vorliegenden Bande wiederum eine große
Zahl von der Antike bis zu den letzten Er-
scheinungen unserer Zeit Erwähnung zu tun
wären, vorbildlich in ihrer knappen Sachlichkeit
wie absolut modernen wissenschaftlichen Fun-
dierung.