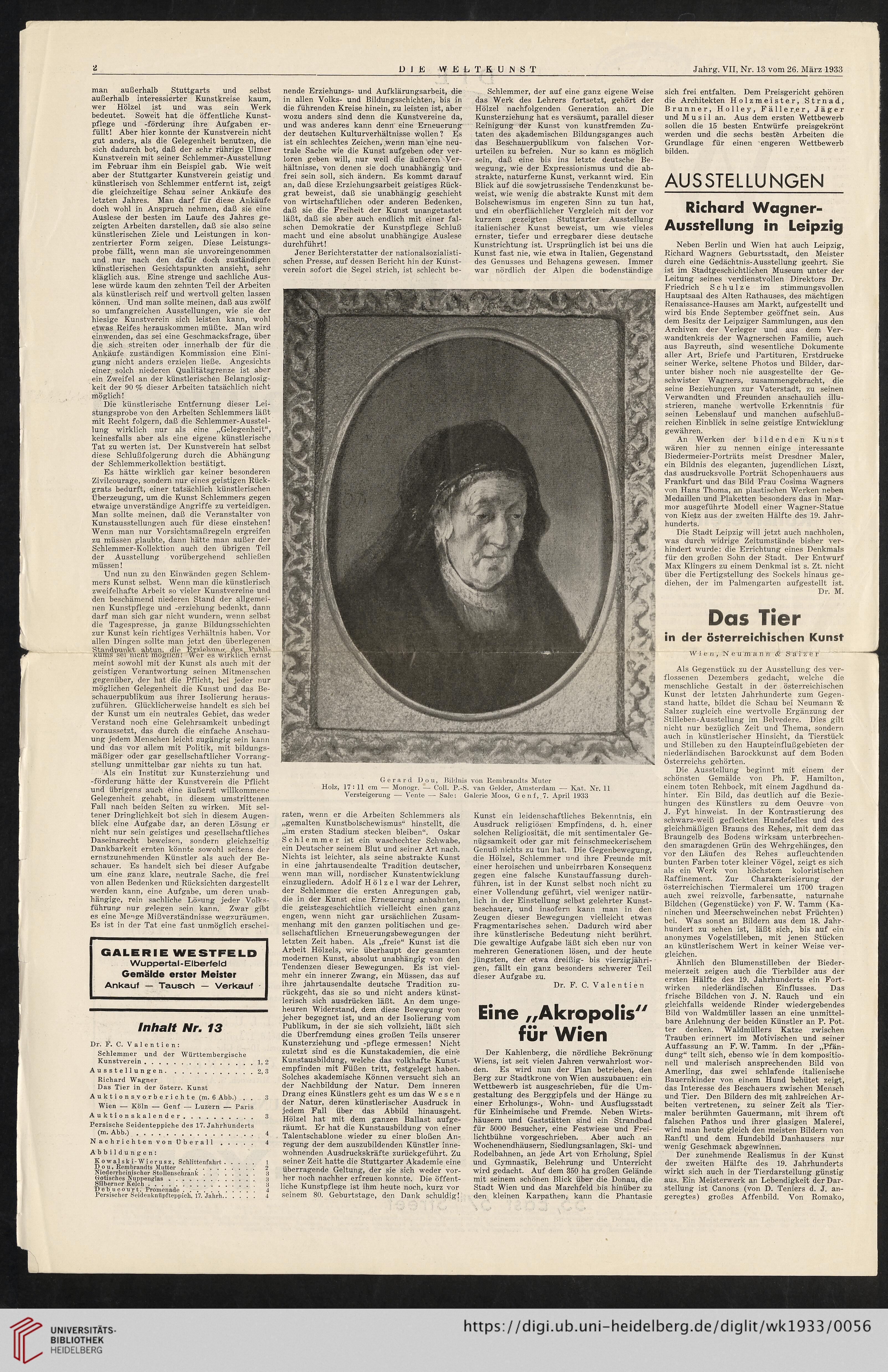•i
DIE WELT KUNST
Jahrg. VII, Nr. 13 vom 26. März 1933
man außerhalb Stuttgarts und selbst
außerhalb interessierter Kunstkreise kaum,
wer Holzel ist und was sein Werk
bedeutet. Soweit hat die öffentliche Kunst-
pflege und -förderung ihre Aufgaben er-
füllt! Aber hier konnte der Kunstverein nicht
gut anders, als die Gelegenheit benutzen, die
sich dadurch bot, daß der sehr rührige Ulmer
Kunstverein mit seiner Schlemmer-Ausstellung
im Februar ihm ein Beispiel gab. Wie weit
aber der Stuttgarter Kunstverein geistig und
künstlerisch von Schlemmer entfernt ist, zeigt
die gleichzeitige Schau seiner Ankäufe des
letzten Jahres. Man darf für diese Ankäufe
doch wohl in Anspruch nehmen, daß sie eine
Auslese der besten im Laufe des Jahres ge-
zeigten Arbeiten darstellen, daß sie also seine
künstlerischen Ziele und Leistungen in kon-
zentrierter Form zeigen. Diese Leistungs-
probe fällt, wenn man sie unvoreingenommen
und nur nach den dafür doch zuständigen
künstlerischen Gesichtspunkten ansieht, sehr
kläglich aus. Eine strenge und sachliche Aus-
lese würde kaum den zehnten Teil der Arbeiten
als künstlerisch reif und wertvoll gelten lassen
können. Und man sollte meinen, daß aus zwölf
so umfangreichen Ausstellungen, wie sie der
hiesige Kunstverein sich leisten kann, wohl
etwas Reifes herauskommen müßte. Man wird
einwenden, das sei eine Geschmacksfrage, über
die sich streiten oder innerhalb der für die
Ankäufe zuständigen Kommission eine Eini-
gung nicht anders erzielen ließe. Angesichts
einer solch niederen Qualitätsgrenze ist aber
ein Zweifel an der künstlerischen Belanglosig-
keit der 90 % dieser Arbeiten tatsächlich nicht
möglich!
Die künstlerische Entfernung dieser Lei-
stungsprobe von den Arbeiten Schlemmers läßt
mit Recht folgern, daß die Schlemmer-Ausstel-
lung wirklich nur als eine „Gelegenheit“,
keinesfalls aber als eine eigene künstlerische
Tat zu werten ist. Der Kunstverein hat selbst
diese Schlußfolgerung durch die Abhängung
der Schlemmerkollektion bestätigt.
Es hätte wirklich gar keiner besonderen
Zivilcourage, sondern nur eines geistigen Rück-
grats bedurft, einer tatsächlich künstlerischen
Überzeugung, um die Kunst Schlemmers gegen
etwaige unverständige Angriffe zu verteidigen.
Man sollte meinen, daß die Veranstalter von
Kunstausstellungen auch für diese einstehen!
Wenn man nur Vorsichtsmaßregeln ergreifen
zu müssen glaubte, dann hätte man außer der
Schlemmer-Kollektion auch den übrigen Teil
der Ausstellung vorübergehend schließen
müssen!
Und nun zu den Einwänden gegen Schlem-
mers Kunst selbst. Wenn man die künstlerisch
zweifelhafte Arbeit so vieler Kunstvereine und
den beschämend niederen Stand der allgemei-
nen Kunstpflege und -erziehung bedenkt, dann
darf man sich gar nicht wundern, wenn selbst
die Tagespresse, ja ganze Bildungsschichten
zur Kunst kein richtiges Verhältnis haben. Vor
allen Dingen sollte man jetzt den überlegenen
Standpunkt abtun. die Erziehnnv des Puhli-
Kums sei ment moglicli! Wer es wirklich ernst
meint sowohl mit der Kunst als auch mit der
geistigen Verantwortung seinen Mitmenschen
gegenüber, der hat die Pflicht, bei jeder nur
möglichen Gelegenheit die Kunst und das Be-
schauerpublikum aus ihrer Isolierung heraus-
zuführen. Glücklicherweise handelt es sich bei
der Kunst um ein neutrales Gebiet, das weder
Verstand noch eine Gelehrsamkeit unbedingt
voraussetzt, das durch die einfache Anschau-
ung jedem Menschen leicht zugängig sein kann
und das vor allem mit Politik, mit bildungs-
mäßiger oder gar gesellschaftlicher Vorrang-
stellung unmittelbar gar nichts zu tun hat.
Als ein Institut zur Kunsterziehung und
-förderung hätte der Kunstverein die Pflicht
und übrigens auch eine äußerst willkommene
Gelegenheit gehabt, in diesem umstrittenen
Fall nach beiden Seiten zu wirken. Mit sel-
tener Dringlichkeit bot sich in diesem Augen-
blick eine Aufgabe dar, an deren Lösung er
nicht nur sein geistiges und gesellschaftliches
Daseinsrecht beweisen, sondern gleichzeitig
Dankbarkeit ernten könnte sowohl seitens der
ernstzunehmenden Künstler als auch der Be-
schauer. Es handelt sich bei dieser Aufgabe
um eine ganz klare, neutrale Sache, die frei
von allen Bedenken und Rücksichten dargestellt
werden kann, eine Aufgabe, um deren unab-
hängige, rein sachliche Lösung jeder Volks-
führung nur gelegen sein kann. Zwar gibt
es eine Menge Mißverständnisse wegz.uräumen.
Es ist in der Tat eine fast unmöglich erschei-
GALERIE WESTFELD
Wuppertal-Elberfeld
Gemälde erster Meister
Ankauf — Tausch — Verkauf
Inhalt Nr. 13
Dr. F. C. V al en t ie n :
Schlemmer und der Württembergische
Kunstverein.1, 2
Ausstellungen.2, 3
Richard Wagner
Das Tier in der österr. Kunst
Auktion s. vorberichte (m. 6 Abb.) . . 3
Wien — Köln — Genf — Luzern — Paris
Auktionskalender. 3
Persische Seidenteppiche des 17. Jahrhunderts
(m. Abb.). 4
NachrichtenvonÜberall. 4
Abbildungen:
Kowalski-Wierusz, Schlittenfahrt. 1
D o u , Rembrandts Mutter. 2
Niederrheiniseher Stollenschrank. 3
Gotisches Nuppenglas. 3
Silberner Kelch. 3
Debu court, Promenade. 4
Persischer Seidenkntipfteppich, 17. Jahrh. 4
nende Erziehungs- und Aufklärungsarbeit, die
in allen Volks- und Bildungsschichten, bis in
die führenden Kreise hinein, zu leisten ist, aber
wozu anders sind denn die Kunstvereine da,
und was anderes kann denn eine Erneuerung
der deutschen Kulturverhältnisse wollen? Es
ist ein schlechtes Zeichen, wenn man eine neu-
trale Sache wie die Kunst aufgeben oder ver-
loren geben will, nur weil die äußeren Ver-
hältnisse, von denen sie doch unabhängig und
frei sein soll, sich ändern. Es kommt darauf
an, daß diese Erziehungsarbeit geistiges Rück-
grat beweist, daß sie unabhängig geschieht
von wirtschaftlichen oder anderen Bedenken,
daß sie die Freiheit der Kunst unangetastet
läßt, daß sie aber auch endlich mit einer fal-
schen Demokratie der Kunstpflege Schluß
macht und eine absolut unabhängige Auslese
durchführt!
Jener Berichterstatter der nationalsozialisti-
schen Presse, auf dessen Bericht hin der Kunst-
verein sofort die Segel strich, ist schlecht be-
Schlemmer, der auf eine ganz eigene Weise
das Werk des Lehrers fortsetzt, gehört der
Hölzel nachfolgenden Generation an. Die
Kunsterziehung hat es versäumt, parallel dieser
Reinigung der Kunst von kunstfremden Zu-
taten des akademischen Bildungsganges auch
das Beschauerpublikum von falschen Vor-
urteilen zu befreien. Nur so kann es möglich
sein, daß eine bis ins letzte deutsche Be-
wegung, wie der Expressionismus und die ab-
strakte, naturferne Kunst, verkannt wird. Ein
Blick auf die sowjetrussische Tendenzkunst be-
weist, wie wenig die abstrakte Kunst mit dem
Bolschewismus im engeren Sinn zu tun hat,
und ein oberflächlicher Vergleich mit der vor
kurzem gezeigten Stuttgarter Ausstellung
italienischer Kunst beweist, um wie vieles
ernster, tiefer und erregbarer diese deutsche
Kunstrichtung ist. Ursprünglich ist bei uns die
Kunst fast nie, wie etwa in Italien, Gegenstand
des Genusses und Behagens gewesen. Immer
war nördlich der Alpen die bodenständige
Gerard D o u, Bildnis von Rembrandts Muter
Holz, 17 : 11 cm — Monogr. — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 11
Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf,.7. April 1933
raten, wenn er die Arbeiten Schlemmers als
„gemalten Kunstbolschewismus“ hinstellt, die
„im ersten Stadium stecken bleiben“. Oskar
Schlemmer ist ein waschechter Schwabe,
ein Deutscher seinem Blut und seiner Art nach.
Nichts ist leichter, als seine abstrakte Kunst
in eine jahrtausendealte Tradition deutscher,
wenn man will, nordischer Kunstentwicklung
einzugliedern. Adolf Hölzel war der Lehrer,
der Schlemmer die ersten Anregungen gab,
die in der Kunst eine Erneuerung anbahnten,
die geistesgeschichtlich vielleicht einen ganz
engen, wenn nicht gar ursächlichen Zusam-
menhang mit den ganzen politischen und ge-
sellschaftlichen Erneuerungsbewegungen der
letzten Zeit haben. Als „freie“ Kunst ist die
Arbeit Holzels, wie überhaupt der gesamten
modernen Kunst, absolut unabhängig von den
Tendenzen dieser Bewegungen. Es ist viel-
mehr ein innerer Zwang, ein Müssen, das auf
ihre jahrtausendalte deutsche Tradition zu-
rückgeht, das sie so und nicht anders künst-
lerisch sich ausdrücken läßt. An dem unge-
heuren Widerstand, dem diese Bewegung von
jeher begegnet ist, und an der Isolierung vom
Publikum, in der sie sich vollzieht, läßt sich
die Überfremdung eines großen Teils unserer
Kunsterziehung und -pflege ermessen! Nicht
zuletzt sind es die Kunstakademien, die eine
Kunstausbildung, welche das volkhafte Kunst-
empfinden mit Füßen tritt, festgelegt haben.
Solches akademische Können versucht sich an
der Nachbildung der Natur. Dem inneren
Drang eines Künstlers geht es um das Wesen
der Natur, deren künstlerischer Ausdruck in
jedem Fall über das Abbild hinausgeht.
Hölzel hat mit dem ganzen Ballast aufge-
räumt. Er hat die Kunstausbildung von einer
Talentschablone wieder zu einer bloßen An-
regung der dem auszubildenden Künstler inne-
wohnenden Ausdruckskräfte zurückgeführt. Zu
seiner Zeit hatte die Stuttgarter Akademie eine
überragende Geltung, der sie sich weder vor-
her noch nachher erfreuen konnte. Die öffent-
liche Kunstpflege ist ihm heute noch, kurz vor
seinem 80. Geburtstage, den Dank schuldig!
Kunst ein leidenschaftliches Bekenntnis, ein
Ausdruck religiösen Empfindens, d. h. einer
solchen Religiosität, die mit sentimentaler Ge-
nügsamkeit oder gar mit feinschmeckerischem
Genuß nichts zu tun hat. Die Gegenbewegung,
die Hölzel, Schlemmer und ihre Freunde mit
einer heroischen und unbeirrbaren Konsequenz
gegen eine falsche Kunstauffassung durch-
führen, ist in der Kunst selbst noch nicht zu
einer Vollendung geführt, viel weniger natür-
lich in der Einstellung selbst gelehrter Kunst-
beschauer, und insofern kann man in den
Zeugen dieser Bewegungen vielleicht etwas
Fragmentarisches sehen. Dadurch wird aber
ihre künstlerische Bedeutung nicht berührt.
Die gewaltige Aufgabe läßt sich eben nur von
mehreren Generationen lösen, und der heute
jüngsten, der etwa dreißig- bis vierzigjähri-
gen, fällt ein ganz besonders schwerer Teil
dieser Aufgabe zu.
Dr. F. C. Valentien
Eine „Akropolis"
für Wien
Der Kahlenberg, die nördliche Bekrönung
Wiens, ist seit vielen Jahren verwahrlost wor-
den. Es wird nun der Plan betrieben, den
Berg zur Stadtkrone von Wien auszubauen: ein
Wettbewerb ist ausgeschrieben, für die Um-
gestaltung des Berggipfels und der Hänge zu
einer Erholungs-, Wohn- und Ausflugsstadt
für Einheimische und Fremde. Neben Wirts-
häusern und Gaststätten sind ein Strandbad
für 5000 Besucher, eine Festwiese und Frei-
lichtbühne vorgeschrieben. Aber auch an
Wochenendhäusern, Siedlungsanlagen, Ski- und
Rodelbahnen, an jede Art von Erholung, Spiel
und Gymnastik, Belehrung und Unterricht
wird gedacht. Auf dem 350 ha großen Gelände
mit seinem schönen Blick über die Donau, die
Stadt Wien und das Marchfeld bis hinüber zu
den kleinen Karpathen, kann die Phantasie
sich frei entfalten. Dem Preisgericht gehören
die Architekten Holzmeister, Strnad,
Brunner, Holley, Fälle r. er, Jäger
und Musil an. Aus dem ersten Wettbewerb
sollen die 15 besten Entwürfe preisgekrönt
werden und die sechs besten Arbeiten die
Grundlage für einen engeren Wettbewerb
bilden.
AUSSTELLUNGEN
Richard Wagner-
Ausstellung in Leipzig
Neben Berlin und Wien hat auch Leipzig,
Richard Wagners Geburtsstadt, den Meister
durch eine Gedächtnis-Ausstellung geehrt. Sie
ist im Stadtgeschichtlichen Museum unter der
Leitung seines verdienstvollen Direktors Dr.
Friedrich Schulze im stimmungsvollen
Hauptsaal des Alten Rathauses, des mächtigen
Renaissance-Hauses am Markt, aufgestellt und
wird bis Ende September geöffnet sein. Aus
dem Besitz der Leipziger Sammlungen, aus den
Archiven der Verleger und aus dem Ver-
wandtenkreis der Wagnerschen Familie, auch
aus Bayreuth, sind wesentliche Dokumente
aller Art, Briefe und Partituren, Erstdrucke
seiner Werke, seltene Photos und Bilder, dar-
unter bisher noch nie ausgestellte der Ge-
schwister Wagners, zusammengebracht, die
seine Beziehungen zur Vaterstadt, zu seinen
Verwandten und Freunden anschaulich illu-
strieren, manche wertvolle Erkenntnis für
seinen Lebenslauf und manchen aufschluß-
reichen Einblick in seine geistige Entwicklung
gewähren.
An Werken der bildenden Kunst
wären hier zu nennen einige interessante
Biedermeier-Porträts meist Dresdner Maler,
ein Bildnis des eleganten, jugendlichen Liszt,
das ausdrucksvolle Porträt Schopenhauers aus
Frankfurt und das Bild Frau Cosima Wagners
von Hans Thoma, an plastischen Werken neben
Medaillen und Plaketten besonders das in Mar-
mor ausgeführte Modell einer Wagner-Statue
von Kietz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.
Die Stadt Leipzig will jetzt auch nachholen,
was durch widrige Zeitumstände bisher ver-
hindert wurde: die Errichtung eines Denkmals
für den großen Sohn der Stadt. Der Entwurf
Max Klingers zu einem Denkmal ist s. Zt. nicht
über die Fertigstellung des Sockels hinaus ge-
diehen, der im Palmengarten aufgestellt ist.
Dr. M.
Das Tier
in der österreichischen Kunst
Wien, Neumann & Sa 1 Z't r
Als Gegenstück zu der Ausstellung des ver-
flossenen Dezembers gedacht, welche die
menschliche Gestalt in der österreichischen
Kunst der letzten Jahrhunderte zum Gegen-
stand hatte, bildet die Schau bei Neumann &
Salzer zugleich eine wertvolle Ergänzung der
Stilleben-Ausstellung im Belvedere. Dies gilt
nicht nur bezüglich Zeit und Thema, sondern
auch in künstlerischer Hinsicht, da Tierstück
und Stilleben zu den Haupteinflußgebieten der
niederländischen Barockkunst auf dem Boden
Österreichs gehörten.
Die Ausstellung beginnt mit einem der
schönsten Gemälde von Ph. F. Hamilton,
einem toten Rehbock, mit einem Jagdhund da-
hinter. Ein Bild, das deutlich auf die Bezie-
hungen des Künstlers zu dem Oeuvre von
J. Fyt hinweist. In der Kontrastierung des
schwarz-weiß gefleckten Hundefelles und des
gleichmäßigen Brauns des Rehes, mit dem das
Braungelb des Bodens wirksam unterbrechen-
den smaragdenen Grün des Wehrgehänges, den
vor den Läufen des Rehes aufleuchtenden
bunten Farben toter kleiner Vögel, zeigt es sich
als ein Werk von höchstem koloristischen
Raffinement. Zur Charakterisierung der
österreichischen Tiermalerei um 1700 tragen
auch zwei reizvolle, farbensatte, naturnahe
Bildchen (Gegenstücke) von F. W. Tamm (Ka-
ninchen und Meerschweinchen nebst Früchten)
bei. Was sonst an Bildern aus dem 18. Jahr-
hundert zu sehen ist, läßt sich, bis auf ein
anonymes Vogelstilleben, mit jenen Stücken
an künstlerischem Wert in keiner Weise ver-
gleichen.
Ähnlich den Blumenstilleben der Bieder-
meierzeit zeigen auch die Tierbilder aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Fort-
wirken niederländischen Einflusses. Das
frische Bildchen von J. N. Rauch und ein
gleichfalls weidende Rinder wiedergebendes
Bild von Waldmüller lassen an eine unmittel-
bare Anlehnung der beiden Künstler an P. Pot-
ter denken. Waldmüllers Katze zwischen
Trauben erinnert im Motivischen und seiner
Auffassung an F. W. Tamm. In der „Pfän-
dung“ teilt sich, ebenso wie in dem kompositio-
nell und malerisch ansprechenden Bild von
Amerling, das zwei schlafende italienische
Bauernkinder von einem Hund behütet zeigt,
das Interesse des Beschauers zwischen Mensch
und Tier. Den Bildern des mit zahlreichen Ar-
beiten vertretenen, zu seiner Zeit als Tier-
maler berühmten Gauermann, mit ihrem oft
falschen Pathos und ihrer glasigen Malerei,
wird man heute gleich den meisten Bildern von
Ranftl und dem Hundebild Danhausers nur
wenig Geschmack abgewinnen.
Der zunehmende Realismus in der Kunst
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wirkt sich auch in der Tierdarstellung günstig
aus. Ein Meisterwerk an Lebendigkeit der Dar-
stellung ist Canons (von D. Teniers d. J. an-
geregtes) großes Affenbild. Von Romako,
DIE WELT KUNST
Jahrg. VII, Nr. 13 vom 26. März 1933
man außerhalb Stuttgarts und selbst
außerhalb interessierter Kunstkreise kaum,
wer Holzel ist und was sein Werk
bedeutet. Soweit hat die öffentliche Kunst-
pflege und -förderung ihre Aufgaben er-
füllt! Aber hier konnte der Kunstverein nicht
gut anders, als die Gelegenheit benutzen, die
sich dadurch bot, daß der sehr rührige Ulmer
Kunstverein mit seiner Schlemmer-Ausstellung
im Februar ihm ein Beispiel gab. Wie weit
aber der Stuttgarter Kunstverein geistig und
künstlerisch von Schlemmer entfernt ist, zeigt
die gleichzeitige Schau seiner Ankäufe des
letzten Jahres. Man darf für diese Ankäufe
doch wohl in Anspruch nehmen, daß sie eine
Auslese der besten im Laufe des Jahres ge-
zeigten Arbeiten darstellen, daß sie also seine
künstlerischen Ziele und Leistungen in kon-
zentrierter Form zeigen. Diese Leistungs-
probe fällt, wenn man sie unvoreingenommen
und nur nach den dafür doch zuständigen
künstlerischen Gesichtspunkten ansieht, sehr
kläglich aus. Eine strenge und sachliche Aus-
lese würde kaum den zehnten Teil der Arbeiten
als künstlerisch reif und wertvoll gelten lassen
können. Und man sollte meinen, daß aus zwölf
so umfangreichen Ausstellungen, wie sie der
hiesige Kunstverein sich leisten kann, wohl
etwas Reifes herauskommen müßte. Man wird
einwenden, das sei eine Geschmacksfrage, über
die sich streiten oder innerhalb der für die
Ankäufe zuständigen Kommission eine Eini-
gung nicht anders erzielen ließe. Angesichts
einer solch niederen Qualitätsgrenze ist aber
ein Zweifel an der künstlerischen Belanglosig-
keit der 90 % dieser Arbeiten tatsächlich nicht
möglich!
Die künstlerische Entfernung dieser Lei-
stungsprobe von den Arbeiten Schlemmers läßt
mit Recht folgern, daß die Schlemmer-Ausstel-
lung wirklich nur als eine „Gelegenheit“,
keinesfalls aber als eine eigene künstlerische
Tat zu werten ist. Der Kunstverein hat selbst
diese Schlußfolgerung durch die Abhängung
der Schlemmerkollektion bestätigt.
Es hätte wirklich gar keiner besonderen
Zivilcourage, sondern nur eines geistigen Rück-
grats bedurft, einer tatsächlich künstlerischen
Überzeugung, um die Kunst Schlemmers gegen
etwaige unverständige Angriffe zu verteidigen.
Man sollte meinen, daß die Veranstalter von
Kunstausstellungen auch für diese einstehen!
Wenn man nur Vorsichtsmaßregeln ergreifen
zu müssen glaubte, dann hätte man außer der
Schlemmer-Kollektion auch den übrigen Teil
der Ausstellung vorübergehend schließen
müssen!
Und nun zu den Einwänden gegen Schlem-
mers Kunst selbst. Wenn man die künstlerisch
zweifelhafte Arbeit so vieler Kunstvereine und
den beschämend niederen Stand der allgemei-
nen Kunstpflege und -erziehung bedenkt, dann
darf man sich gar nicht wundern, wenn selbst
die Tagespresse, ja ganze Bildungsschichten
zur Kunst kein richtiges Verhältnis haben. Vor
allen Dingen sollte man jetzt den überlegenen
Standpunkt abtun. die Erziehnnv des Puhli-
Kums sei ment moglicli! Wer es wirklich ernst
meint sowohl mit der Kunst als auch mit der
geistigen Verantwortung seinen Mitmenschen
gegenüber, der hat die Pflicht, bei jeder nur
möglichen Gelegenheit die Kunst und das Be-
schauerpublikum aus ihrer Isolierung heraus-
zuführen. Glücklicherweise handelt es sich bei
der Kunst um ein neutrales Gebiet, das weder
Verstand noch eine Gelehrsamkeit unbedingt
voraussetzt, das durch die einfache Anschau-
ung jedem Menschen leicht zugängig sein kann
und das vor allem mit Politik, mit bildungs-
mäßiger oder gar gesellschaftlicher Vorrang-
stellung unmittelbar gar nichts zu tun hat.
Als ein Institut zur Kunsterziehung und
-förderung hätte der Kunstverein die Pflicht
und übrigens auch eine äußerst willkommene
Gelegenheit gehabt, in diesem umstrittenen
Fall nach beiden Seiten zu wirken. Mit sel-
tener Dringlichkeit bot sich in diesem Augen-
blick eine Aufgabe dar, an deren Lösung er
nicht nur sein geistiges und gesellschaftliches
Daseinsrecht beweisen, sondern gleichzeitig
Dankbarkeit ernten könnte sowohl seitens der
ernstzunehmenden Künstler als auch der Be-
schauer. Es handelt sich bei dieser Aufgabe
um eine ganz klare, neutrale Sache, die frei
von allen Bedenken und Rücksichten dargestellt
werden kann, eine Aufgabe, um deren unab-
hängige, rein sachliche Lösung jeder Volks-
führung nur gelegen sein kann. Zwar gibt
es eine Menge Mißverständnisse wegz.uräumen.
Es ist in der Tat eine fast unmöglich erschei-
GALERIE WESTFELD
Wuppertal-Elberfeld
Gemälde erster Meister
Ankauf — Tausch — Verkauf
Inhalt Nr. 13
Dr. F. C. V al en t ie n :
Schlemmer und der Württembergische
Kunstverein.1, 2
Ausstellungen.2, 3
Richard Wagner
Das Tier in der österr. Kunst
Auktion s. vorberichte (m. 6 Abb.) . . 3
Wien — Köln — Genf — Luzern — Paris
Auktionskalender. 3
Persische Seidenteppiche des 17. Jahrhunderts
(m. Abb.). 4
NachrichtenvonÜberall. 4
Abbildungen:
Kowalski-Wierusz, Schlittenfahrt. 1
D o u , Rembrandts Mutter. 2
Niederrheiniseher Stollenschrank. 3
Gotisches Nuppenglas. 3
Silberner Kelch. 3
Debu court, Promenade. 4
Persischer Seidenkntipfteppich, 17. Jahrh. 4
nende Erziehungs- und Aufklärungsarbeit, die
in allen Volks- und Bildungsschichten, bis in
die führenden Kreise hinein, zu leisten ist, aber
wozu anders sind denn die Kunstvereine da,
und was anderes kann denn eine Erneuerung
der deutschen Kulturverhältnisse wollen? Es
ist ein schlechtes Zeichen, wenn man eine neu-
trale Sache wie die Kunst aufgeben oder ver-
loren geben will, nur weil die äußeren Ver-
hältnisse, von denen sie doch unabhängig und
frei sein soll, sich ändern. Es kommt darauf
an, daß diese Erziehungsarbeit geistiges Rück-
grat beweist, daß sie unabhängig geschieht
von wirtschaftlichen oder anderen Bedenken,
daß sie die Freiheit der Kunst unangetastet
läßt, daß sie aber auch endlich mit einer fal-
schen Demokratie der Kunstpflege Schluß
macht und eine absolut unabhängige Auslese
durchführt!
Jener Berichterstatter der nationalsozialisti-
schen Presse, auf dessen Bericht hin der Kunst-
verein sofort die Segel strich, ist schlecht be-
Schlemmer, der auf eine ganz eigene Weise
das Werk des Lehrers fortsetzt, gehört der
Hölzel nachfolgenden Generation an. Die
Kunsterziehung hat es versäumt, parallel dieser
Reinigung der Kunst von kunstfremden Zu-
taten des akademischen Bildungsganges auch
das Beschauerpublikum von falschen Vor-
urteilen zu befreien. Nur so kann es möglich
sein, daß eine bis ins letzte deutsche Be-
wegung, wie der Expressionismus und die ab-
strakte, naturferne Kunst, verkannt wird. Ein
Blick auf die sowjetrussische Tendenzkunst be-
weist, wie wenig die abstrakte Kunst mit dem
Bolschewismus im engeren Sinn zu tun hat,
und ein oberflächlicher Vergleich mit der vor
kurzem gezeigten Stuttgarter Ausstellung
italienischer Kunst beweist, um wie vieles
ernster, tiefer und erregbarer diese deutsche
Kunstrichtung ist. Ursprünglich ist bei uns die
Kunst fast nie, wie etwa in Italien, Gegenstand
des Genusses und Behagens gewesen. Immer
war nördlich der Alpen die bodenständige
Gerard D o u, Bildnis von Rembrandts Muter
Holz, 17 : 11 cm — Monogr. — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 11
Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf,.7. April 1933
raten, wenn er die Arbeiten Schlemmers als
„gemalten Kunstbolschewismus“ hinstellt, die
„im ersten Stadium stecken bleiben“. Oskar
Schlemmer ist ein waschechter Schwabe,
ein Deutscher seinem Blut und seiner Art nach.
Nichts ist leichter, als seine abstrakte Kunst
in eine jahrtausendealte Tradition deutscher,
wenn man will, nordischer Kunstentwicklung
einzugliedern. Adolf Hölzel war der Lehrer,
der Schlemmer die ersten Anregungen gab,
die in der Kunst eine Erneuerung anbahnten,
die geistesgeschichtlich vielleicht einen ganz
engen, wenn nicht gar ursächlichen Zusam-
menhang mit den ganzen politischen und ge-
sellschaftlichen Erneuerungsbewegungen der
letzten Zeit haben. Als „freie“ Kunst ist die
Arbeit Holzels, wie überhaupt der gesamten
modernen Kunst, absolut unabhängig von den
Tendenzen dieser Bewegungen. Es ist viel-
mehr ein innerer Zwang, ein Müssen, das auf
ihre jahrtausendalte deutsche Tradition zu-
rückgeht, das sie so und nicht anders künst-
lerisch sich ausdrücken läßt. An dem unge-
heuren Widerstand, dem diese Bewegung von
jeher begegnet ist, und an der Isolierung vom
Publikum, in der sie sich vollzieht, läßt sich
die Überfremdung eines großen Teils unserer
Kunsterziehung und -pflege ermessen! Nicht
zuletzt sind es die Kunstakademien, die eine
Kunstausbildung, welche das volkhafte Kunst-
empfinden mit Füßen tritt, festgelegt haben.
Solches akademische Können versucht sich an
der Nachbildung der Natur. Dem inneren
Drang eines Künstlers geht es um das Wesen
der Natur, deren künstlerischer Ausdruck in
jedem Fall über das Abbild hinausgeht.
Hölzel hat mit dem ganzen Ballast aufge-
räumt. Er hat die Kunstausbildung von einer
Talentschablone wieder zu einer bloßen An-
regung der dem auszubildenden Künstler inne-
wohnenden Ausdruckskräfte zurückgeführt. Zu
seiner Zeit hatte die Stuttgarter Akademie eine
überragende Geltung, der sie sich weder vor-
her noch nachher erfreuen konnte. Die öffent-
liche Kunstpflege ist ihm heute noch, kurz vor
seinem 80. Geburtstage, den Dank schuldig!
Kunst ein leidenschaftliches Bekenntnis, ein
Ausdruck religiösen Empfindens, d. h. einer
solchen Religiosität, die mit sentimentaler Ge-
nügsamkeit oder gar mit feinschmeckerischem
Genuß nichts zu tun hat. Die Gegenbewegung,
die Hölzel, Schlemmer und ihre Freunde mit
einer heroischen und unbeirrbaren Konsequenz
gegen eine falsche Kunstauffassung durch-
führen, ist in der Kunst selbst noch nicht zu
einer Vollendung geführt, viel weniger natür-
lich in der Einstellung selbst gelehrter Kunst-
beschauer, und insofern kann man in den
Zeugen dieser Bewegungen vielleicht etwas
Fragmentarisches sehen. Dadurch wird aber
ihre künstlerische Bedeutung nicht berührt.
Die gewaltige Aufgabe läßt sich eben nur von
mehreren Generationen lösen, und der heute
jüngsten, der etwa dreißig- bis vierzigjähri-
gen, fällt ein ganz besonders schwerer Teil
dieser Aufgabe zu.
Dr. F. C. Valentien
Eine „Akropolis"
für Wien
Der Kahlenberg, die nördliche Bekrönung
Wiens, ist seit vielen Jahren verwahrlost wor-
den. Es wird nun der Plan betrieben, den
Berg zur Stadtkrone von Wien auszubauen: ein
Wettbewerb ist ausgeschrieben, für die Um-
gestaltung des Berggipfels und der Hänge zu
einer Erholungs-, Wohn- und Ausflugsstadt
für Einheimische und Fremde. Neben Wirts-
häusern und Gaststätten sind ein Strandbad
für 5000 Besucher, eine Festwiese und Frei-
lichtbühne vorgeschrieben. Aber auch an
Wochenendhäusern, Siedlungsanlagen, Ski- und
Rodelbahnen, an jede Art von Erholung, Spiel
und Gymnastik, Belehrung und Unterricht
wird gedacht. Auf dem 350 ha großen Gelände
mit seinem schönen Blick über die Donau, die
Stadt Wien und das Marchfeld bis hinüber zu
den kleinen Karpathen, kann die Phantasie
sich frei entfalten. Dem Preisgericht gehören
die Architekten Holzmeister, Strnad,
Brunner, Holley, Fälle r. er, Jäger
und Musil an. Aus dem ersten Wettbewerb
sollen die 15 besten Entwürfe preisgekrönt
werden und die sechs besten Arbeiten die
Grundlage für einen engeren Wettbewerb
bilden.
AUSSTELLUNGEN
Richard Wagner-
Ausstellung in Leipzig
Neben Berlin und Wien hat auch Leipzig,
Richard Wagners Geburtsstadt, den Meister
durch eine Gedächtnis-Ausstellung geehrt. Sie
ist im Stadtgeschichtlichen Museum unter der
Leitung seines verdienstvollen Direktors Dr.
Friedrich Schulze im stimmungsvollen
Hauptsaal des Alten Rathauses, des mächtigen
Renaissance-Hauses am Markt, aufgestellt und
wird bis Ende September geöffnet sein. Aus
dem Besitz der Leipziger Sammlungen, aus den
Archiven der Verleger und aus dem Ver-
wandtenkreis der Wagnerschen Familie, auch
aus Bayreuth, sind wesentliche Dokumente
aller Art, Briefe und Partituren, Erstdrucke
seiner Werke, seltene Photos und Bilder, dar-
unter bisher noch nie ausgestellte der Ge-
schwister Wagners, zusammengebracht, die
seine Beziehungen zur Vaterstadt, zu seinen
Verwandten und Freunden anschaulich illu-
strieren, manche wertvolle Erkenntnis für
seinen Lebenslauf und manchen aufschluß-
reichen Einblick in seine geistige Entwicklung
gewähren.
An Werken der bildenden Kunst
wären hier zu nennen einige interessante
Biedermeier-Porträts meist Dresdner Maler,
ein Bildnis des eleganten, jugendlichen Liszt,
das ausdrucksvolle Porträt Schopenhauers aus
Frankfurt und das Bild Frau Cosima Wagners
von Hans Thoma, an plastischen Werken neben
Medaillen und Plaketten besonders das in Mar-
mor ausgeführte Modell einer Wagner-Statue
von Kietz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.
Die Stadt Leipzig will jetzt auch nachholen,
was durch widrige Zeitumstände bisher ver-
hindert wurde: die Errichtung eines Denkmals
für den großen Sohn der Stadt. Der Entwurf
Max Klingers zu einem Denkmal ist s. Zt. nicht
über die Fertigstellung des Sockels hinaus ge-
diehen, der im Palmengarten aufgestellt ist.
Dr. M.
Das Tier
in der österreichischen Kunst
Wien, Neumann & Sa 1 Z't r
Als Gegenstück zu der Ausstellung des ver-
flossenen Dezembers gedacht, welche die
menschliche Gestalt in der österreichischen
Kunst der letzten Jahrhunderte zum Gegen-
stand hatte, bildet die Schau bei Neumann &
Salzer zugleich eine wertvolle Ergänzung der
Stilleben-Ausstellung im Belvedere. Dies gilt
nicht nur bezüglich Zeit und Thema, sondern
auch in künstlerischer Hinsicht, da Tierstück
und Stilleben zu den Haupteinflußgebieten der
niederländischen Barockkunst auf dem Boden
Österreichs gehörten.
Die Ausstellung beginnt mit einem der
schönsten Gemälde von Ph. F. Hamilton,
einem toten Rehbock, mit einem Jagdhund da-
hinter. Ein Bild, das deutlich auf die Bezie-
hungen des Künstlers zu dem Oeuvre von
J. Fyt hinweist. In der Kontrastierung des
schwarz-weiß gefleckten Hundefelles und des
gleichmäßigen Brauns des Rehes, mit dem das
Braungelb des Bodens wirksam unterbrechen-
den smaragdenen Grün des Wehrgehänges, den
vor den Läufen des Rehes aufleuchtenden
bunten Farben toter kleiner Vögel, zeigt es sich
als ein Werk von höchstem koloristischen
Raffinement. Zur Charakterisierung der
österreichischen Tiermalerei um 1700 tragen
auch zwei reizvolle, farbensatte, naturnahe
Bildchen (Gegenstücke) von F. W. Tamm (Ka-
ninchen und Meerschweinchen nebst Früchten)
bei. Was sonst an Bildern aus dem 18. Jahr-
hundert zu sehen ist, läßt sich, bis auf ein
anonymes Vogelstilleben, mit jenen Stücken
an künstlerischem Wert in keiner Weise ver-
gleichen.
Ähnlich den Blumenstilleben der Bieder-
meierzeit zeigen auch die Tierbilder aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Fort-
wirken niederländischen Einflusses. Das
frische Bildchen von J. N. Rauch und ein
gleichfalls weidende Rinder wiedergebendes
Bild von Waldmüller lassen an eine unmittel-
bare Anlehnung der beiden Künstler an P. Pot-
ter denken. Waldmüllers Katze zwischen
Trauben erinnert im Motivischen und seiner
Auffassung an F. W. Tamm. In der „Pfän-
dung“ teilt sich, ebenso wie in dem kompositio-
nell und malerisch ansprechenden Bild von
Amerling, das zwei schlafende italienische
Bauernkinder von einem Hund behütet zeigt,
das Interesse des Beschauers zwischen Mensch
und Tier. Den Bildern des mit zahlreichen Ar-
beiten vertretenen, zu seiner Zeit als Tier-
maler berühmten Gauermann, mit ihrem oft
falschen Pathos und ihrer glasigen Malerei,
wird man heute gleich den meisten Bildern von
Ranftl und dem Hundebild Danhausers nur
wenig Geschmack abgewinnen.
Der zunehmende Realismus in der Kunst
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wirkt sich auch in der Tierdarstellung günstig
aus. Ein Meisterwerk an Lebendigkeit der Dar-
stellung ist Canons (von D. Teniers d. J. an-
geregtes) großes Affenbild. Von Romako,