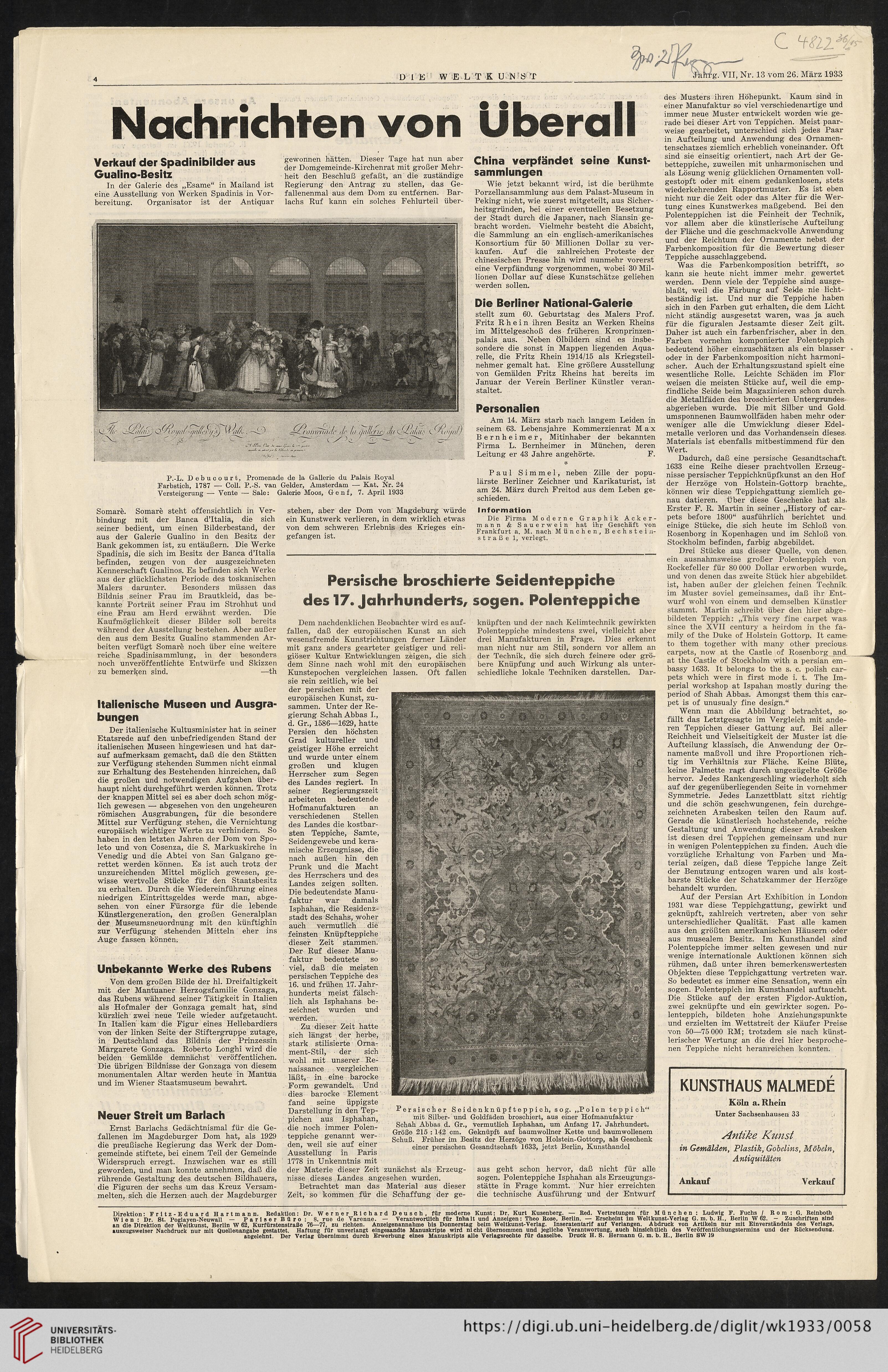DIE W E L T K U NS T
Nachrichten von
Überall
Verkauf der Spadinibilder aus
Gualino-Besitz
In der Galerie des „Esame“ in Mailand ist
eine Ausstellung von Werken Spadinis in Vor-
bereitung. Organisator ist der Antiquar
gewonnen hätten. Dieser Tage hat nun aber
der Domgemeinde-Kirchenrat mit großer Mehr-
heit den Beschluß gefaßt, an die zuständige
Regierung den Antrag zu stellen, das Ge-
fallenenmal aus dem Dom zu entfernen. Bar-
lachs Ruf kann ein solches Fehlurteil über-
China verpfändet seine Kunst-
sammlungen
Wie jetzt bekannt wird, ist die berühmte
Porzellansammlung aus dem Palast-Museum in
Peking nicht, wie zuerst mitgeteilt, aus Sicher-
heitsgründen, bei einer eventuellen Besetzung
der Stadt durch die Japaner, nach Siansin ge-
bracht worden. Vielmehr besteht die Absicht,
die Sammlung an ein englisch-amerikanisches
Konsortium für 50 Millionen Dollar zu ver-
kaufen. Auf die zahlreichen Proteste der
chinesischen Presse hin wird nunmehr vorerst
eine Verpfändung vorgenommen, wobei 30 Mil-
lionen Dollar auf diese Kunstschätze geliehen
werden sollen.
Die Berliner National-Galerie
stellt zum 60. Geburtstag des Malers Prof.
Fritz Rhein ihren Besitz an Werken Rheins
im Mittelgeschoß des früheren Kronprinzen-
palais aus. Neben Ölbildern sind es insbe-
sondere die sonst in Mappen liegenden Aqua-
relle, die Fritz Rhein 1914/15 als Kriegsteil-
nehmer gemalt hat. Eine größere Ausstellung
von Gemälden Fritz Rheins hat bereits im
Januar der Verein Berliner Künstler veran-
staltet.
Personalien
Am 14. März starb nach langem Leiden in
seinem 63. Lebensjahre Kommerzienrat Max
Bernheimer, Mitinhaber der bekannten
Firma L. Bernheimer in München, deren
Leitung er 43 Jahre angehörte. F.
*
P.-L. Debucourt, Promenade de la Gallerie du Palais Royal
Farbstich, 1787 — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 24
Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf, 7. April 1933
Paul Simmel, neben Zille der popu-
lärste Berliner Zeichner und Karikaturist, ist
am 24. März durch Freitod aus dem Leben ge-
schieden.
Somare. Somare steht offensichtlich in Ver-
bindung mit der Banca d’Italia, die sich
seiner bedient, um einen Bilderbestand, der
aus der Galerie Gualino in den Besitz der
Bank gekommen ist, zu entäußern. Die Werke
Spadinis, die sich im Besitz der Banca d’Italia
befinden, zeugen von der ausgezeichneten
Kennerschaft Gualinos. Es befinden sich Werke
aus der glücklichsten Periode des toskanischen
Malers darunter. Besonders müssen das
Bildnis seiner Frau im Brautkleid, das be-
kannte Porträt seiner Frau im Strohhut und
eine Frau am Herd erwähnt werden. Die
Kaufmöglichkeit dieser Bilder soll bereits
während der Ausstellung bestehen. Aber außer
den aus dem Besitz Gualino stammenden Ar-
beiten verfügt Somare noch über eine weitere
reiche Spadinisammlung, in der besonders
noch unveröffentlichte Entwürfe und Skizzen
zu bemerken sind. —th
Italienische Museen und Ausgra-
bungen
Der italienische Kultusminister hat in seiner
Etatsrede auf den unbefriedigenden Stand der
italienischen Museen hingewiesen und hat dar-
auf aufmerksam gemacht, daß die den Stätten
zur Verfügung stehenden Summen nicht einmal
zur Erhaltung des Bestehenden hinreichen, daß
die großen und notwendigen Aufgaben über-
haupt nicht durchgeführt werden können. Trotz
der knappen Mittel sei es aber doch schon mög-
lich gewesen — abgesehen von den ungeheuren
römischen Ausgrabungen, für die besondere
Mittel zur Verfügung stehen, die Vernichtung
europäisch wichtiger Werte zu verhindern. So
haben in den letzten Jahren der Dom von Spo-
leto und von Cosenza, die S. Markuskirche in
Venedig und die Abtei von San Galgano ge-
rettet werden können. Es ist auch trotz der
unzureichenden Mittel möglich gewesen, ge-
wisse wertvolle Stücke für den Staatsbesitz
zu erhalten. Durch die Wiedereinführung eines
niedrigen Eintrittsgeldes werde man, abge-
sehen von einer Fürsorge für die lebende
Künstlergeneration, den großen Generalplan
der Museumsneuordnung mit den künftighin
zur Verfügung stehenden Mitteln eher ins
Auge fassen können.
Unbekannte Werke des Rubens
Von dem großen Bilde der hl. Dreifaltigkeit
mit der Mantuaner Herzogsfamilie Gonzaga,
das Rubens während seiner Tätigkeit in Italien
als Hofmaler der Gonzaga gemalt hat, sind
kürzlich zwei neue Teile wieder aufgetaucht.
In Italien kam die Figur eines Hellebardiers
von der linken Seite der Stiftergruppe zutage,
in Deutschland das Bildnis der Prinzessin
Margarete Gonzaga. Roberto Longhi wird die
beiden Gemälde demnächst veröffentlichen.
Die übrigen Bildnisse der Gonzaga von diesem
monumentalen Altar werden heute in Mantua
und im Wiener Staatsmuseum bewahrt.
Neuer Streit um Barlach
Ernst Barlachs Gedächtnismai für die Ge-
fallenen im Magdeburger Dom hat, als 1929
die preußische Regierung das Werk der Dom-
gemeinde stiftete, bei einem Teil der Gemeinde
Widerspruch erregt. Inzwischen war es still
geworden, und man konnte annehmen, daß die
rührende Gestaltung des deutschen Bildhauers,
die Figuren der sechs um das Kreuz Versam-
melten, sich die Herzen auch der Magdeburger
stehen, aber der Dom von Magdeburg würde
ein Kunstwerk verlieren, in dem wirklich etwas
von dem schweren Erlebnis des Krieges ein-
gefangen ist.
Information
Die Firma Moderne Graphik Acker-
mann & Sauerwein hat ihr Geschäft von
Frankfurt a. M. nach München, Bechstein-
Straße 1, verlegt.
Persische broschierte Seidenteppiche
des 17. Jahrhunderts, sogen. Polenteppiche
Dem nachdenklichen Beobachter wird es auf-
fallen, daß der europäischen Kunst an sich
wesensfremde Kunstrichtungen ferner Länder
mit ganz anders gearteter geistiger und reli-
giöser Kultur Entwicklungen zeigen, die sich
dem Sinne nach wohl mit den europäischen
Kunstepochen vergleichen lassen. Oft fallen
knüpften und der nach Kelimtechnik gewirkten
Polenteppiche mindestens zwei, vielleicht aber
drei Manufakturen in Frage. Dies erkennt
man nicht nur am Stil, sondern vor allem an
der Technik, die sich durch feinere oder grö-
bere Knüpfung und auch Wirkung als unter-
schiedliche lokale Techniken darstellen. Dar-
sie rein zeitlich, wie bei
der persischen mit der
europäischen Kunst, zu-
sammen. Unter der Re-
gierung Schah Abbas I.,
d. Gr., 1586—1629, hatte
Persien den höchsten
Grad kultureller und
geistiger Höhe erreicht
und wurde unter einem
großen und klugen
Herrscher zum Segen
des Landes regiert. In
seiner Regierungszeit
arbeiteten bedeutende
Hofmanufakturen an
verschiedenen Stellen
des Landes die kostbar-
sten Teppiche, Samte,
Seidengewebe und kera-
mische Erzeugnisse, die
nach außen hin den
Prunk und die Macht
des Herrschers und des
Landes zeigen sollten.
Die bedeutendste Manu-
faktur war damals
Isphahan, die Residenz-
stadt des Schahs, woher
auch vermutlich die
feinsten Knüpfteppiche
dieser Zeit stammen.
Der Ruf dieser Manu-
faktur bedeutete so
viel, daß die meisten
persischen Teppiche des
16. und frühen 17. Jahr-
hunderts meist fälsch-
lich als Isphahans be-
zeichnet wurden und
werden.
Zu dieser Zeit hatte
sich längst der herbe,
stark stilisierte Orna-
ment-Stil, der sich
wohl mit unserer Re-
naissance vergleichen
läßt, in eine barocke
Form gewandelt. Und
dies barocke Element
Persischer Seidenknüpfteppich, sog. „Polen teppich“
mit Silber- und Goldfäden broschiert, aus einer Hofmanufaktur
Schah Abbas d. Gr., vermutlich Isphahan, um Anfang 17. Jahrhundert.
Größe 215 : 142 cm. Geknüpft auf baumwollner Kette und baumwollenem
Schuß. Früher im Besitz der Herzöge von Holstein-Gottorp, als Geschenk
einer persischen Gesandtschaft 1633, jetzt Berlin, Kunsthandel
fand seine üppigste
Darstellung in den Tep-
pichen aus Isphahan,
die noch immer Polen-
teppiche genannt wer-
den, weil sie auf einer
Ausstellung in Paris
1778 in Unkenntnis mit
der Materie dieser Zeit zunächst als Erzeug-
nisse dieses Landes angesehen wurden.
Betrachtet man das Material aus dieser
Zeit, so kommen für die Schaffung der ge-
aus geht schon hervor, daß nicht für alle
sogen. Polenteppiche Isphahan als Erzeugungs-
stätte in Frage kommt. Nur hier erreichten
die technische Ausführung und der Entwurf
des Musters ihren Höhepunkt. Kaum sind in
einer Manufaktur so viel verschiedenartige und
immer neue Muster entwickelt worden wie ge-
rade bei dieser Art von Teppichen. Meist paar-
weise gearbeitet, unterschied sich jedes Paar
in Aufteilung und Anwendung des Ornamen-
tenschatzes ziemlich erheblich voneinander. Oft
sind sie einseitig orientiert, nach Art der Ge-
betteppiche, zuweilen mit unharmonischen und
als Lösung wenig glücklichen Ornamenten voll-
gestopft oder mit einem gedankenlosen, stets
wiederkehrenden Rapportmuster. Es ist eben
nicht nur die Zeit oder das Alter für die Wer-
tung eines Kunstwerkes maßgebend. Bei den
Polenteppichen ist die Feinheit der Technik,
vor allem aber die künstlerische Aufteilung
der Fläche und die geschmackvolle Anwendung
und der Reichtum der Ornamente nebst der
Farbenkomposition für die Bewertung dieser
Teppiche ausschlaggebend.
Was die Farbenkomposition betrifft, so-
kann sie heute nicht immer mehr gewertet
werden. Denn viele der Teppiche sind ausge-
blaßt, weil die Färbung auf Seide nie licht-
beständig ist. Und nur die Teppiche haben
sich in den Farben gut erhalten, die dem Licht
nicht ständig ausgesetzt waren, was ja auch,
für die figuralen Jestsamte dieser Zeit gilt.
Daher ist auch ein farbenfrischer, aber in den
Farben vornehm komponierter Polenteppich
bedeutend höher einzuschätzen als ein blasser
oder in der Farbenkomposition nicht harmoni-
scher. Auch der Erhaltungszustand spielt eine
wesentliche Rolle. Leichte Schäden im Flor-
weisen die meisten Stücke auf, weil die emp-
findliche Seide beim Magazinieren schon durch,
die Metallfäden des broschierten Untergrundes-
abgerieben wurde. Die mit Silber und Gold,
umsponnenen Baumwollfäden haben mehr oder-
weniger alle die Umwicklung dieser Edel-
metalle verloren und das Vorhandensein dieses-
Materials ist ebenfalls mitbestimmend für den
Wert.
Dadurch, daß eine persische Gesandtschaft.
1633 eine Reihe dieser prachtvollen Erzeug-
nisse persischer Teppichknüpfkunst an den Hof
der Herzöge von Holstein-Gottorp brachte,,
können wir diese Teppichgattung ziemlich ge-
nau datieren. Über diese Geschenke hat als.
Erster F. R. Martin in seiner „History of car-
pets before 1800“ ausführlich berichtet und
einige Stücke, die sich heute im Schloß von
Rosenborg in Kopenhagen und im Schloß von.
Stockholm befinden, farbig abgebildet.
Drei Stücke aus dieser Quelle, von denen
ein ausnahmsweise großer Polenteppich von
Rockefeiler für 80 000 Dollar erworben wurde,,
und von denen das zweite Stück hier abgebildet
ist, haben außer der gleichen feinen Technik,
im Muster soviel gemeinsames, daß ihr Ent-
wurf wohl von einem und demselben Künstler-
stammt. Martin schreibt über den hier abge-
bildeten Teppich: „This very fine carpet was-
since the XVII Century a heirdom in the fa-
mily of the Duke of Holstein Gottorp. It came-
to them together with many other precious.
carpets, now at the Castle of Rosenborg and.
at the Castle of Stockholm with a persian em-
bassy 1633. It belongs to the s. c. polish car-
pets which were in first mode i. t. The Im-
perial workshop at Ispahan mostly during tha
period of Shah Abbas. Amongst them this car-
pet is of unusualy fine design.“
Wenn man die Abbildung betrachtet, so-
fällt das Letztgesagte im Vergleich mit ande-
ren Teppichen dieser Gattung auf. Bei aller
Reichheit und Vielseitigkeit der Muster ist die-
Aufteilung klassisch, die Anwendung der Or-
namente maßvoll und ihre Proportionen rich-
tig im Verhältnis zur Fläche. Keine Blüte,,
keine Palmette ragt durch ungezügelte Größe-
hervor. Jedes Rankengeschling wiederholt sich
auf der gegenüberliegenden Seite in vornehmer
Symmetrie. Jedes Lanzettblatt sitzt richtig
und die schön geschwungenen, fein durchge-
zeichneten Arabesken teilen den Raum auf.
Gerade die künstlerisch hochstehende, reiche-
Gestaltung und Anwendung dieser Arabesken
ist diesen drei Teppichen gemeinsam und nur
in wenigen Polenteppichen zu finden. Auch die
vorzügliche Erhaltung von Farben und Ma-
terial zeigen, daß diese Teppiche lange Zeit
der Benutzung entzogen waren und als kost-
barste Stücke der Schatzkammer der Herzöge-
behandelt wurden.
Auf der Persian Art Exhibition in London
1931 war diese Teppichgattung, gewirkt und
geknüpft, zahlreich vertreten, aber von sehr
unterschiedlicher Qualität. Fast alle kamen
aus den größten amerikanischen Häusern oder
aus musealem Besitz. Im Kunsthandel sind
Polenteppiche immer selten gewesen und nur
wenige internationale Auktionen können sich
rühmen, daß unter ihren bemerkenswertesten
Objekten diese Teppichgattung vertreten war.
So bedeutet es immer eine Sensation, wenn ein
sogen. Polenteppich im Kunsthandel auftaucht.
Die Stücke auf der ersten Figdor-Auktion,
zwei geknüpfte und ein gewirkter sogen. Po-
lenteppich, bildeten hohe Anziehungspunkte
und erzielten im Wettstreit der Käufer Preise
von 50—75 000 RM; trotzdem sie nach künst-
lerischer Wertung an die drei hier besproche-
nen Teppiche nicht heranreichen konnten.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. EL, Berlin W 62. — Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19
Nachrichten von
Überall
Verkauf der Spadinibilder aus
Gualino-Besitz
In der Galerie des „Esame“ in Mailand ist
eine Ausstellung von Werken Spadinis in Vor-
bereitung. Organisator ist der Antiquar
gewonnen hätten. Dieser Tage hat nun aber
der Domgemeinde-Kirchenrat mit großer Mehr-
heit den Beschluß gefaßt, an die zuständige
Regierung den Antrag zu stellen, das Ge-
fallenenmal aus dem Dom zu entfernen. Bar-
lachs Ruf kann ein solches Fehlurteil über-
China verpfändet seine Kunst-
sammlungen
Wie jetzt bekannt wird, ist die berühmte
Porzellansammlung aus dem Palast-Museum in
Peking nicht, wie zuerst mitgeteilt, aus Sicher-
heitsgründen, bei einer eventuellen Besetzung
der Stadt durch die Japaner, nach Siansin ge-
bracht worden. Vielmehr besteht die Absicht,
die Sammlung an ein englisch-amerikanisches
Konsortium für 50 Millionen Dollar zu ver-
kaufen. Auf die zahlreichen Proteste der
chinesischen Presse hin wird nunmehr vorerst
eine Verpfändung vorgenommen, wobei 30 Mil-
lionen Dollar auf diese Kunstschätze geliehen
werden sollen.
Die Berliner National-Galerie
stellt zum 60. Geburtstag des Malers Prof.
Fritz Rhein ihren Besitz an Werken Rheins
im Mittelgeschoß des früheren Kronprinzen-
palais aus. Neben Ölbildern sind es insbe-
sondere die sonst in Mappen liegenden Aqua-
relle, die Fritz Rhein 1914/15 als Kriegsteil-
nehmer gemalt hat. Eine größere Ausstellung
von Gemälden Fritz Rheins hat bereits im
Januar der Verein Berliner Künstler veran-
staltet.
Personalien
Am 14. März starb nach langem Leiden in
seinem 63. Lebensjahre Kommerzienrat Max
Bernheimer, Mitinhaber der bekannten
Firma L. Bernheimer in München, deren
Leitung er 43 Jahre angehörte. F.
*
P.-L. Debucourt, Promenade de la Gallerie du Palais Royal
Farbstich, 1787 — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 24
Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf, 7. April 1933
Paul Simmel, neben Zille der popu-
lärste Berliner Zeichner und Karikaturist, ist
am 24. März durch Freitod aus dem Leben ge-
schieden.
Somare. Somare steht offensichtlich in Ver-
bindung mit der Banca d’Italia, die sich
seiner bedient, um einen Bilderbestand, der
aus der Galerie Gualino in den Besitz der
Bank gekommen ist, zu entäußern. Die Werke
Spadinis, die sich im Besitz der Banca d’Italia
befinden, zeugen von der ausgezeichneten
Kennerschaft Gualinos. Es befinden sich Werke
aus der glücklichsten Periode des toskanischen
Malers darunter. Besonders müssen das
Bildnis seiner Frau im Brautkleid, das be-
kannte Porträt seiner Frau im Strohhut und
eine Frau am Herd erwähnt werden. Die
Kaufmöglichkeit dieser Bilder soll bereits
während der Ausstellung bestehen. Aber außer
den aus dem Besitz Gualino stammenden Ar-
beiten verfügt Somare noch über eine weitere
reiche Spadinisammlung, in der besonders
noch unveröffentlichte Entwürfe und Skizzen
zu bemerken sind. —th
Italienische Museen und Ausgra-
bungen
Der italienische Kultusminister hat in seiner
Etatsrede auf den unbefriedigenden Stand der
italienischen Museen hingewiesen und hat dar-
auf aufmerksam gemacht, daß die den Stätten
zur Verfügung stehenden Summen nicht einmal
zur Erhaltung des Bestehenden hinreichen, daß
die großen und notwendigen Aufgaben über-
haupt nicht durchgeführt werden können. Trotz
der knappen Mittel sei es aber doch schon mög-
lich gewesen — abgesehen von den ungeheuren
römischen Ausgrabungen, für die besondere
Mittel zur Verfügung stehen, die Vernichtung
europäisch wichtiger Werte zu verhindern. So
haben in den letzten Jahren der Dom von Spo-
leto und von Cosenza, die S. Markuskirche in
Venedig und die Abtei von San Galgano ge-
rettet werden können. Es ist auch trotz der
unzureichenden Mittel möglich gewesen, ge-
wisse wertvolle Stücke für den Staatsbesitz
zu erhalten. Durch die Wiedereinführung eines
niedrigen Eintrittsgeldes werde man, abge-
sehen von einer Fürsorge für die lebende
Künstlergeneration, den großen Generalplan
der Museumsneuordnung mit den künftighin
zur Verfügung stehenden Mitteln eher ins
Auge fassen können.
Unbekannte Werke des Rubens
Von dem großen Bilde der hl. Dreifaltigkeit
mit der Mantuaner Herzogsfamilie Gonzaga,
das Rubens während seiner Tätigkeit in Italien
als Hofmaler der Gonzaga gemalt hat, sind
kürzlich zwei neue Teile wieder aufgetaucht.
In Italien kam die Figur eines Hellebardiers
von der linken Seite der Stiftergruppe zutage,
in Deutschland das Bildnis der Prinzessin
Margarete Gonzaga. Roberto Longhi wird die
beiden Gemälde demnächst veröffentlichen.
Die übrigen Bildnisse der Gonzaga von diesem
monumentalen Altar werden heute in Mantua
und im Wiener Staatsmuseum bewahrt.
Neuer Streit um Barlach
Ernst Barlachs Gedächtnismai für die Ge-
fallenen im Magdeburger Dom hat, als 1929
die preußische Regierung das Werk der Dom-
gemeinde stiftete, bei einem Teil der Gemeinde
Widerspruch erregt. Inzwischen war es still
geworden, und man konnte annehmen, daß die
rührende Gestaltung des deutschen Bildhauers,
die Figuren der sechs um das Kreuz Versam-
melten, sich die Herzen auch der Magdeburger
stehen, aber der Dom von Magdeburg würde
ein Kunstwerk verlieren, in dem wirklich etwas
von dem schweren Erlebnis des Krieges ein-
gefangen ist.
Information
Die Firma Moderne Graphik Acker-
mann & Sauerwein hat ihr Geschäft von
Frankfurt a. M. nach München, Bechstein-
Straße 1, verlegt.
Persische broschierte Seidenteppiche
des 17. Jahrhunderts, sogen. Polenteppiche
Dem nachdenklichen Beobachter wird es auf-
fallen, daß der europäischen Kunst an sich
wesensfremde Kunstrichtungen ferner Länder
mit ganz anders gearteter geistiger und reli-
giöser Kultur Entwicklungen zeigen, die sich
dem Sinne nach wohl mit den europäischen
Kunstepochen vergleichen lassen. Oft fallen
knüpften und der nach Kelimtechnik gewirkten
Polenteppiche mindestens zwei, vielleicht aber
drei Manufakturen in Frage. Dies erkennt
man nicht nur am Stil, sondern vor allem an
der Technik, die sich durch feinere oder grö-
bere Knüpfung und auch Wirkung als unter-
schiedliche lokale Techniken darstellen. Dar-
sie rein zeitlich, wie bei
der persischen mit der
europäischen Kunst, zu-
sammen. Unter der Re-
gierung Schah Abbas I.,
d. Gr., 1586—1629, hatte
Persien den höchsten
Grad kultureller und
geistiger Höhe erreicht
und wurde unter einem
großen und klugen
Herrscher zum Segen
des Landes regiert. In
seiner Regierungszeit
arbeiteten bedeutende
Hofmanufakturen an
verschiedenen Stellen
des Landes die kostbar-
sten Teppiche, Samte,
Seidengewebe und kera-
mische Erzeugnisse, die
nach außen hin den
Prunk und die Macht
des Herrschers und des
Landes zeigen sollten.
Die bedeutendste Manu-
faktur war damals
Isphahan, die Residenz-
stadt des Schahs, woher
auch vermutlich die
feinsten Knüpfteppiche
dieser Zeit stammen.
Der Ruf dieser Manu-
faktur bedeutete so
viel, daß die meisten
persischen Teppiche des
16. und frühen 17. Jahr-
hunderts meist fälsch-
lich als Isphahans be-
zeichnet wurden und
werden.
Zu dieser Zeit hatte
sich längst der herbe,
stark stilisierte Orna-
ment-Stil, der sich
wohl mit unserer Re-
naissance vergleichen
läßt, in eine barocke
Form gewandelt. Und
dies barocke Element
Persischer Seidenknüpfteppich, sog. „Polen teppich“
mit Silber- und Goldfäden broschiert, aus einer Hofmanufaktur
Schah Abbas d. Gr., vermutlich Isphahan, um Anfang 17. Jahrhundert.
Größe 215 : 142 cm. Geknüpft auf baumwollner Kette und baumwollenem
Schuß. Früher im Besitz der Herzöge von Holstein-Gottorp, als Geschenk
einer persischen Gesandtschaft 1633, jetzt Berlin, Kunsthandel
fand seine üppigste
Darstellung in den Tep-
pichen aus Isphahan,
die noch immer Polen-
teppiche genannt wer-
den, weil sie auf einer
Ausstellung in Paris
1778 in Unkenntnis mit
der Materie dieser Zeit zunächst als Erzeug-
nisse dieses Landes angesehen wurden.
Betrachtet man das Material aus dieser
Zeit, so kommen für die Schaffung der ge-
aus geht schon hervor, daß nicht für alle
sogen. Polenteppiche Isphahan als Erzeugungs-
stätte in Frage kommt. Nur hier erreichten
die technische Ausführung und der Entwurf
des Musters ihren Höhepunkt. Kaum sind in
einer Manufaktur so viel verschiedenartige und
immer neue Muster entwickelt worden wie ge-
rade bei dieser Art von Teppichen. Meist paar-
weise gearbeitet, unterschied sich jedes Paar
in Aufteilung und Anwendung des Ornamen-
tenschatzes ziemlich erheblich voneinander. Oft
sind sie einseitig orientiert, nach Art der Ge-
betteppiche, zuweilen mit unharmonischen und
als Lösung wenig glücklichen Ornamenten voll-
gestopft oder mit einem gedankenlosen, stets
wiederkehrenden Rapportmuster. Es ist eben
nicht nur die Zeit oder das Alter für die Wer-
tung eines Kunstwerkes maßgebend. Bei den
Polenteppichen ist die Feinheit der Technik,
vor allem aber die künstlerische Aufteilung
der Fläche und die geschmackvolle Anwendung
und der Reichtum der Ornamente nebst der
Farbenkomposition für die Bewertung dieser
Teppiche ausschlaggebend.
Was die Farbenkomposition betrifft, so-
kann sie heute nicht immer mehr gewertet
werden. Denn viele der Teppiche sind ausge-
blaßt, weil die Färbung auf Seide nie licht-
beständig ist. Und nur die Teppiche haben
sich in den Farben gut erhalten, die dem Licht
nicht ständig ausgesetzt waren, was ja auch,
für die figuralen Jestsamte dieser Zeit gilt.
Daher ist auch ein farbenfrischer, aber in den
Farben vornehm komponierter Polenteppich
bedeutend höher einzuschätzen als ein blasser
oder in der Farbenkomposition nicht harmoni-
scher. Auch der Erhaltungszustand spielt eine
wesentliche Rolle. Leichte Schäden im Flor-
weisen die meisten Stücke auf, weil die emp-
findliche Seide beim Magazinieren schon durch,
die Metallfäden des broschierten Untergrundes-
abgerieben wurde. Die mit Silber und Gold,
umsponnenen Baumwollfäden haben mehr oder-
weniger alle die Umwicklung dieser Edel-
metalle verloren und das Vorhandensein dieses-
Materials ist ebenfalls mitbestimmend für den
Wert.
Dadurch, daß eine persische Gesandtschaft.
1633 eine Reihe dieser prachtvollen Erzeug-
nisse persischer Teppichknüpfkunst an den Hof
der Herzöge von Holstein-Gottorp brachte,,
können wir diese Teppichgattung ziemlich ge-
nau datieren. Über diese Geschenke hat als.
Erster F. R. Martin in seiner „History of car-
pets before 1800“ ausführlich berichtet und
einige Stücke, die sich heute im Schloß von
Rosenborg in Kopenhagen und im Schloß von.
Stockholm befinden, farbig abgebildet.
Drei Stücke aus dieser Quelle, von denen
ein ausnahmsweise großer Polenteppich von
Rockefeiler für 80 000 Dollar erworben wurde,,
und von denen das zweite Stück hier abgebildet
ist, haben außer der gleichen feinen Technik,
im Muster soviel gemeinsames, daß ihr Ent-
wurf wohl von einem und demselben Künstler-
stammt. Martin schreibt über den hier abge-
bildeten Teppich: „This very fine carpet was-
since the XVII Century a heirdom in the fa-
mily of the Duke of Holstein Gottorp. It came-
to them together with many other precious.
carpets, now at the Castle of Rosenborg and.
at the Castle of Stockholm with a persian em-
bassy 1633. It belongs to the s. c. polish car-
pets which were in first mode i. t. The Im-
perial workshop at Ispahan mostly during tha
period of Shah Abbas. Amongst them this car-
pet is of unusualy fine design.“
Wenn man die Abbildung betrachtet, so-
fällt das Letztgesagte im Vergleich mit ande-
ren Teppichen dieser Gattung auf. Bei aller
Reichheit und Vielseitigkeit der Muster ist die-
Aufteilung klassisch, die Anwendung der Or-
namente maßvoll und ihre Proportionen rich-
tig im Verhältnis zur Fläche. Keine Blüte,,
keine Palmette ragt durch ungezügelte Größe-
hervor. Jedes Rankengeschling wiederholt sich
auf der gegenüberliegenden Seite in vornehmer
Symmetrie. Jedes Lanzettblatt sitzt richtig
und die schön geschwungenen, fein durchge-
zeichneten Arabesken teilen den Raum auf.
Gerade die künstlerisch hochstehende, reiche-
Gestaltung und Anwendung dieser Arabesken
ist diesen drei Teppichen gemeinsam und nur
in wenigen Polenteppichen zu finden. Auch die
vorzügliche Erhaltung von Farben und Ma-
terial zeigen, daß diese Teppiche lange Zeit
der Benutzung entzogen waren und als kost-
barste Stücke der Schatzkammer der Herzöge-
behandelt wurden.
Auf der Persian Art Exhibition in London
1931 war diese Teppichgattung, gewirkt und
geknüpft, zahlreich vertreten, aber von sehr
unterschiedlicher Qualität. Fast alle kamen
aus den größten amerikanischen Häusern oder
aus musealem Besitz. Im Kunsthandel sind
Polenteppiche immer selten gewesen und nur
wenige internationale Auktionen können sich
rühmen, daß unter ihren bemerkenswertesten
Objekten diese Teppichgattung vertreten war.
So bedeutet es immer eine Sensation, wenn ein
sogen. Polenteppich im Kunsthandel auftaucht.
Die Stücke auf der ersten Figdor-Auktion,
zwei geknüpfte und ein gewirkter sogen. Po-
lenteppich, bildeten hohe Anziehungspunkte
und erzielten im Wettstreit der Käufer Preise
von 50—75 000 RM; trotzdem sie nach künst-
lerischer Wertung an die drei hier besproche-
nen Teppiche nicht heranreichen konnten.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. EL, Berlin W 62. — Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19