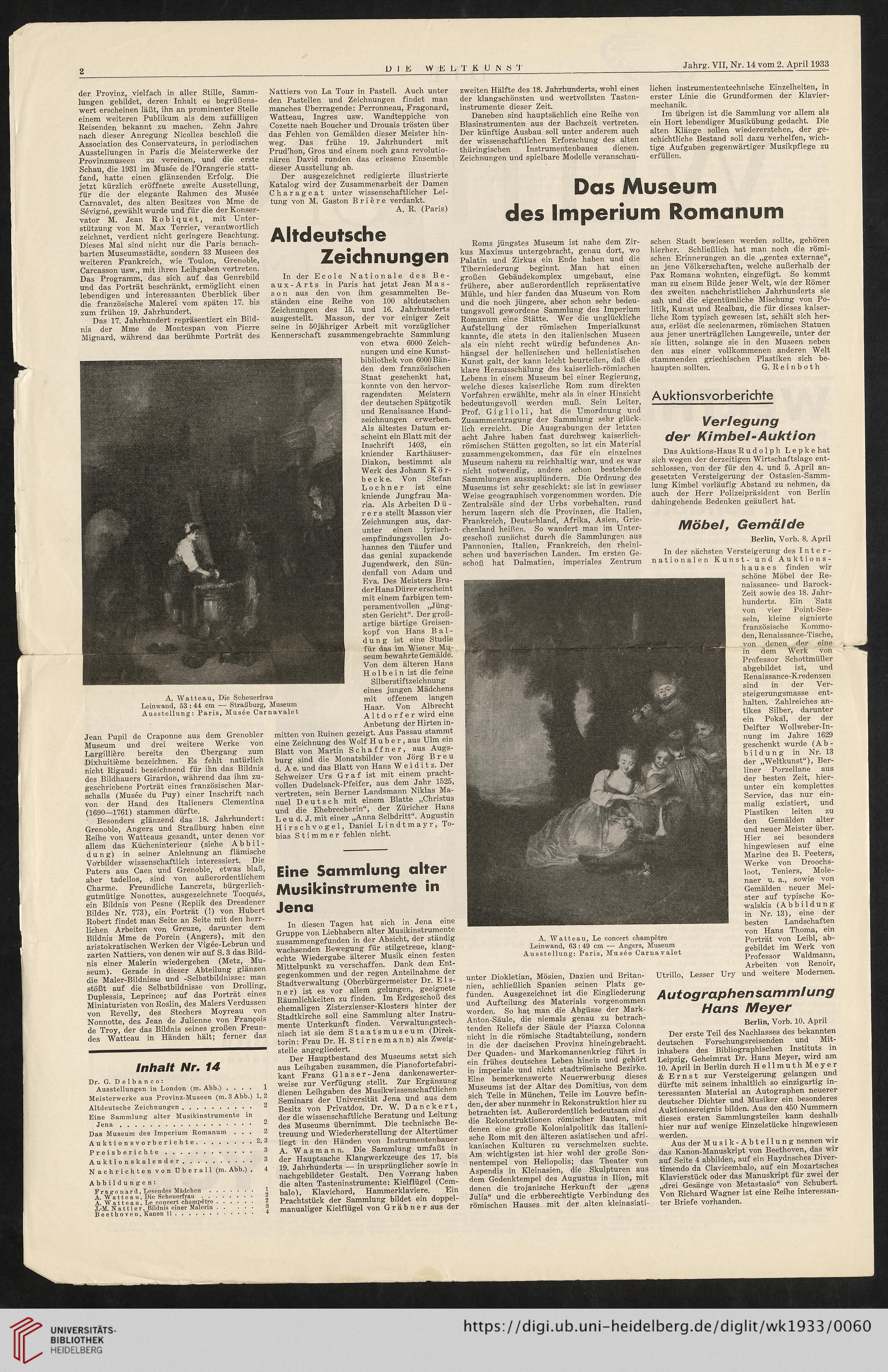2
DIE W E L T K U N Ö T
Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933
der Provinz, vielfach in aller Stille, Samm-
lungen gebildet, deren Inhalt es begrüßens-
wert erscheinen läßt, ihn an prominenter Stelle
einem weiteren Publikum als dem zufälligen
Reisenden bekannt zu machen. Zehn Jahre
nach dieser Anregung Nicolles beschloß die
Association des Conservateurs, in periodischen
Ausstellungen in Paris die Meisterwerke der
Provinzmuseen zu vereinen, und die erste
Schau, die 1931 im Musee de l’Orangerie statt-
fand, hatte einen glänzenden Erfolg. Die
jetzt kürzlich eröffnete zweite Ausstellung,
für die der elegante Rahmen des Musee
Carnavalet, des alten Besitzes von Mme de
Sevigne, gewählt wurde und für die der Konser-
vator M. Jean R o b i q u e t, mit Unter-
stützung von M. Max Terrier, verantwortlich
zeichnet, verdient nicht geringere Beachtung.
Dieses Mal sind nicht nur die Paris benach-
barten Museumsstädte, sondern 33 Museen des
weiteren Frankreich, wie Toulon, Grenoble,
Carcasson usw., mit ihren Leihgaben vertreten.
Das Programm, das sich auf das Genrebild
und das Porträt beschränkt, ermöglicht einen
lebendigen und interessanten Überblick über
die französische Malerei vom späten 17. bis
zum frühen 19. Jahrhundert.
Das 17. Jahrhundert repräsentiert ein Bild-
nis der Mme de Montespan von Pierre
Mignard, während das berühmte Porträt des
Jean Pupil de Craponne aus dem Grenobler
Museum und drei weitere Werke von
Largilliere bereits den Übergang zum
Dixhuitieme bezeichnen. Es fehlt natürlich
nicht Rigaud: bezeichnend für ihn das Bildnis
des Bildhauers Girardon, während das ihm zu-
geschriebene Porträt eines französischen Mar-
schalls (Musee du Puy) einer Inschrift nach
von der Hand des Italieners Clementina
(1690—1761) stammen dürfte.
Besonders glänzend das 18. Jahrhundert:
Grenoble, Angers und Straßburg haben eine
Reihe von Watteaus gesandt, unter denen vor
allem das Kücheninterieur (siehe Abbil-
dung) in seiner Anlehnung an flämische
Vo'rbilder wissenschaftlich interessiert. Die
Paters aus Caen und Grenoble, etwas blaß,
aber tadellos, sind von außerordentlichem
Charme. Freundliche Lancrets, bürgerlich-
gutmütige Nonottes, ausgezeichnete Tocques,
ein Bildnis von Pesne (Replik des Dresdener
Bildes Nr. 773), ein Porträt (!) von Hubert
Robert findet man Seite an Seite mit den herr-
lichen Arbeiten von Greuze, darunter dem
Bildnis Mme de Porcin (Angers), mit den
aristokratischen Werken der Vigee-Lebrun und
zarten Nattiers, von denen wir auf S. 3 das Bild-
nis einer Malerin wiedergeben (Metz, Mu-
seum). Gerade in dieser Abteilung glänzen
die Maler-Bildnisse und -Selbstbildnisse: man
stößt auf die Selbstbildnisse von Drolling,
Duplessis, Leprince; auf das Porträt eines
Miniaturisten von Roslin, des Malers Verdussen
von Revelly, des Stechers Moyreau von
Nonnotte, des Jean de Julienne von Francois
de Troy, der das Bildnis seines großen Freun-
des Watteau in Händen hält; ferner das
Inhalt Nr. 14
Dr. G. Delbanco:
Ausstellungen in London (m. Abb.) .... 1
Meisterwerke aus Provinz-Museen (m. 3 Abb.) 1,2
Altdeutsche Zeichnungen. 2
Eine Sammlung alter Musikinstrumente in
Jena. 2
Das Museum des Imperium Romanum ... 2
Auktionsvorberichte.2, 3
Preisberichte . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
N achrichten von Überall (m. Abb.) . 4
Abbildungen:
F r a g o n ar d, Lesendes Mädchen. 1
Ä. Watteau, Die Scheuerfrau. 2
A. Watteau, Le concert champßtre. 2
J.-M. Nattier, Bildnis einer Malerin. 3
Beethoven, Kanon 11. 4
Nattiers von La Tour in Pastell. Auch unter
den Pastellen und Zeichnungen findet man
manches Überragende: Perronneau, Fragonard,
Watteau, Ingres usw. Wandteppiche von
Cozette nach Boucher und Drouais trösten über
das Fehlen von Gemälden dieser Meister hin-
weg. Das frühe 19. Jahrhundert mit
Prud’hon, Gros und einem noch ganz revolutio-
nären David runden das erlesene Ensemble
dieser Ausstellung ab.
Der ausgezeichnet redigierte illustrierte
Katalog wird der Zusammenarbeit der Damen
Charageat unter wissenschaftlicher Lei-
tung von M. Gaston B r i e r e verdankt.
A. R. (Paris)
Altdeutsche
Zeichnungen
In der Ecole Nationale des Be-
aux-Arts in Paris hat jetzt Jean M a s -
s o n aus den von ihm gesammelten Be-
ständen eine Reihe von 100 altdeutschen
Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts
ausgestellt. Massen, der vor einiger Zeit
seine in 50jähriger Arbeit mit vorzüglicher
Kennerschaft zusammengebrachte Sammlung
von etwa 6000 Zeich-
nungen und eine Kunst-
bibliothek von 6000 Bän-
den dem französischen
Staat geschenkt hat,
konnte von den hervor-
ragendsten Meistem
der deutschen Spätgotik
und Renaissance Hand-
zeichnungen erwerben.
Als ältestes Datum er-
scheint ein Blatt mit der
Inschrift 1403, ein
kniender Karthäuser-
Diakon, bestimmt als
Werk des Johann Kör-
becke. Von Stefan
L o c h n e r ist eine
kniende Jungfrau Ma-
ria. Als Arbeiten Dü-
rers stellt Masson vier
Zeichnungen aus, dar-
unter einen lyrisch-
empfindungsvollen Jo-
hannes den Täufer und
das genial zupackende
Jugendwerk, den Sün-
denfall von Adam und
Eva. Des Meisters Bru-
der Hans Dürer erscheint
mit einem farbigen tem-
peramentvollen „Jüng-
sten Gericht“. Der groß-
artige bärtige Greisen-
kopf von Hans B a1 -
düng ist eine Studie
für das im Wiener Mu-
seum bewahrte Gemälde.
Von dem älteren Hans
Holbein ist die feine
Silberstiftzeichnung
eines jungen Mädchens
mit offenem langen
Haar. Von Albrecht
Altdorfer wird eine
Anbetung der Hirten in-
mitten von Ruinen gezeigt. Aus Passau stammt
eine Zeichnung des Wolf Huber, aus Ulm ein
Blatt von Martin Schaffner, aus Augs-
burg sind die Monatsbilder von Jörg B r e u
d. A e. und das Blatt von Hans W e i d i t z. Der
Schweizer Urs Graf ist mit einem pracht-
vollen Dudelsack-Pfeifer, aus dem Jahr 1525,
vertreten, sein Berner Landsmann Niklas Ma-
nuel Deutsch mit einem Blatte „Christus
und die Ehebrecherin“, der Züricher Hans
L e u d. J. mit einer „Anna Selbdritt“. Augustin
Hirschvogel, Daniel Lindtmayr, To-
bias Stimmer fehlen nicht.
Eine Sammlung alter
Musikinstrumente in
Jena
In diesen Tagen hat sich in Jena eine
Gruppe von Liebhabern alter Musikinstrumente
zusammengefunden in der Absicht, der ständig
wachsenden Bewegung für stilgetreue, klang-
echte Wiedergabe älterer Musik einen festen
Mittelpunkt zu verschaffen. Dank dem Ent-
gegenkommen und der regen Anteilnahme der
Stadtverwaltung (Oberbürgermeister Dr. Els-
ner) ist es vor allem gelungen, geeignete
Räumlichkeiten zu finden. Im Erdgeschoß des
ehemaligen Zisterzienser-Klosters hinter der
Stadtkirche soll eine Sammlung alter Instru-
mente Unterkunft finden. Verwaltungstech-
nisch ist sie dem Staatsmuseum (Direk-
torin : Frau Dr. H. S t i r n e m a n n) als Zweig-
stelle angegliedert.
Der Hauptbestand des Museums setzt sich
aus Leihgaben zusammen, die Pianofortefabri-
kant Franz Glaser- Jena dankenswerter-
weise zur Verfügung stellt. Zur Ergänzung
dienen Leihgaben des Musikwissenschaftlichen
Seminars der Universität Jena und aus dem
Besitz von Privatdoz. Dr. W. Danckert,
der die wissenschaftliche Beratung und Leitung
des Museums übernimmt. Die technische Be-
treuung und Wiederherstellung der Altertümer
liegt in den Händen von Instrumentenbauer
A. Wasmann. Die Sammlung umfaßt in
der Hauptsache Klangwerkzeuge des 17. bis
19. Jahrhunderts — in ursprünglicher sowie in
nachgebildeter Gestalt. Den Vorrang haben
die alten Tasteninstrumente: Kielflügel (Cem-
balo), Klavichord, Hammerklaviere. Ein
Prachtstück der Sammlung bildet ein doppel-
manualiger Kielflügel von G r ä b n e r aus der
A. Watteau, Die Scheuerfrau
Leinwand, 53 : 44 cm — Straßburg, Museum
Ausstellung: Paris, Musee Carnavalet
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wohl eines
der klangschönsten und wertvollsten Tasten-
instrumente dieser Zeit.
Daneben sind hauptsächlich eine Reihe von
Blasinstrumenten aus der Bachzeit vertreten.
Der künftige Ausbau soll unter anderem auch
der wissenschaftlichen Erforschung des alten
thüringischen Instrumentenbaues dienen.
Zeichnungen und spielbare Modelle veranschau-
lichen instrumententechnische Einzelheiten, in
erster Linie die Grundformen der Klavier-
mechanik.
Im übrigen ist die Sammlung vor allem als
ein Hort lebendiger Musikübung gedacht. Die
alten Klänge sollen wiedererstehen, der ge-
schichtliche Bestand soll dazu verhelfen, wich-
tige Aufgaben gegenwärtiger Musikpflege zu
erfüllen.
Das Museum
des Imperium Romanum
Roms jüngstes Museum ist nahe dem Zir-
kus Maximus untergebracht, genau dort, wo
Palatin und Zirkus ein Ende haben und die
Tiberniederung beginnt. Man hat einen
großen Gebäudekomplex umgebaut, eine
frühere, aber außerordentlich repräsentative
Mühle, und hier fanden das Museum von Rom
und die noch jüngere, aber schon sehr bedeu-
tungsvoll gewordene Sammlung des Imperium
Romanum eine Stätte. Wer die unglückliche
Aufstellung der römischen Imperialkunst
kannte, die stets in den italienischen Museen
als ein nicht recht würdig befundenes An-
hängsel der hellenischen und hellenistischen
Kunst galt, der kann leicht beurteilen, daß die
klare Herausschälung des kaiserlich-römischen
Lebens in einem Museum bei einer Regierung,
welche dieses kaiserliche Rom zum direkten
Vorfahren erwählte, mehr als in einer Hinsicht
bedeutungsvoll werden muß. Sein Leiter,
Prof. G i g 1 i o 1 i, hat die Umordnung und
Zusammentragung der Sammlung sehr glück-
lich erreicht. Die Ausgrabungen der letzten
acht Jahre haben fast durchweg kaiserlich-
römischen Stätten gegolten, so ist ein Material
zusammengekommen, das für ein einzelnes
Museum nahezu zu reichhaltig war, und es war
nicht notwendig, andere schon bestehende
Sammlungen auszuplündern. Die Ordnung des
Museums ist sehr geschickt: sie ist in gewisser
Weise geographisch vorgenommen worden. Die
Zentralsäle sind der Urbs Vorbehalten, rund
herum lagern sich die Provinzen, die Italien,
Frankreich, Deutschland, Afrika, Asien, Grie-
chenland heißen. So wandert man im Unter-
geschoß zunächst durch die Sammlungen aus
Pannonien, Italien, Frankreich, den rheini-
schen und baverischen Landen. Im ersten Ge-
schoß hat Dalmatien, imperiales Zentrum
sehen Stadt bewiesen werden sollte, gehören
hierher. Schließlich hat man noch die römi-
schen Erinnerungen an die „gentes externae“,
an jene Völkerschaften, welche außerhalb der
Pax Romana wohnten, eingefügt. So kommt
man zu einem Bilde jener Welt, wie der Römer
des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts sie
sah und die eigentümliche Mischung von Po-
litik, Kunst und Realbau, die für dieses kaiser-
liche Rom typisch gewesen ist, schält sich her-
aus, erlöst die seelenarmen, römischen Statuen
aus jener unerträglichen Langeweile, unter der
sie litten, solange sie in den Museen neben
den aus einer vollkommenen anderen Welt
stammenden griechischen Plastiken sich be-
haupten sollten. G. Reinboth
Auktionsvorberichte
Verlegung
der Kimbel-Auktion
Das Auktions-Haus Rudolph Lepke hat
sich wegen der derzeitigen Wirtschaftslage ent-
schlossen, von der für den 4. und 5. April an-
gesetzten Versteigerung der Ostasien-Samm-
lung Kimbel vorläufig Abstand zu nehmen, da
auch der Herr Polizeipräsident von Berlin
dahingehende Bedenken geäußert hat.
Möbel, Gemälde
Berlin, Vorb. 8. April
In der nächsten Versteigerung des Inter-
nationalen Kunst- und Auktions-
hauses finden wir
A. Watteau, Le concert champetre
Leinwand, 63: 49 cm — Angers, Museum
Ausstellung: Paris, Musee Carnavalet
schöne Möbel der Re-
naissance- und Barock-
Zeit sowie des 18. Jahr-
hunderts. Ein ‘Satz
von vier Point-Ses-
seln, kleine signierte
französische Kommo-
den, Renaissance-Tische,
von denen der eine
in dem Werk von
Professor Schottmüller
abgebildet ist, und
Renaissance-Kredenzen
sind in der Ver-
steigerungsmasse ent-
halten. Zahlreiches an-
tikes Silber, darunter
ein Pokal, der der
Delfter Wollweber-In-
nung im Jahre 1629
geschenkt wurde (Ab-
bildung in Nr. 13
der „Weltkunst“), Ber-
liner Porzellane aus
der besten Zeit, hier-
unter ein komplettes
Service, das nur ein-
malig existiert, und
Plastiken leiten zu
den Gemälden alter
und neuer Meister über.
Hier sei besonders
hingewiesen auf eine
Marine des B. Peeters,
Werke von Droochs-
loot, Teniers, Mole-
naer u. a., sowie von
Gemälden neuer Mei-
ster auf typische Ko-
walskis (Abbildung
in Nr. 13), eine der
besten Landschaften
von Hans Thoma, ein
Porträt von Leibi, ab-
gebildet im Werk von
Professor Waldmann,
Arbeiten von Renoir,
unter Diokletian, Mösien, Dazien und Britan-
nien, schließlich Spanien seinen Platz ge-
funden. Ausgezeichnet ist die Eingliederung
und Aufteilung des Materials vorgenommen
worden. So hat man die Abgüsse der Mark-
Anton-Säule, die niemals genau zu betrach-
tenden Reliefs der Säule der Piazza Colonna
nicht in die römische Stadtabteilung, sondern
in die der dacischen Provinz hineingebracht.
Der Quaden- und Markomannenkrieg führt in
ein frühes deutsches Leben hinein und gehört
in imperiale und nicht stadtrömische Bezirke.
Eine bemerkenswerte Neuerwerbung dieses
Museums ist der Altar des Domitius, von dem
sich Teile in München, Teile im Louvre befin-
den, der aber nunmehr in Rekonstruktion hier zu
betrachten ist. Außerordentlich bedeutsam sind
die Rekonstruktionen römischer Bauten, mit
denen eine große Kolonialpolitik das italieni-
sche Rom mit den älteren asiatischen und afri-
kanischen Kulturen zu verschmelzen suchte.
Am wichtigsten ist hier wohl der große Son-
nentempel von Heliopolis; das Theater von
Aspendis in Kleinasien, die Skulpturen aus
dem Gedenktempel des Augustus in Ilion, mit
denen die trojanische Herkunft der „gens
Julia“ und die erbberechtigte Verbindung des
römischen Hauses mit der alten kleinasiati-
Utrillo, Lesser Ury und weitere Modernen.
Autographensammlung
Hans Meyer
Berlin, Vorb. 10. April
Der erste Teil des Nachlasses des bekannten
deutschen Forschungsreisenden und Mit-
inhabers des Bibliographischen Instituts in
Leipzig, Geheimrat Dr. Hans Meyer, wird am
10. April in Berlin durch H ellmuth M e y e r
& Ernst zur Versteigerung gelangen und
dürfte mit seinem inhaltlich so einzigartig in-
teressanten Material an Autographen neuerer
deutscher Dichter und Musiker ein besonderes
Auktionsereignis bilden. Aus den 450 Nummern
dieses ersten Sammlungsteiles kann deshalb
hier nur auf wenige Einzelstücke hingewiesen
werden.
Aus der Musik-Abteilung nennen wir
das Kanon-Manuskript von Beethoven, das wir
auf Seite 4 abbilden, auf ein Haydnsches Diver-
timendo da Clavicembalo, auf ein Mozartsches
Klavierstück oder das Manuskript für zwei der
„drei Gesänge von Metastasio“ von Schubert.
Von Richard Wagner ist eine Reihe interessan-
ter Briefe vorhanden.
DIE W E L T K U N Ö T
Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933
der Provinz, vielfach in aller Stille, Samm-
lungen gebildet, deren Inhalt es begrüßens-
wert erscheinen läßt, ihn an prominenter Stelle
einem weiteren Publikum als dem zufälligen
Reisenden bekannt zu machen. Zehn Jahre
nach dieser Anregung Nicolles beschloß die
Association des Conservateurs, in periodischen
Ausstellungen in Paris die Meisterwerke der
Provinzmuseen zu vereinen, und die erste
Schau, die 1931 im Musee de l’Orangerie statt-
fand, hatte einen glänzenden Erfolg. Die
jetzt kürzlich eröffnete zweite Ausstellung,
für die der elegante Rahmen des Musee
Carnavalet, des alten Besitzes von Mme de
Sevigne, gewählt wurde und für die der Konser-
vator M. Jean R o b i q u e t, mit Unter-
stützung von M. Max Terrier, verantwortlich
zeichnet, verdient nicht geringere Beachtung.
Dieses Mal sind nicht nur die Paris benach-
barten Museumsstädte, sondern 33 Museen des
weiteren Frankreich, wie Toulon, Grenoble,
Carcasson usw., mit ihren Leihgaben vertreten.
Das Programm, das sich auf das Genrebild
und das Porträt beschränkt, ermöglicht einen
lebendigen und interessanten Überblick über
die französische Malerei vom späten 17. bis
zum frühen 19. Jahrhundert.
Das 17. Jahrhundert repräsentiert ein Bild-
nis der Mme de Montespan von Pierre
Mignard, während das berühmte Porträt des
Jean Pupil de Craponne aus dem Grenobler
Museum und drei weitere Werke von
Largilliere bereits den Übergang zum
Dixhuitieme bezeichnen. Es fehlt natürlich
nicht Rigaud: bezeichnend für ihn das Bildnis
des Bildhauers Girardon, während das ihm zu-
geschriebene Porträt eines französischen Mar-
schalls (Musee du Puy) einer Inschrift nach
von der Hand des Italieners Clementina
(1690—1761) stammen dürfte.
Besonders glänzend das 18. Jahrhundert:
Grenoble, Angers und Straßburg haben eine
Reihe von Watteaus gesandt, unter denen vor
allem das Kücheninterieur (siehe Abbil-
dung) in seiner Anlehnung an flämische
Vo'rbilder wissenschaftlich interessiert. Die
Paters aus Caen und Grenoble, etwas blaß,
aber tadellos, sind von außerordentlichem
Charme. Freundliche Lancrets, bürgerlich-
gutmütige Nonottes, ausgezeichnete Tocques,
ein Bildnis von Pesne (Replik des Dresdener
Bildes Nr. 773), ein Porträt (!) von Hubert
Robert findet man Seite an Seite mit den herr-
lichen Arbeiten von Greuze, darunter dem
Bildnis Mme de Porcin (Angers), mit den
aristokratischen Werken der Vigee-Lebrun und
zarten Nattiers, von denen wir auf S. 3 das Bild-
nis einer Malerin wiedergeben (Metz, Mu-
seum). Gerade in dieser Abteilung glänzen
die Maler-Bildnisse und -Selbstbildnisse: man
stößt auf die Selbstbildnisse von Drolling,
Duplessis, Leprince; auf das Porträt eines
Miniaturisten von Roslin, des Malers Verdussen
von Revelly, des Stechers Moyreau von
Nonnotte, des Jean de Julienne von Francois
de Troy, der das Bildnis seines großen Freun-
des Watteau in Händen hält; ferner das
Inhalt Nr. 14
Dr. G. Delbanco:
Ausstellungen in London (m. Abb.) .... 1
Meisterwerke aus Provinz-Museen (m. 3 Abb.) 1,2
Altdeutsche Zeichnungen. 2
Eine Sammlung alter Musikinstrumente in
Jena. 2
Das Museum des Imperium Romanum ... 2
Auktionsvorberichte.2, 3
Preisberichte . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
N achrichten von Überall (m. Abb.) . 4
Abbildungen:
F r a g o n ar d, Lesendes Mädchen. 1
Ä. Watteau, Die Scheuerfrau. 2
A. Watteau, Le concert champßtre. 2
J.-M. Nattier, Bildnis einer Malerin. 3
Beethoven, Kanon 11. 4
Nattiers von La Tour in Pastell. Auch unter
den Pastellen und Zeichnungen findet man
manches Überragende: Perronneau, Fragonard,
Watteau, Ingres usw. Wandteppiche von
Cozette nach Boucher und Drouais trösten über
das Fehlen von Gemälden dieser Meister hin-
weg. Das frühe 19. Jahrhundert mit
Prud’hon, Gros und einem noch ganz revolutio-
nären David runden das erlesene Ensemble
dieser Ausstellung ab.
Der ausgezeichnet redigierte illustrierte
Katalog wird der Zusammenarbeit der Damen
Charageat unter wissenschaftlicher Lei-
tung von M. Gaston B r i e r e verdankt.
A. R. (Paris)
Altdeutsche
Zeichnungen
In der Ecole Nationale des Be-
aux-Arts in Paris hat jetzt Jean M a s -
s o n aus den von ihm gesammelten Be-
ständen eine Reihe von 100 altdeutschen
Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts
ausgestellt. Massen, der vor einiger Zeit
seine in 50jähriger Arbeit mit vorzüglicher
Kennerschaft zusammengebrachte Sammlung
von etwa 6000 Zeich-
nungen und eine Kunst-
bibliothek von 6000 Bän-
den dem französischen
Staat geschenkt hat,
konnte von den hervor-
ragendsten Meistem
der deutschen Spätgotik
und Renaissance Hand-
zeichnungen erwerben.
Als ältestes Datum er-
scheint ein Blatt mit der
Inschrift 1403, ein
kniender Karthäuser-
Diakon, bestimmt als
Werk des Johann Kör-
becke. Von Stefan
L o c h n e r ist eine
kniende Jungfrau Ma-
ria. Als Arbeiten Dü-
rers stellt Masson vier
Zeichnungen aus, dar-
unter einen lyrisch-
empfindungsvollen Jo-
hannes den Täufer und
das genial zupackende
Jugendwerk, den Sün-
denfall von Adam und
Eva. Des Meisters Bru-
der Hans Dürer erscheint
mit einem farbigen tem-
peramentvollen „Jüng-
sten Gericht“. Der groß-
artige bärtige Greisen-
kopf von Hans B a1 -
düng ist eine Studie
für das im Wiener Mu-
seum bewahrte Gemälde.
Von dem älteren Hans
Holbein ist die feine
Silberstiftzeichnung
eines jungen Mädchens
mit offenem langen
Haar. Von Albrecht
Altdorfer wird eine
Anbetung der Hirten in-
mitten von Ruinen gezeigt. Aus Passau stammt
eine Zeichnung des Wolf Huber, aus Ulm ein
Blatt von Martin Schaffner, aus Augs-
burg sind die Monatsbilder von Jörg B r e u
d. A e. und das Blatt von Hans W e i d i t z. Der
Schweizer Urs Graf ist mit einem pracht-
vollen Dudelsack-Pfeifer, aus dem Jahr 1525,
vertreten, sein Berner Landsmann Niklas Ma-
nuel Deutsch mit einem Blatte „Christus
und die Ehebrecherin“, der Züricher Hans
L e u d. J. mit einer „Anna Selbdritt“. Augustin
Hirschvogel, Daniel Lindtmayr, To-
bias Stimmer fehlen nicht.
Eine Sammlung alter
Musikinstrumente in
Jena
In diesen Tagen hat sich in Jena eine
Gruppe von Liebhabern alter Musikinstrumente
zusammengefunden in der Absicht, der ständig
wachsenden Bewegung für stilgetreue, klang-
echte Wiedergabe älterer Musik einen festen
Mittelpunkt zu verschaffen. Dank dem Ent-
gegenkommen und der regen Anteilnahme der
Stadtverwaltung (Oberbürgermeister Dr. Els-
ner) ist es vor allem gelungen, geeignete
Räumlichkeiten zu finden. Im Erdgeschoß des
ehemaligen Zisterzienser-Klosters hinter der
Stadtkirche soll eine Sammlung alter Instru-
mente Unterkunft finden. Verwaltungstech-
nisch ist sie dem Staatsmuseum (Direk-
torin : Frau Dr. H. S t i r n e m a n n) als Zweig-
stelle angegliedert.
Der Hauptbestand des Museums setzt sich
aus Leihgaben zusammen, die Pianofortefabri-
kant Franz Glaser- Jena dankenswerter-
weise zur Verfügung stellt. Zur Ergänzung
dienen Leihgaben des Musikwissenschaftlichen
Seminars der Universität Jena und aus dem
Besitz von Privatdoz. Dr. W. Danckert,
der die wissenschaftliche Beratung und Leitung
des Museums übernimmt. Die technische Be-
treuung und Wiederherstellung der Altertümer
liegt in den Händen von Instrumentenbauer
A. Wasmann. Die Sammlung umfaßt in
der Hauptsache Klangwerkzeuge des 17. bis
19. Jahrhunderts — in ursprünglicher sowie in
nachgebildeter Gestalt. Den Vorrang haben
die alten Tasteninstrumente: Kielflügel (Cem-
balo), Klavichord, Hammerklaviere. Ein
Prachtstück der Sammlung bildet ein doppel-
manualiger Kielflügel von G r ä b n e r aus der
A. Watteau, Die Scheuerfrau
Leinwand, 53 : 44 cm — Straßburg, Museum
Ausstellung: Paris, Musee Carnavalet
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wohl eines
der klangschönsten und wertvollsten Tasten-
instrumente dieser Zeit.
Daneben sind hauptsächlich eine Reihe von
Blasinstrumenten aus der Bachzeit vertreten.
Der künftige Ausbau soll unter anderem auch
der wissenschaftlichen Erforschung des alten
thüringischen Instrumentenbaues dienen.
Zeichnungen und spielbare Modelle veranschau-
lichen instrumententechnische Einzelheiten, in
erster Linie die Grundformen der Klavier-
mechanik.
Im übrigen ist die Sammlung vor allem als
ein Hort lebendiger Musikübung gedacht. Die
alten Klänge sollen wiedererstehen, der ge-
schichtliche Bestand soll dazu verhelfen, wich-
tige Aufgaben gegenwärtiger Musikpflege zu
erfüllen.
Das Museum
des Imperium Romanum
Roms jüngstes Museum ist nahe dem Zir-
kus Maximus untergebracht, genau dort, wo
Palatin und Zirkus ein Ende haben und die
Tiberniederung beginnt. Man hat einen
großen Gebäudekomplex umgebaut, eine
frühere, aber außerordentlich repräsentative
Mühle, und hier fanden das Museum von Rom
und die noch jüngere, aber schon sehr bedeu-
tungsvoll gewordene Sammlung des Imperium
Romanum eine Stätte. Wer die unglückliche
Aufstellung der römischen Imperialkunst
kannte, die stets in den italienischen Museen
als ein nicht recht würdig befundenes An-
hängsel der hellenischen und hellenistischen
Kunst galt, der kann leicht beurteilen, daß die
klare Herausschälung des kaiserlich-römischen
Lebens in einem Museum bei einer Regierung,
welche dieses kaiserliche Rom zum direkten
Vorfahren erwählte, mehr als in einer Hinsicht
bedeutungsvoll werden muß. Sein Leiter,
Prof. G i g 1 i o 1 i, hat die Umordnung und
Zusammentragung der Sammlung sehr glück-
lich erreicht. Die Ausgrabungen der letzten
acht Jahre haben fast durchweg kaiserlich-
römischen Stätten gegolten, so ist ein Material
zusammengekommen, das für ein einzelnes
Museum nahezu zu reichhaltig war, und es war
nicht notwendig, andere schon bestehende
Sammlungen auszuplündern. Die Ordnung des
Museums ist sehr geschickt: sie ist in gewisser
Weise geographisch vorgenommen worden. Die
Zentralsäle sind der Urbs Vorbehalten, rund
herum lagern sich die Provinzen, die Italien,
Frankreich, Deutschland, Afrika, Asien, Grie-
chenland heißen. So wandert man im Unter-
geschoß zunächst durch die Sammlungen aus
Pannonien, Italien, Frankreich, den rheini-
schen und baverischen Landen. Im ersten Ge-
schoß hat Dalmatien, imperiales Zentrum
sehen Stadt bewiesen werden sollte, gehören
hierher. Schließlich hat man noch die römi-
schen Erinnerungen an die „gentes externae“,
an jene Völkerschaften, welche außerhalb der
Pax Romana wohnten, eingefügt. So kommt
man zu einem Bilde jener Welt, wie der Römer
des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts sie
sah und die eigentümliche Mischung von Po-
litik, Kunst und Realbau, die für dieses kaiser-
liche Rom typisch gewesen ist, schält sich her-
aus, erlöst die seelenarmen, römischen Statuen
aus jener unerträglichen Langeweile, unter der
sie litten, solange sie in den Museen neben
den aus einer vollkommenen anderen Welt
stammenden griechischen Plastiken sich be-
haupten sollten. G. Reinboth
Auktionsvorberichte
Verlegung
der Kimbel-Auktion
Das Auktions-Haus Rudolph Lepke hat
sich wegen der derzeitigen Wirtschaftslage ent-
schlossen, von der für den 4. und 5. April an-
gesetzten Versteigerung der Ostasien-Samm-
lung Kimbel vorläufig Abstand zu nehmen, da
auch der Herr Polizeipräsident von Berlin
dahingehende Bedenken geäußert hat.
Möbel, Gemälde
Berlin, Vorb. 8. April
In der nächsten Versteigerung des Inter-
nationalen Kunst- und Auktions-
hauses finden wir
A. Watteau, Le concert champetre
Leinwand, 63: 49 cm — Angers, Museum
Ausstellung: Paris, Musee Carnavalet
schöne Möbel der Re-
naissance- und Barock-
Zeit sowie des 18. Jahr-
hunderts. Ein ‘Satz
von vier Point-Ses-
seln, kleine signierte
französische Kommo-
den, Renaissance-Tische,
von denen der eine
in dem Werk von
Professor Schottmüller
abgebildet ist, und
Renaissance-Kredenzen
sind in der Ver-
steigerungsmasse ent-
halten. Zahlreiches an-
tikes Silber, darunter
ein Pokal, der der
Delfter Wollweber-In-
nung im Jahre 1629
geschenkt wurde (Ab-
bildung in Nr. 13
der „Weltkunst“), Ber-
liner Porzellane aus
der besten Zeit, hier-
unter ein komplettes
Service, das nur ein-
malig existiert, und
Plastiken leiten zu
den Gemälden alter
und neuer Meister über.
Hier sei besonders
hingewiesen auf eine
Marine des B. Peeters,
Werke von Droochs-
loot, Teniers, Mole-
naer u. a., sowie von
Gemälden neuer Mei-
ster auf typische Ko-
walskis (Abbildung
in Nr. 13), eine der
besten Landschaften
von Hans Thoma, ein
Porträt von Leibi, ab-
gebildet im Werk von
Professor Waldmann,
Arbeiten von Renoir,
unter Diokletian, Mösien, Dazien und Britan-
nien, schließlich Spanien seinen Platz ge-
funden. Ausgezeichnet ist die Eingliederung
und Aufteilung des Materials vorgenommen
worden. So hat man die Abgüsse der Mark-
Anton-Säule, die niemals genau zu betrach-
tenden Reliefs der Säule der Piazza Colonna
nicht in die römische Stadtabteilung, sondern
in die der dacischen Provinz hineingebracht.
Der Quaden- und Markomannenkrieg führt in
ein frühes deutsches Leben hinein und gehört
in imperiale und nicht stadtrömische Bezirke.
Eine bemerkenswerte Neuerwerbung dieses
Museums ist der Altar des Domitius, von dem
sich Teile in München, Teile im Louvre befin-
den, der aber nunmehr in Rekonstruktion hier zu
betrachten ist. Außerordentlich bedeutsam sind
die Rekonstruktionen römischer Bauten, mit
denen eine große Kolonialpolitik das italieni-
sche Rom mit den älteren asiatischen und afri-
kanischen Kulturen zu verschmelzen suchte.
Am wichtigsten ist hier wohl der große Son-
nentempel von Heliopolis; das Theater von
Aspendis in Kleinasien, die Skulpturen aus
dem Gedenktempel des Augustus in Ilion, mit
denen die trojanische Herkunft der „gens
Julia“ und die erbberechtigte Verbindung des
römischen Hauses mit der alten kleinasiati-
Utrillo, Lesser Ury und weitere Modernen.
Autographensammlung
Hans Meyer
Berlin, Vorb. 10. April
Der erste Teil des Nachlasses des bekannten
deutschen Forschungsreisenden und Mit-
inhabers des Bibliographischen Instituts in
Leipzig, Geheimrat Dr. Hans Meyer, wird am
10. April in Berlin durch H ellmuth M e y e r
& Ernst zur Versteigerung gelangen und
dürfte mit seinem inhaltlich so einzigartig in-
teressanten Material an Autographen neuerer
deutscher Dichter und Musiker ein besonderes
Auktionsereignis bilden. Aus den 450 Nummern
dieses ersten Sammlungsteiles kann deshalb
hier nur auf wenige Einzelstücke hingewiesen
werden.
Aus der Musik-Abteilung nennen wir
das Kanon-Manuskript von Beethoven, das wir
auf Seite 4 abbilden, auf ein Haydnsches Diver-
timendo da Clavicembalo, auf ein Mozartsches
Klavierstück oder das Manuskript für zwei der
„drei Gesänge von Metastasio“ von Schubert.
Von Richard Wagner ist eine Reihe interessan-
ter Briefe vorhanden.