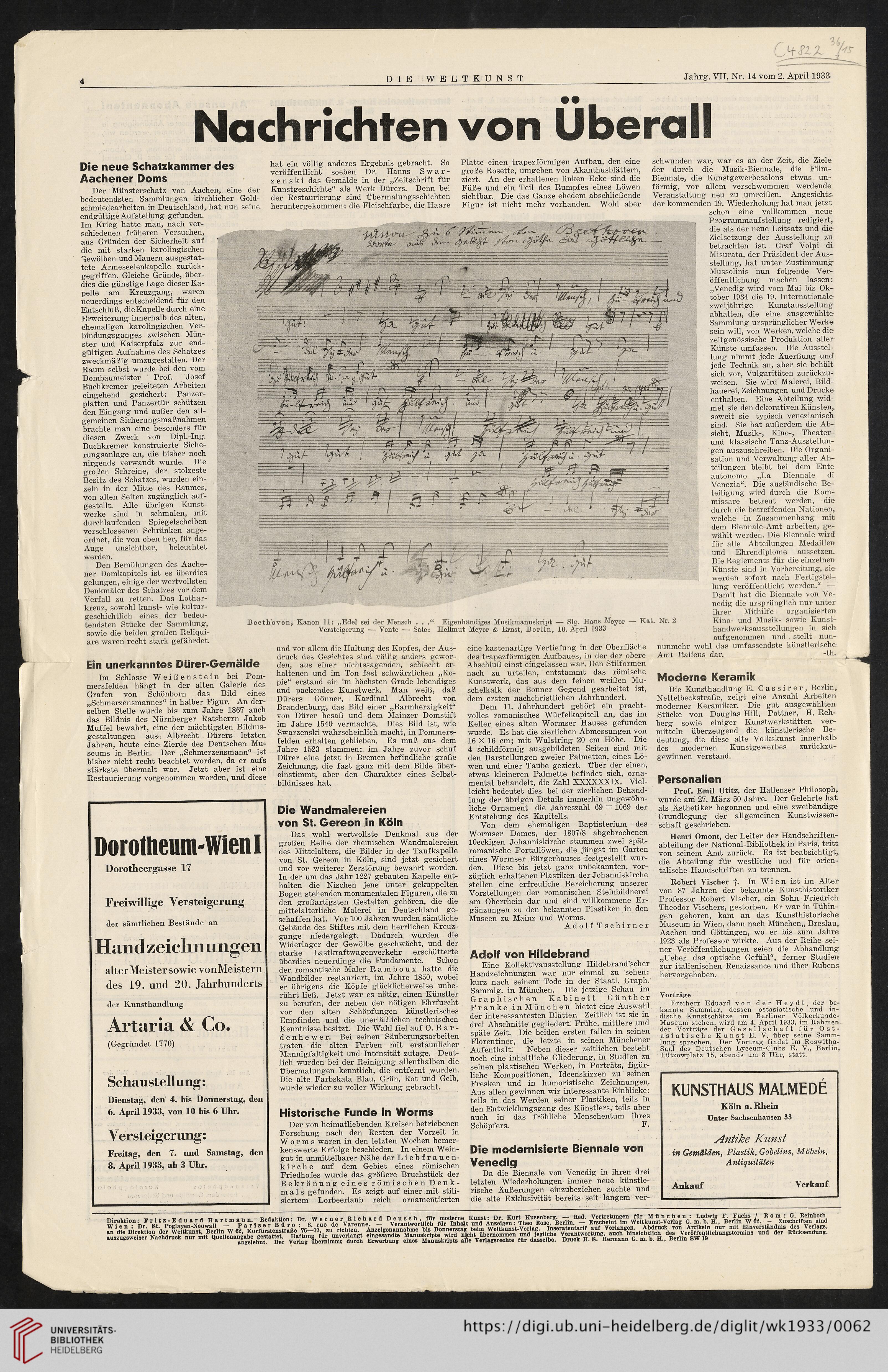4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933
Nachrichten von Überall
Die neue Schatzkammer des
Aachener Doms
Der Münsterschatz von Aachen, eine der
bedeutendsten Sammlungen kirchlicher Gold-
schmiedearbeiten in Deutschland, hat nun seine
endgültige Aufstellung gefunden.
Im Krieg hatte man, nach ver-
schiedenen früheren Versuchen,
aus Gründen der Sicherheit auf
die mit starken karolingischen
Gewölben und Mauern ausgestat-
tete Armeseelenkapelle zurück-
gegriffen. Gleiche Gründe, über-
dies die günstige Lage dieser Ka-
pelle am Kreuzgang, waren
neuerdings entscheidend für den
Entschluß, die Kapelle durch eine
Erweiterung innerhalb des alten,
ehemaligen karolingischen Ver-
bindungsganges zwischen Mün-
ster und Kaiserpfalz zur end-
gültigen Aufnahme des Schatzes
zweckmäßig umzugestalten. Der
Raum selbst wurde bei den vom
Dombaumeister Prof. Josef
Buchkremer geleiteten Arbeiten
eingehend gesichert: Panzer-
platten und Panzertür schützen
den Eingang und außer den all-
gemeinen Sicherungsmaßnahmen
brachte man eine besonders für
diesen Zweck von Dipl.-Ing.
Buchkremer konstruierte Siche-
rungsanlage an, die bisher noch
nirgends verwandt wurde. Die
großen Schreine, der stolzeste
Besitz des Schatzes, wurden ein-
zeln in der Mitte des Raumes,
von allen Seiten zugänglich auf-
gestellt. Alle übrigen Kunst-
werke sind in schmalen, mit
durchlaufenden Spiegelscheiben
verschlossenen Schränken ange-
ordnet, die von oben her, für das
Auge unsichtbar, beleuchtet
werden.
Den Bemühungen des Aache-
ner Domkapitels ist es überdies
gelungen, einige der wertvollsten
Denkmäler des Schatzes vor dem
Verfall zu retten. Das Lothar-
kreuz, sowohl kunst- wie kultur-
geschichtlich eines der bedeu-
tendsten Stücke der Sammlung,
sowie die beiden großen Reliqui-
are waren recht stark gefährdet.
Ein unerkanntes Dürer-Gemälde
Im Schlosse Weißenstein bei Pom-
mersfelden hängt in der alten Galerie des
Grafen von Schönborn das Bild eines
„Schmerzensmannes“ in halber Figur. An der-
selben Stelle wurde bis zum Jahre 1867 auch
das Bildnis des Nürnberger Ratsherrn Jakob
Muffel bewahrt, eine der mächtigsten Bildnis-
gestaltungen aus. Albrecht Dürers letzten
Jahren, heute eine. Zierde des Deutschen Mu-
seums in Berlin. Der „Schmerzensmann“ ist
bisher nicht recht beachtet worden, da er aufs
stärkste übermalt war. Jetzt aber ist eine
Restaurierung vorgenommen worden, und diese
Dorotheum-Wienl
Dorotheergasse 17
Freiwillige Versteigerung
der sämtlichen Bestände an
Handzeiclinungen
alter Meister sowie vonMeistern
des 19. und 20. Jahrhunderts
der Kunsthandlung
Artaria & Co.
(Gegründet 1770)
Schaustellung:
Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den
6. April 1933, von 10 bis 6 Uhr.
V erst eigerung:
Freitag, den 7. und Samstag, den
8. April 1933, ab 3 Uhr.
hat ein völlig anderes Ergebnis gebracht. So
veröffentlicht soeben Dr. Hanns S War-
ze n s k i das Gemälde in der „Zeitschrift für
Kunstgeschichte“ als Werk Dürers. Denn bei
der Restaurierung sind Übermalungsschichten
heruntergekommen: die Fleischfarbe, die Haare
und vor allem die Haltung des Kopfes, der Aus-
druck des Gesichtes sind völlig anders gewor-
den, aus einer nichtssagenden, schlecht er-
haltenen und im Ton fast schwärzlichen „Ko-
pie“ erstand ein im höchsten Grade lebendiges
und packendes Kunstwerk. Man weiß, daß
Dürers Gönner, Kardinal Albrecht von
Brandenburg, das Bild einer „Barmherzigkeit“
von Dürer besaß und dem Mainzer Domstift
im Jahre 1540 vermachte. Dies Bild ist, wie
Swarzenski wahrscheinlich macht, in Pommers-
felden erhalten geblieben. Es muß aus dem
Jahre 1523 stammen: im Jahre zuvor schuf
Dürer eine jetzt in Bremen befindliche große
Zeichnung, die fast ganz mit dem Bilde über-
einstimmt, aber den Charakter eines Selbst-
bildnisses hat.
Die Wandmalereien
von St. Gereon in Köln
Das wohl wertvollste Denkmal aus der
großen Reihe der rheinischen Wandmalereien
des Mittelalters, die Bilder in der Taufkapelle
von St. Gereon in Köln, sind jetzt gesichert
und vor weiterer Zerstörung bewahrt worden.
In der um das Jahr 1227 gebauten Kapelle ent-
halten die Nischen jene unter gekuppelten
Bogen stehenden monumentalen Figuren, die zu
den großartigsten Gestalten gehören, die die
mittelalterliche Malerei in Deutschland ge-
schaffen hat. Vor 100 Jahren wurden sämtliche
Gebäude des Stiftes mit dem herrlichen Kreuz-
gange niedergelegt. Dadurch wurden die
Widerlager der Gewölbe geschwächt, und der
starke Lastkraftwagenverkehr erschütterte
überdies neuerdings die Fundamente. Schon
der romantische Maler R a m b o u x hatte die
Wandbilder restauriert, im Jahre 1850, wobei
er übrigens die Köpfe glücklicherweise unbe-
rührt ließ. Jetzt war es nötig, einen Künstler
zu berufen, der neben der nötigen Ehrfurcht
vor den alten Schöpfungen künstlerisches
Empfinden und die unerläßlichen technischen
Kenntnisse besitzt. Die Wahl fiel auf O. B a r -
denhewer. Bei seinen Säuberungsarbeiten
traten die alten Farben mit erstaunlicher
Mannigfaltigkeit und Intensität zutage. Deut-
lich -wurden bei der Reinigung allenthalben die
Übermalungen kenntlich, die entfernt wurden.
Die alte Farbskala Blau, Grün, Rot und Gelb,
wurde wieder zu voller Wirkung gebracht.
Historische Funde in Worms
Der von heimatliebenden Kreisen betriebenen
Forschung nach den Resten der Vorzeit in
W o r m s waren in den letzten Wochen bemer-
kenswerte Erfolge beschieden. In einem Wein-
gut in unmittelbarer Nähe der Liebfrauen-
kirche auf dem Gebiet eines römischen
Friedhofes wurde das größere Bruchstück der
Bekrönung eines römischen Denk-
mals gefunden. Es zeigt auf einer mit stili-
siertem Lorbeerlaub reich ornamentierten
Platte einen trapezförmigen Aufbau, den eine
große Rosette, umgeben von Akanthusblättern,
ziert. An der erhaltenen linken Ecke sind die
Füße und ein Teil des Rumpfes eines Löwen
sichtbar. Die das Ganze ehedem abschließende
Figur ist nicht mehr vorhanden. Wohl aber
eine kastenartige Vertiefung in der Oberfläche
des trapezförmigen Aufbaues, in der der obere
Abschluß einst eingelassen war. Den Stilformen
nach zu urteilen, entstammt das römische
Kunstwerk, das aus dem feinen weißen Mu-
schelkalk der Bonner Gegend gearbeitet ist,
dem ersten nachchristlichen Jahrhundert.
Dem 11. Jahrhundert gehört ein pracht-
volles romanisches Würfelkapitell an, das im
Keller eines alten Wormser Hauses gefunden
wurde. Es hat die zierlichen Abmessungen von
16 X 16 cm; mit Wulstring 20 cm Höhe. Die
4 schildförmig ausgebildeten Seiten sind mit
den Darstellungen zweier Palmetten, eines Lö-
wen und einer Taube geziert. Über der einen,
etwas kleineren Palmette befindet sich, orna-
mental behandelt, die Zahl XXXXXXIX. Viel-
leicht bedeutet dies bei der zierlichen Behand-
lung der übrigen Details immerhin ungewöhn-
liche Ornament die Jahreszahl 69 = 1069 der
Entstehung des Kapitells.
Von dem ehemaligen Baptisterium des
Wormser Domes, der 1807/8 abgebrochenen
lOeckigen Johanniskirche stammen zwei spät-
romanische Portallöwen, die jüngst im Garten
eines Wormser Bürgerhauses festgestellt wur-
den. Diese bis jetzt ganz unbekannten, vor-
züglich erhaltenen Plastiken der Johanniskirche
stellen eine erfreuliche Bereicherung unserer
Vorstellungen der romanischen Steinbildnerei
am Oberrhein dar und sind willkommene Er-
gänzungen zu den bekannten Plastiken in den
Museen zu Mainz und Worms.
Adolf Tschirner
Adolf von Hildebrand
Eine Kollektivausstellung Hildebrand’scher
Handzeichnungen war nur einmal zu sehen:
kurz nach seinem Tode in der Staatl. Graph.
Sammlg. in München. Die jetzige Schau im
Graphischen Kabinett Günther
Franke inMünchen bietet eine Auswahl
der interessantesten Blätter. Zeitlich ist sie in
drei Abschnitte gegliedert. Frühe, mittlere und
späte Zeit. Die beiden ersten fallen in seinen
Florentiner, die letzte in seinen Münchener
Aufenthalt. Neben dieser zeitlichen besteht
noch eine inhaltliche Gliederung, in Studien zu
seinen plastischen Werken, in Porträts, figür-
liche Kompositionen, Ideenskizzen zu seinen
Fresken und in humoristische Zeichnungen.
Aus allen gewinnen wir interessante Einblicke:
teils in das Werden seiner Plastiken, teils in
den Entwicklungsgang des Künstlers, teils aber
auch in das fröhliche Menschentum ihres
Schöpfers. F.
Die modernisierte Biennale von
Venedig
Da die Biennale von Venedig in ihren drei
letzten Wiederholungen immer neue künstle-
rische Äußerungen einzubeziehen suchte und
die alte Exklusivität bereits seit langem ver-
schwunden war, war es an der Zeit, die Ziele
der durch die Musik-Biennale, die Film-
Biennale, die Kunstgewerbesalons etwas un-
förmig, vor allem verschwommen werdende
Veranstaltung neu zu umreißen. Angesichts
der kommenden 19. Wiederholung hat man jetzt
schon eine vollkommen neue
Programmaufstellung redigiert,
die als der neue Leitsatz und die
Zielsetzung der Ausstellung zu
betrachten ist. Graf Volpi di
Misurata, der Präsident der Aus-
stellung, hat unter Zustimmung
Mussolinis nun folgende Ver-
öffentlichung machen lassen:
„Venedig wird vom Mai bis Ok-
tober 1934 die 19. Internationale
zweijährige Kunstausstellung
abhalten, die eine ausgewählte
Sammlung ursprünglicher Werke
sein will, von Werken, welche die
zeitgenössische Produktion aller
Künste umfassen. Die Ausstel-
lung nimmt jede Äuerßung und
jede Technik an, aber sie behält
sich vor, Vulgaritäten zurückzu-
weisen. Sie wird Malerei, Bild-
hauerei, Zeichnungen und Drucke
enthalten. Eine Abteilung wid-
met sie den dekorativen Künsten,,
soweit sie typisch venezianisch
sind. Sie hat außerdem die Ab-
sicht, Musik-, Kino-, Theater-
und klassische Tanz-Ausstellun-
gen auszuschreiben. Die Organi-
sation und Verwaltung aller Ab-
teilungen bleibt bei dem Ente
autonomo „La Biennale di
Venezia“. Die ausländische Be-
teiligung wird durch die Kom-
missare betreut werden, die
durch die betreffenden Nationen,
welche in Zusammenhang mit
dem Biennale-Amt arbeiten, ge-
wählt werden. Die Biennale wird
für alle Abteilungen Medaillen
und Ehrendiplome aussetzen.
Die Reglements für die einzelnen
Künste sind in Vorbereitung, sie
werden sofort nach Fertigstel-
lung veröffentlicht werden.“ —
Damit hat die Biennale von Ve-
nedig die ursprünglich nur unter
ihrer Mithilfe organisierten
Kino- und Musik- sowie Kunst-
handwerksausstellungen in sich
aufgenommen und stellt nun-
nunmehr wohl das umfassendste künstlerische
Amt Italiens dar. -th.
Moderne Keramik
Die Kunsthandlung E. Cassirer, Berlin,
Nettelbeckstraße, zeigt eine Anzahl Arbeiten
moderner Keramiker. Die gut ausgewählten
Stücke von Douglas Hill, Pottner, H. Reh-
berg sowie einiger Kunstwerkstätten ver-
mitteln überzeugend die künstlerische Be-
deutung, die diese alte Volkskunst innerhalb
des modernen Kunstgewerbes zurückzu-
gewinnen verstand.
Personalien
Prof. Emil Utitz, der Hallenser Philosoph,
wurde am 27. März 50 Jahre. Der Gelehrte hat
als Ästhetiker begonnen und eine zweibändige
Grundlegung der allgemeinen Kunstwissen-
schaft geschrieben.
Henri Omont, der Leiter der Handschriften-
abteilung der National-Bibliothek in Paris, tritt
von seinem Amt zurück. Es ist beabsichtigt,
die Abteilung für westliche und für orien-
talische Handschriften zu trennen.
Robert Vischer f. In W i e n ist im Alter
von 87 Jahren der bekannte Kunsthistoriker
Professor Robert Vischer, ein Sohn Friedrich
Theodor Vischers, gestorben. Er war in Tübin-
gen geboren, kam an das Kunsthistorische
Museum in Wien, dann nach München,, Breslau,
Aachen und Göttingen, wo er bis zum Jahre
1923 als Professor wirkte. Aus der Reihe sei-
ner Veröffentlichungen seien die Abhandlung
„Heber das optische Gefühl“, ferner Studien
zur italienischen Renaissance und über Rubens
hervorgehoben.
Vorträge
Freiherr Eduard von der Heydt, der be-
kannte Sammler, dessen ostasiatische und in-
dische Kunstschätze im Berliner Völkerkunde-
Museum stehen, wird am 4. April 1933, im Rahmen
der. Vorträge der Gesellschaft für Ost-
asiatische Kunst E. V. über seine Samm-
lung sprechen. Der Vortrag findet im Roswitha-
Saal des Deutschen Lyceum-Clubs E. V., Berlin,
Lützowplatz 15, abends um 8 Uhr, statt.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Beethoven, Kanon II: „Edel sei der Mensch . . .“ Eigenhändiges Musikmanuskript — Slg. Hans Meyer — Kat. Nr. 2
Versteigerung — Vente — Sale: Hellmut Meyer & Ernst, Berlin, 10. April 1933
Direktion: Frltz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs I Rom: G. Relnboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933
Nachrichten von Überall
Die neue Schatzkammer des
Aachener Doms
Der Münsterschatz von Aachen, eine der
bedeutendsten Sammlungen kirchlicher Gold-
schmiedearbeiten in Deutschland, hat nun seine
endgültige Aufstellung gefunden.
Im Krieg hatte man, nach ver-
schiedenen früheren Versuchen,
aus Gründen der Sicherheit auf
die mit starken karolingischen
Gewölben und Mauern ausgestat-
tete Armeseelenkapelle zurück-
gegriffen. Gleiche Gründe, über-
dies die günstige Lage dieser Ka-
pelle am Kreuzgang, waren
neuerdings entscheidend für den
Entschluß, die Kapelle durch eine
Erweiterung innerhalb des alten,
ehemaligen karolingischen Ver-
bindungsganges zwischen Mün-
ster und Kaiserpfalz zur end-
gültigen Aufnahme des Schatzes
zweckmäßig umzugestalten. Der
Raum selbst wurde bei den vom
Dombaumeister Prof. Josef
Buchkremer geleiteten Arbeiten
eingehend gesichert: Panzer-
platten und Panzertür schützen
den Eingang und außer den all-
gemeinen Sicherungsmaßnahmen
brachte man eine besonders für
diesen Zweck von Dipl.-Ing.
Buchkremer konstruierte Siche-
rungsanlage an, die bisher noch
nirgends verwandt wurde. Die
großen Schreine, der stolzeste
Besitz des Schatzes, wurden ein-
zeln in der Mitte des Raumes,
von allen Seiten zugänglich auf-
gestellt. Alle übrigen Kunst-
werke sind in schmalen, mit
durchlaufenden Spiegelscheiben
verschlossenen Schränken ange-
ordnet, die von oben her, für das
Auge unsichtbar, beleuchtet
werden.
Den Bemühungen des Aache-
ner Domkapitels ist es überdies
gelungen, einige der wertvollsten
Denkmäler des Schatzes vor dem
Verfall zu retten. Das Lothar-
kreuz, sowohl kunst- wie kultur-
geschichtlich eines der bedeu-
tendsten Stücke der Sammlung,
sowie die beiden großen Reliqui-
are waren recht stark gefährdet.
Ein unerkanntes Dürer-Gemälde
Im Schlosse Weißenstein bei Pom-
mersfelden hängt in der alten Galerie des
Grafen von Schönborn das Bild eines
„Schmerzensmannes“ in halber Figur. An der-
selben Stelle wurde bis zum Jahre 1867 auch
das Bildnis des Nürnberger Ratsherrn Jakob
Muffel bewahrt, eine der mächtigsten Bildnis-
gestaltungen aus. Albrecht Dürers letzten
Jahren, heute eine. Zierde des Deutschen Mu-
seums in Berlin. Der „Schmerzensmann“ ist
bisher nicht recht beachtet worden, da er aufs
stärkste übermalt war. Jetzt aber ist eine
Restaurierung vorgenommen worden, und diese
Dorotheum-Wienl
Dorotheergasse 17
Freiwillige Versteigerung
der sämtlichen Bestände an
Handzeiclinungen
alter Meister sowie vonMeistern
des 19. und 20. Jahrhunderts
der Kunsthandlung
Artaria & Co.
(Gegründet 1770)
Schaustellung:
Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den
6. April 1933, von 10 bis 6 Uhr.
V erst eigerung:
Freitag, den 7. und Samstag, den
8. April 1933, ab 3 Uhr.
hat ein völlig anderes Ergebnis gebracht. So
veröffentlicht soeben Dr. Hanns S War-
ze n s k i das Gemälde in der „Zeitschrift für
Kunstgeschichte“ als Werk Dürers. Denn bei
der Restaurierung sind Übermalungsschichten
heruntergekommen: die Fleischfarbe, die Haare
und vor allem die Haltung des Kopfes, der Aus-
druck des Gesichtes sind völlig anders gewor-
den, aus einer nichtssagenden, schlecht er-
haltenen und im Ton fast schwärzlichen „Ko-
pie“ erstand ein im höchsten Grade lebendiges
und packendes Kunstwerk. Man weiß, daß
Dürers Gönner, Kardinal Albrecht von
Brandenburg, das Bild einer „Barmherzigkeit“
von Dürer besaß und dem Mainzer Domstift
im Jahre 1540 vermachte. Dies Bild ist, wie
Swarzenski wahrscheinlich macht, in Pommers-
felden erhalten geblieben. Es muß aus dem
Jahre 1523 stammen: im Jahre zuvor schuf
Dürer eine jetzt in Bremen befindliche große
Zeichnung, die fast ganz mit dem Bilde über-
einstimmt, aber den Charakter eines Selbst-
bildnisses hat.
Die Wandmalereien
von St. Gereon in Köln
Das wohl wertvollste Denkmal aus der
großen Reihe der rheinischen Wandmalereien
des Mittelalters, die Bilder in der Taufkapelle
von St. Gereon in Köln, sind jetzt gesichert
und vor weiterer Zerstörung bewahrt worden.
In der um das Jahr 1227 gebauten Kapelle ent-
halten die Nischen jene unter gekuppelten
Bogen stehenden monumentalen Figuren, die zu
den großartigsten Gestalten gehören, die die
mittelalterliche Malerei in Deutschland ge-
schaffen hat. Vor 100 Jahren wurden sämtliche
Gebäude des Stiftes mit dem herrlichen Kreuz-
gange niedergelegt. Dadurch wurden die
Widerlager der Gewölbe geschwächt, und der
starke Lastkraftwagenverkehr erschütterte
überdies neuerdings die Fundamente. Schon
der romantische Maler R a m b o u x hatte die
Wandbilder restauriert, im Jahre 1850, wobei
er übrigens die Köpfe glücklicherweise unbe-
rührt ließ. Jetzt war es nötig, einen Künstler
zu berufen, der neben der nötigen Ehrfurcht
vor den alten Schöpfungen künstlerisches
Empfinden und die unerläßlichen technischen
Kenntnisse besitzt. Die Wahl fiel auf O. B a r -
denhewer. Bei seinen Säuberungsarbeiten
traten die alten Farben mit erstaunlicher
Mannigfaltigkeit und Intensität zutage. Deut-
lich -wurden bei der Reinigung allenthalben die
Übermalungen kenntlich, die entfernt wurden.
Die alte Farbskala Blau, Grün, Rot und Gelb,
wurde wieder zu voller Wirkung gebracht.
Historische Funde in Worms
Der von heimatliebenden Kreisen betriebenen
Forschung nach den Resten der Vorzeit in
W o r m s waren in den letzten Wochen bemer-
kenswerte Erfolge beschieden. In einem Wein-
gut in unmittelbarer Nähe der Liebfrauen-
kirche auf dem Gebiet eines römischen
Friedhofes wurde das größere Bruchstück der
Bekrönung eines römischen Denk-
mals gefunden. Es zeigt auf einer mit stili-
siertem Lorbeerlaub reich ornamentierten
Platte einen trapezförmigen Aufbau, den eine
große Rosette, umgeben von Akanthusblättern,
ziert. An der erhaltenen linken Ecke sind die
Füße und ein Teil des Rumpfes eines Löwen
sichtbar. Die das Ganze ehedem abschließende
Figur ist nicht mehr vorhanden. Wohl aber
eine kastenartige Vertiefung in der Oberfläche
des trapezförmigen Aufbaues, in der der obere
Abschluß einst eingelassen war. Den Stilformen
nach zu urteilen, entstammt das römische
Kunstwerk, das aus dem feinen weißen Mu-
schelkalk der Bonner Gegend gearbeitet ist,
dem ersten nachchristlichen Jahrhundert.
Dem 11. Jahrhundert gehört ein pracht-
volles romanisches Würfelkapitell an, das im
Keller eines alten Wormser Hauses gefunden
wurde. Es hat die zierlichen Abmessungen von
16 X 16 cm; mit Wulstring 20 cm Höhe. Die
4 schildförmig ausgebildeten Seiten sind mit
den Darstellungen zweier Palmetten, eines Lö-
wen und einer Taube geziert. Über der einen,
etwas kleineren Palmette befindet sich, orna-
mental behandelt, die Zahl XXXXXXIX. Viel-
leicht bedeutet dies bei der zierlichen Behand-
lung der übrigen Details immerhin ungewöhn-
liche Ornament die Jahreszahl 69 = 1069 der
Entstehung des Kapitells.
Von dem ehemaligen Baptisterium des
Wormser Domes, der 1807/8 abgebrochenen
lOeckigen Johanniskirche stammen zwei spät-
romanische Portallöwen, die jüngst im Garten
eines Wormser Bürgerhauses festgestellt wur-
den. Diese bis jetzt ganz unbekannten, vor-
züglich erhaltenen Plastiken der Johanniskirche
stellen eine erfreuliche Bereicherung unserer
Vorstellungen der romanischen Steinbildnerei
am Oberrhein dar und sind willkommene Er-
gänzungen zu den bekannten Plastiken in den
Museen zu Mainz und Worms.
Adolf Tschirner
Adolf von Hildebrand
Eine Kollektivausstellung Hildebrand’scher
Handzeichnungen war nur einmal zu sehen:
kurz nach seinem Tode in der Staatl. Graph.
Sammlg. in München. Die jetzige Schau im
Graphischen Kabinett Günther
Franke inMünchen bietet eine Auswahl
der interessantesten Blätter. Zeitlich ist sie in
drei Abschnitte gegliedert. Frühe, mittlere und
späte Zeit. Die beiden ersten fallen in seinen
Florentiner, die letzte in seinen Münchener
Aufenthalt. Neben dieser zeitlichen besteht
noch eine inhaltliche Gliederung, in Studien zu
seinen plastischen Werken, in Porträts, figür-
liche Kompositionen, Ideenskizzen zu seinen
Fresken und in humoristische Zeichnungen.
Aus allen gewinnen wir interessante Einblicke:
teils in das Werden seiner Plastiken, teils in
den Entwicklungsgang des Künstlers, teils aber
auch in das fröhliche Menschentum ihres
Schöpfers. F.
Die modernisierte Biennale von
Venedig
Da die Biennale von Venedig in ihren drei
letzten Wiederholungen immer neue künstle-
rische Äußerungen einzubeziehen suchte und
die alte Exklusivität bereits seit langem ver-
schwunden war, war es an der Zeit, die Ziele
der durch die Musik-Biennale, die Film-
Biennale, die Kunstgewerbesalons etwas un-
förmig, vor allem verschwommen werdende
Veranstaltung neu zu umreißen. Angesichts
der kommenden 19. Wiederholung hat man jetzt
schon eine vollkommen neue
Programmaufstellung redigiert,
die als der neue Leitsatz und die
Zielsetzung der Ausstellung zu
betrachten ist. Graf Volpi di
Misurata, der Präsident der Aus-
stellung, hat unter Zustimmung
Mussolinis nun folgende Ver-
öffentlichung machen lassen:
„Venedig wird vom Mai bis Ok-
tober 1934 die 19. Internationale
zweijährige Kunstausstellung
abhalten, die eine ausgewählte
Sammlung ursprünglicher Werke
sein will, von Werken, welche die
zeitgenössische Produktion aller
Künste umfassen. Die Ausstel-
lung nimmt jede Äuerßung und
jede Technik an, aber sie behält
sich vor, Vulgaritäten zurückzu-
weisen. Sie wird Malerei, Bild-
hauerei, Zeichnungen und Drucke
enthalten. Eine Abteilung wid-
met sie den dekorativen Künsten,,
soweit sie typisch venezianisch
sind. Sie hat außerdem die Ab-
sicht, Musik-, Kino-, Theater-
und klassische Tanz-Ausstellun-
gen auszuschreiben. Die Organi-
sation und Verwaltung aller Ab-
teilungen bleibt bei dem Ente
autonomo „La Biennale di
Venezia“. Die ausländische Be-
teiligung wird durch die Kom-
missare betreut werden, die
durch die betreffenden Nationen,
welche in Zusammenhang mit
dem Biennale-Amt arbeiten, ge-
wählt werden. Die Biennale wird
für alle Abteilungen Medaillen
und Ehrendiplome aussetzen.
Die Reglements für die einzelnen
Künste sind in Vorbereitung, sie
werden sofort nach Fertigstel-
lung veröffentlicht werden.“ —
Damit hat die Biennale von Ve-
nedig die ursprünglich nur unter
ihrer Mithilfe organisierten
Kino- und Musik- sowie Kunst-
handwerksausstellungen in sich
aufgenommen und stellt nun-
nunmehr wohl das umfassendste künstlerische
Amt Italiens dar. -th.
Moderne Keramik
Die Kunsthandlung E. Cassirer, Berlin,
Nettelbeckstraße, zeigt eine Anzahl Arbeiten
moderner Keramiker. Die gut ausgewählten
Stücke von Douglas Hill, Pottner, H. Reh-
berg sowie einiger Kunstwerkstätten ver-
mitteln überzeugend die künstlerische Be-
deutung, die diese alte Volkskunst innerhalb
des modernen Kunstgewerbes zurückzu-
gewinnen verstand.
Personalien
Prof. Emil Utitz, der Hallenser Philosoph,
wurde am 27. März 50 Jahre. Der Gelehrte hat
als Ästhetiker begonnen und eine zweibändige
Grundlegung der allgemeinen Kunstwissen-
schaft geschrieben.
Henri Omont, der Leiter der Handschriften-
abteilung der National-Bibliothek in Paris, tritt
von seinem Amt zurück. Es ist beabsichtigt,
die Abteilung für westliche und für orien-
talische Handschriften zu trennen.
Robert Vischer f. In W i e n ist im Alter
von 87 Jahren der bekannte Kunsthistoriker
Professor Robert Vischer, ein Sohn Friedrich
Theodor Vischers, gestorben. Er war in Tübin-
gen geboren, kam an das Kunsthistorische
Museum in Wien, dann nach München,, Breslau,
Aachen und Göttingen, wo er bis zum Jahre
1923 als Professor wirkte. Aus der Reihe sei-
ner Veröffentlichungen seien die Abhandlung
„Heber das optische Gefühl“, ferner Studien
zur italienischen Renaissance und über Rubens
hervorgehoben.
Vorträge
Freiherr Eduard von der Heydt, der be-
kannte Sammler, dessen ostasiatische und in-
dische Kunstschätze im Berliner Völkerkunde-
Museum stehen, wird am 4. April 1933, im Rahmen
der. Vorträge der Gesellschaft für Ost-
asiatische Kunst E. V. über seine Samm-
lung sprechen. Der Vortrag findet im Roswitha-
Saal des Deutschen Lyceum-Clubs E. V., Berlin,
Lützowplatz 15, abends um 8 Uhr, statt.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Beethoven, Kanon II: „Edel sei der Mensch . . .“ Eigenhändiges Musikmanuskript — Slg. Hans Meyer — Kat. Nr. 2
Versteigerung — Vente — Sale: Hellmut Meyer & Ernst, Berlin, 10. April 1933
Direktion: Frltz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs I Rom: G. Relnboth
Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind
an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,
auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.
abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19