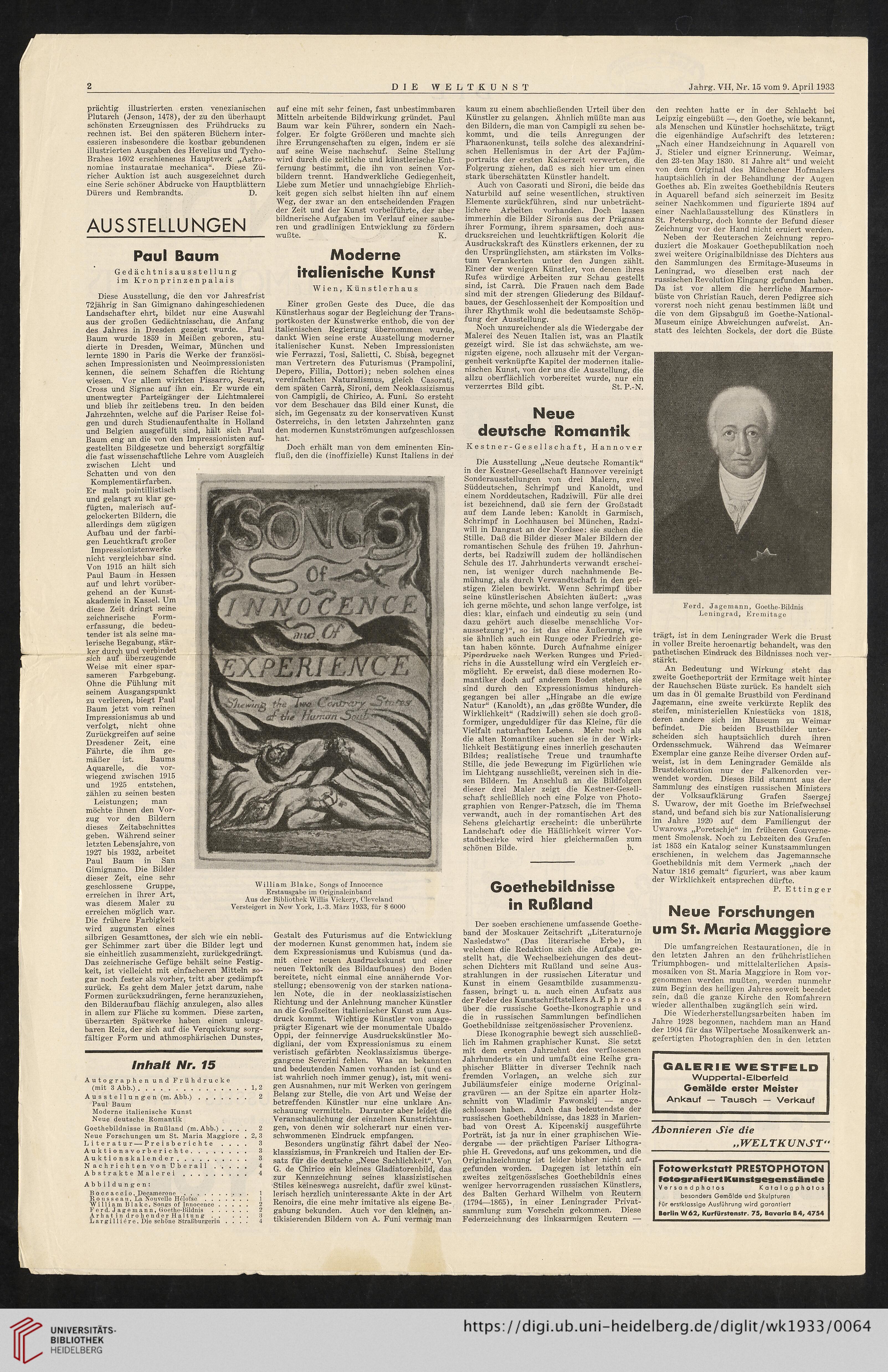2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 15 vom 9. April 1933
prächtig illustrierten ersten venezianischen
Plutarch (Jenson, 1478), der zu den überhaupt
schönsten Erzeugnissen des Frühdrucks zu
rechnen ist. Bei den späteren Büchern inter-
essieren insbesondere die kostbar gebundenen
illustrierten Ausgaben des Hevelius und Tycho-
Brahes 1602 erschienenes Hauptwerk „Astro-
nomiae instauratae mechanica“. Diese Zü-
richer Auktion ist auch ausgezeichnet durch
eine Serie schöner Abdrucke von Hauptblättern
Dürers und Rembrandts. D.
AUSSTELLUNGEN
auf eine mit sehr feinen, fast unbestimmbaren
Mitteln arbeitende Bildwirkung gründet. Paul
Baum war kein Führer, sondern ein Nach-
folger. Er folgte Größeren und machte sich
ihre Errungenschaften zu eigen, indem er sie
auf seine Weise nachschuf. Seine Stellung
wird durch die zeitliche und künstlerische Ent-
fernung bestimmt, die ihn von seinen Vor-
bildern trennt. Handwerkliche Gediegenheit,
Liebe zum Metier und unnachgiebige Ehrlich-
keit gegen sich selbst hielten ihn auf einem
Weg, der zwar an den entscheidenden Fragen
der Zeit und der Kunst vorbeiführte, der aber
bildnerische Aufgaben im Verlauf einer saube-
ren und gradlinigen Entwicklung zu fördern
wußte. K.
Paul Baum
Gedächtnisausstellung
im Kronprinzenpalais
Diese Ausstellung, die den vor Jahresfrist
72jährig in San Gimignano dahingeschiedenen
Landschafter ehrt, bildet nur eine Auswahl
aus der großen Gedächtnisschau, die Anfang
des Jahres in Dresden gezeigt wurde. Paul
Baum wurde 1859 in Meißen geboren, stu-
dierte in Dresden, Weimar, München und
lernte 1890 in Paris die Werke der französi-
schen Impressionisten und Neoimpressionisten
kennen, die seinem Schaffen die Richtung
wiesen. Vor allem wirkten Pissarro, Seurat,
Cross und Signac auf ihn ein. Er wurde ein
unentwegter Parteigänger der Lichtmalerei
und blieb ihr zeitlebens treu. In den beiden
Jahrzehnten, welche auf die Pariser Reise fol-
gen und durch Studienaufenthalte in Holland
und Belgien ausgefüllt sind, hält sich Paul
Baum eng an die von den Impressionisten auf-
gestellten Bildgesetze und beherzigt sorgfältig
die fast wissenschaftliche Lehre vom Ausgleich
Moderne
italienische Kunst
Wien, Künstlerhaus
Einer großen Geste des Duce, die das
Künstlerhaus sogar der Begleichung der Trans-
portkosten der Kunstwerke enthob, die von der
italienischen Regierung übernommen wurde,
dankt Wien seine erste Ausstellung moderner
italienischer Kunst. Neben Impressionisten
wie Ferrazzi, Tosi, Salietti, C. Sbisä, begegnet
man Vertretern des Futurismus (Prampolini,
Depero, Fillia, Dottori); neben solchen eines
vereinfachten Naturalismus, gleich Casorati,
dem späten Carrä, Sironi, dem Neoklassizismus
von Campigli, de Chirico, A. Funi. So ersteht
vor dem Beschauer das Bild einer Kunst, die
sich, im Gegensatz zu der konservativen Kunst
Österreichs, in den letzten Jahrzehnten ganz
den modernen Kunstströmungen aufgeschlossen
hat.
Doch erhält man von dem eminenten Ein-
fluß, den die (inoffizielle) Kunst Italiens in der
zwischen Licht und
Schatten und von den
Komplementärfarben.
Er malt pointillistisch
und gelangt zu klar ge-
fügten, malerisch auf-
gelockerten Bildern, die
allerdings dem zügigen
Aufbau und der farbi-
gen Leuchtkraft großer
Impressionistenwerke
nicht vergleichbar sind.
Von 1915 an hält sich
Paul Baum in Hessen
auf und lehrt vorüber-
gehend an der Kunst-
akademie in Kassel. Um
diese Zeit dringt seine
zeichnerische Form-
erfassung, die bedeu-
tender ist als seine ma-
lerische Begabung, stär-
ker durch und verbindet
sich auf überzeugende
Weise mit einer spar-
sameren Farbgebung.
Ohne die Fühlung mit
seinem Ausgangspunkt
zu verlieren, biegt Paul
Baum jetzt vom reinen
Impressionismus ab und
verfolgt, nicht ohne
Zurückgreifen auf seine
Dresdener Zeit, eine
Fährte, die ihm ge-
mäßer ist. Baums
Aquarelle, die vor-
wiegend zwischen 1915
und 1925 entstehen,
zählen zu seinen besten
Leistungen; man
möchte ihnen den Vor-
zug vor den Bildern
dieses Zeitabschnittes
geben. Während seiner
letzten Lebensjahre, von
1927 bis 1932, arbeitet
Paul Baum in San
Gimignano. Die Bilder
dieser Zeit, eine sehr
geschlossene Gruppe,
erreichen in ihrer Art,
was diesem Maler zu
erreichen möglich war.
Die frühere Farbigkeit
William Blake, Songs of Innocence
Erstausgabe im Originaleinband
Aus der Bibliothek Willis Vickery, Cleveland
Versteigert in New York, 1.-3. März 1933, für $ 6000
wird zugunsten eines
silbrigen Gesamttones, der sich wie ein nebli-
ger Schimmer zart über die Bilder legt und
sie einheitlich zusammenzieht, zurückgedrängt.
Das zeichnerische Gefüge behält seine Festig-
keit, ist vielleicht mit einfacheren Mitteln so-
gar noch fester als vorher, tritt aber gedämpft
zurück. Es geht dem Maler jetzt darum, nahe
Formen zurückzudrängen, ferne heranzuziehen,
den Bilderaufbau flächig anzulegen, also alles
in allem zur Fläche zu kommen. Diese zarten,
überzarten Spätwerke haben einen unleug-
baren Reiz, der sich auf die Verquickung sorg-
fältiger Form und athmosphärischen Dunstes,
Inhalt Nr. 15
Autographen und Frühdrucke
(mit 3 Abb.).1, 2
Ausstellungen (m. Abb.). 2
Paul Baum
Moderne italienische Kunst
Neue deutsche Romantik
Goethebildnisse in Rußland (m. Abb.) .... 2
Neue Forschungen um St. Maria Maggiore . 2, 3
Literatur — Preisberichte . . . . 3
Auktionsvorberichte. 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Nachrichten von Überall. 4
Abstrakte Malerei. 4
Abbildungen:
B o c c a c c i o, Decamerone. 1
Rousseau, La Nouvelle Höloi'se ....... 1
Wi 11 iam B1 ake, Songs of Innocence. 2
Ferd. Jage mann, Goethe-Bildnis. 2
Arhat in drohender Haltung.3
Largilliere, Die schöne Straßburgerin .... 4
Gestalt des Futurismus auf die Entwicklung
der modernen Kunst genommen hat, indem sie
dem Expressionismus und Kubismus (und da-
mit einer neuen Ausdruckskunst und einer
neuen Tektonik des Bildaufbaues) den Boden
bereitete, nicht einmal eine annähernde Vor-
stellung; ebensowenig von der starken nationa-
len Note, die in der neoklassizistischen
Richtung und der Anlehnung mancher Künstler
an die Großzeiten italienischer Kunst zum Aus-
druck kommt. Wichtige Künstler von ausge-
prägter Eigenart wie der monumentale Ubaldo
Oppi, der feinnervige Ausdruckskünstler Mo-
digliani, der vom Expressionismus zu einem
veristisch gefärbten Neoklassizismus überge-
gangene Severini fehlen. Was an bekannten
und bedeutenden Namen vorhanden ist (und es
ist wahrlich noch immer genug), ist, mit weni-
gen Ausnahmen, nur mit Werken von geringem
Belang zur Stelle, die von Art und Weise der
betreffenden Künstler nur eine unklare An-
schauung vermitteln. Darunter aber leidet die
Veranschaulichung der einzelnen Kunstrichtun-
gen, von denen wir solcherart nur einen ver-
schwommenen Eindruck empfangen.
Besonders ungünstig fährt dabei der Neo-
klassizismus, in Frankreich und Italien der Er-
satz für die deutsche „Neue Sachlichkeit“. Von
G. de Chirico ein kleines Gladiatorenbild, das
zur Kennzeichnung seines klassizistischen
Stiles keineswegs ausreicht, dafür zwei künst-
lerisch herzlich uninteressante Akte in der Art
Renoirs, die eine mehr imitative als eigene Be-
gabung bekunden. Auch vor den kleinen, an-
tikisierenden Bildern von A. Funi vermag man
kaum zu einem abschließenden Urteil über den
Künstler zu gelangen. Ähnlich müßte man aus
den Bildern, die man von Campigli zu sehen be-
kommt, und die teils Anregungen der
Pharaonenkunst, teils solche des alexandrini-
schen Hellenismus in der Art der Fajüm-
portraits der ersten Kaiserzeit verwerten, die
Folgerung ziehen, daß es sich hier um einen
stark überschätzten Künstler handelt.
Auch von Casorati und Sironi, die beide das
Naturbild auf seine wesentlichen, struktiven
Elemente zurückführen, sind nur unbeträcht-
lichere Arbeiten vorhanden. Doch lassen
immerhin die Bilder Sironis aus der Prägnanz
ihrer Formung, ihrem sparsamen, doch aus-
drucksreichen und leuchtkräftigen Kolorit die
Ausdruckskraft des Künstlers erkennen, der zu
den Ursprünglichsten, am stärksten im Volks-
tum Verankerten unter den Jungen zählt.
Einer der wenigen Künstler, von denen ihres
Rufes würdige Arbeiten zur Schau gestellt
sind, ist Carrä. Die Frauen nach dem Bade
sind mit der strengen Gliederung des Bildauf-
baues, der Geschlossenheit der Komposition und
ihrer Rhythmik wohl die bedeutsamste Schöp-
fung der Ausstellung.
Noch unzureichender als die Wiedergabe der
Malerei des Neuen Italien ist, was an Plastik
gezeigt wird. Sie ist das schwächste, am we-
nigsten eigene, noch allzusehr mit der Vergan-
genheit verknüpfte Kapitel der modernen italie-
nischen Kunst, von der uns die Ausstellung, die
allzu oberflächlich vorbereitet wurde, nur ein
verzerrtes Bild gibt. St. P.-N.
Neue
deutsche Romantik
Kestner-Gesellschaft, Hannover
Die Ausstellung „Neue deutsche Romantik“
in der Kestner-Gesellschaft Hannover vereinigt
Sonderausstellungen von drei Malern, zwei
Süddeutschen, Schrimpf und Kanoldt, und
einem Norddeutschen, Radziwill. Für alle drei
ist bezeichnend, daß sie fern der Großstadt
auf dem Lande leben: Kanoldt in Garmisch,
Schrimpf in Lochhausen bei München, Radzi-
will in Dangast an der Nordsee: sie suchen die
Stille. Daß die Bilder dieser Maler Bildern der
romantischen Schule des frühen 19. Jahrhun-
derts, bei Radziwill zudem der holländischen
Schule des 17. Jahrhunderts verwandt erschei-
nen, ist weniger durch nachahmende Be-
mühung, als durch Verwandtschaft in den gei-
stigen Zielen bewirkt. Wenn Schrimpf über
seine künstlerischen Absichten äußert: „was
ich gerne möchte, und schon lange verfolge, ist
dies: klar, einfach und eindeutig zu sein (und
dazu gehört auch dieselbe menschliche Vor-
aussetzung)“, so ist das eine Äußerung, wie
sie ähnlich auch ein Runge oder Friedrich ge-
tan haben könnte. Durch Aufnahme einiger
Piperdrucke nach Werken Runges und Fried-
richs in die Ausstellung wird ein Vergleich er-
möglicht. Er erweist, daß diese modernen Ro-
mantiker doch auf anderem Boden stehen, sie
sind durch den Expressionismus hindurch-
gegangen bei aller „Hingabe an die ewige
Natur“ (Kanoldt), an „das größte Wunder, die
Wirklichkeit“ (Radziwill) sehen sie doch groß-
formiger, ungeduldiger für das Kleine, für die
Vielfalt naturhaften Lebens. Mehr noch als
die alten Romantiker suchen sie in der Wirk-
lichkeit Bestätigung eines innerlich geschauten
Bildes; realistische Treue und traumhafte
Stille, die jede Bewegung im Figürlichen wie
im Lichtgang ausschließt, vereinen sich in die-
sen Bildern. Im Anschluß an die Bildfolgen
dieser drei Maler zeigt die Kestner-Gesell-
schaft schließlich noch eine Folge von Photo-
graphien von Renger-Patzsch, die im Thema
verwandt, auch in der romantischen Art des
Sehens gleichartig erscheint: die unberührte
Landschaft oder die Häßlichkeit wirrer Vor-
stadtbezirke wird hier gleichermaßen zum
schönen Bilde. b.
Goethebildnisse
in Rußland
Der soeben erschienene umfassende Goethe-
band der Moskauer Zeitschrift „Literaturnoje
Nasledstwo“ (Das literarische Erbe), in
welchem die Redaktion sich die Aufgabe ge-
stellt hat, die Wechselbeziehungen des deut-
schen Dichters mit Rußland und seine Aus-
strahlungen in der russischen Literatur und
Kunst in einem Gesamtbilde zusammenzu-
fassen, bringt u. a. auch einen Aufsatz aus
der Feder des Kunstschriftstellers A.Ephross
über die russische Goethe-Ikonographie und
die in russischen Sammlungen befindlichen
Goethebildnisse zeitgenössischer Provenienz.
Diese Ikonographie bewegt sich ausschließ-
lich im Rahmen graphischer Kunst. Sie setzt
mit dem ersten Jahrzehnt des verflossenen
Jahrhunderts ein und umfaßt eine Reihe gra-
phischer Blätter in diverser Technik nach
fremden Vorlagen, an welche sich zur
Jubiläumsfeier einige moderne Original-
gravüren — an der Spitze ein aparter Holz-
schnitt von Wladimir Fawonskij — ange-
schlossen haben. Auch das bedeutendste der
russischen Goethebildnisse, das 1823 in Marien-
bad von Orest A. Kipcenskij ausgeführte
Porträt, ist ja nur in einer graphischen Wie-
dergabe •—■ der prächtigen Pariser Lithogra-
phie H. Grevedons, auf uns gekommen, und die
Originalzeichnung ist leider bisher nicht auf-
gefunden worden. Dagegen ist letzthin ein
zweites zeitgenössisches Goethebildnis eines
weniger hervorragenden russischen Künstlers,
des Balten Gerhard Wilhelm von Reutern
(1794—1865), in einer Leningrader Privat-
sammlung zum Vorschein gekommen. Diese
Federzeichnung des linksarmigen Reutern —
den rechten hatte er in der Schlacht bei
Leipzig eingebüßt —, den Goethe, wie bekannt,
als Menschen und Künstler hochschätzte, trägt
die eigenhändige Aufschrift des letzteren:
„Nach einer Handzeichnung in Aquarell von
J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar,
den 23-ten May 1830. 81 Jahre alt“ und weicht
von dem Original des Münchener Hofmalers
hauptsächlich in der Behandlung der Augen
Goethes ab. Ein zweites Goethebildnis Reuters
in Aquarell befand sich seinerzeit im Besitz
seiner Nachkommen und figurierte 1894 auf
einer Nachlaßausstellung des Künstlers in
St. Petersburg, doch konnte der Befund dieser
Zeichnung vor der Hand nicht eruiert werden.
Neben der Reuterschen Zeichnung repro-
duziert die Moskauer Goethepublikation noch
zwei weitere Originalbildnisse des Dichters aus
den Sammlungen des Ermitage-Museums in
Leningrad, wo dieselben erst nach der
russischen Revolution Eingang gefunden haben.
Da ist vor allem die herrliche Marmor-
büste von Christian Rauch, deren Pedigree sich
vorerst noch nicht genau bestimmen läßt und
die von dem Gipsabguß im Goethe-National-
Museum einige Abweichungen aufweist. An-
statt des leichten Sockels, der dort die Büste
Ferd. Jagemann, Goethe-Bildnis
Leningrad, Eremitage
trägt, ist in dem Leningrader Werk die Brust
in voller Breite heroenartig behandelt, was den
pathetischen Eindruck des Bildnisses noch ver-
stärkt.
An Bedeutung und Wirkung steht das
zweite Goetheporträt der Ermitage weit hinter
der Rauchschen Büste zurück. Es handelt sich
um das in Öl gemalte Brustbild von Ferdinand
Jagemann, eine zweite verkürzte Replik des
steifen, ministeriellen Kniestücks von 1818,
deren andere sich im Museum zu Weimar
befindet. Die beiden Brustbilder unter-
scheiden sich hauptsächlich durch ihren
Ordensschmuck. Während das Weimarer
Exemplar eine ganze Reihe diverser Orden auf-
weist, ist in dem Leningrader Gemälde als
Brustdekoration nur der Falkenorden ver-
wendet worden. Dieses Bild stammt aus der
Sammlung des einstigen russischen Ministers
der Volksaufklärung Grafen Ssergej
S. Uwarow, der mit Goethe im Briefwechsel
stand, und befand sich bis zur Nationalisierung
im Jahre 1920 auf dem Familiengut der
Uwarows „Poretschje“ im früheren Gouverne-
ment Smolensk. Noch zu Lebzeiten des Grafen
ist 1853 ein Katalog seiner Kunstsammlungen
erschienen, in welchem das Jagemannsche
Goethebildnis mit dem Vermerk „nach der
Natur 1816 gemalt“ figuriert, was aber kaum
der Wirklichkeit entsprechen dürfte.
P. Ettinger
Neue Forschungen
um St. Maria Maggiore
Die umfangreichen Restaurationen, die in
den letzten Jahren an den frühchristlichen
Triumphbogen- und mittelalterlichen Apsis-
mosaiken von St. Maria Maggiore in Rom vor-
genommen werden mußten, werden nunmehr
zum Beginn des heiligen Jahres soweit beendet
sein, daß die ganze Kirche den Romfahrern
wieder allenthalben zugänglich sein wird.
Die Wiederherstellungsarbeiten haben im
Jahre 1928 begonnen, nachdem man an Hand
der 1904 für das Wilpertsche Mosaikenwerk an-
gefertigten Photographien den in den letzten
GALERIE WESTFELD
Wuppertal-Elberfeld
Gemälde erster Meister
Ankauf — Tausch — Verkauf
Abonnieren Sie die
„WELTKUNST11
Fotowerkstatt PRESTOPHOTON
fotografiert Kunstgegenstände
Versandphotos Katalogphotos
besonders Gemälde und Skulpturen
Für erstklassige Ausführung wird garantiert
Berlin W62, Kurfürstenstr. 75, Bavaria B4, 4754
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 15 vom 9. April 1933
prächtig illustrierten ersten venezianischen
Plutarch (Jenson, 1478), der zu den überhaupt
schönsten Erzeugnissen des Frühdrucks zu
rechnen ist. Bei den späteren Büchern inter-
essieren insbesondere die kostbar gebundenen
illustrierten Ausgaben des Hevelius und Tycho-
Brahes 1602 erschienenes Hauptwerk „Astro-
nomiae instauratae mechanica“. Diese Zü-
richer Auktion ist auch ausgezeichnet durch
eine Serie schöner Abdrucke von Hauptblättern
Dürers und Rembrandts. D.
AUSSTELLUNGEN
auf eine mit sehr feinen, fast unbestimmbaren
Mitteln arbeitende Bildwirkung gründet. Paul
Baum war kein Führer, sondern ein Nach-
folger. Er folgte Größeren und machte sich
ihre Errungenschaften zu eigen, indem er sie
auf seine Weise nachschuf. Seine Stellung
wird durch die zeitliche und künstlerische Ent-
fernung bestimmt, die ihn von seinen Vor-
bildern trennt. Handwerkliche Gediegenheit,
Liebe zum Metier und unnachgiebige Ehrlich-
keit gegen sich selbst hielten ihn auf einem
Weg, der zwar an den entscheidenden Fragen
der Zeit und der Kunst vorbeiführte, der aber
bildnerische Aufgaben im Verlauf einer saube-
ren und gradlinigen Entwicklung zu fördern
wußte. K.
Paul Baum
Gedächtnisausstellung
im Kronprinzenpalais
Diese Ausstellung, die den vor Jahresfrist
72jährig in San Gimignano dahingeschiedenen
Landschafter ehrt, bildet nur eine Auswahl
aus der großen Gedächtnisschau, die Anfang
des Jahres in Dresden gezeigt wurde. Paul
Baum wurde 1859 in Meißen geboren, stu-
dierte in Dresden, Weimar, München und
lernte 1890 in Paris die Werke der französi-
schen Impressionisten und Neoimpressionisten
kennen, die seinem Schaffen die Richtung
wiesen. Vor allem wirkten Pissarro, Seurat,
Cross und Signac auf ihn ein. Er wurde ein
unentwegter Parteigänger der Lichtmalerei
und blieb ihr zeitlebens treu. In den beiden
Jahrzehnten, welche auf die Pariser Reise fol-
gen und durch Studienaufenthalte in Holland
und Belgien ausgefüllt sind, hält sich Paul
Baum eng an die von den Impressionisten auf-
gestellten Bildgesetze und beherzigt sorgfältig
die fast wissenschaftliche Lehre vom Ausgleich
Moderne
italienische Kunst
Wien, Künstlerhaus
Einer großen Geste des Duce, die das
Künstlerhaus sogar der Begleichung der Trans-
portkosten der Kunstwerke enthob, die von der
italienischen Regierung übernommen wurde,
dankt Wien seine erste Ausstellung moderner
italienischer Kunst. Neben Impressionisten
wie Ferrazzi, Tosi, Salietti, C. Sbisä, begegnet
man Vertretern des Futurismus (Prampolini,
Depero, Fillia, Dottori); neben solchen eines
vereinfachten Naturalismus, gleich Casorati,
dem späten Carrä, Sironi, dem Neoklassizismus
von Campigli, de Chirico, A. Funi. So ersteht
vor dem Beschauer das Bild einer Kunst, die
sich, im Gegensatz zu der konservativen Kunst
Österreichs, in den letzten Jahrzehnten ganz
den modernen Kunstströmungen aufgeschlossen
hat.
Doch erhält man von dem eminenten Ein-
fluß, den die (inoffizielle) Kunst Italiens in der
zwischen Licht und
Schatten und von den
Komplementärfarben.
Er malt pointillistisch
und gelangt zu klar ge-
fügten, malerisch auf-
gelockerten Bildern, die
allerdings dem zügigen
Aufbau und der farbi-
gen Leuchtkraft großer
Impressionistenwerke
nicht vergleichbar sind.
Von 1915 an hält sich
Paul Baum in Hessen
auf und lehrt vorüber-
gehend an der Kunst-
akademie in Kassel. Um
diese Zeit dringt seine
zeichnerische Form-
erfassung, die bedeu-
tender ist als seine ma-
lerische Begabung, stär-
ker durch und verbindet
sich auf überzeugende
Weise mit einer spar-
sameren Farbgebung.
Ohne die Fühlung mit
seinem Ausgangspunkt
zu verlieren, biegt Paul
Baum jetzt vom reinen
Impressionismus ab und
verfolgt, nicht ohne
Zurückgreifen auf seine
Dresdener Zeit, eine
Fährte, die ihm ge-
mäßer ist. Baums
Aquarelle, die vor-
wiegend zwischen 1915
und 1925 entstehen,
zählen zu seinen besten
Leistungen; man
möchte ihnen den Vor-
zug vor den Bildern
dieses Zeitabschnittes
geben. Während seiner
letzten Lebensjahre, von
1927 bis 1932, arbeitet
Paul Baum in San
Gimignano. Die Bilder
dieser Zeit, eine sehr
geschlossene Gruppe,
erreichen in ihrer Art,
was diesem Maler zu
erreichen möglich war.
Die frühere Farbigkeit
William Blake, Songs of Innocence
Erstausgabe im Originaleinband
Aus der Bibliothek Willis Vickery, Cleveland
Versteigert in New York, 1.-3. März 1933, für $ 6000
wird zugunsten eines
silbrigen Gesamttones, der sich wie ein nebli-
ger Schimmer zart über die Bilder legt und
sie einheitlich zusammenzieht, zurückgedrängt.
Das zeichnerische Gefüge behält seine Festig-
keit, ist vielleicht mit einfacheren Mitteln so-
gar noch fester als vorher, tritt aber gedämpft
zurück. Es geht dem Maler jetzt darum, nahe
Formen zurückzudrängen, ferne heranzuziehen,
den Bilderaufbau flächig anzulegen, also alles
in allem zur Fläche zu kommen. Diese zarten,
überzarten Spätwerke haben einen unleug-
baren Reiz, der sich auf die Verquickung sorg-
fältiger Form und athmosphärischen Dunstes,
Inhalt Nr. 15
Autographen und Frühdrucke
(mit 3 Abb.).1, 2
Ausstellungen (m. Abb.). 2
Paul Baum
Moderne italienische Kunst
Neue deutsche Romantik
Goethebildnisse in Rußland (m. Abb.) .... 2
Neue Forschungen um St. Maria Maggiore . 2, 3
Literatur — Preisberichte . . . . 3
Auktionsvorberichte. 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Nachrichten von Überall. 4
Abstrakte Malerei. 4
Abbildungen:
B o c c a c c i o, Decamerone. 1
Rousseau, La Nouvelle Höloi'se ....... 1
Wi 11 iam B1 ake, Songs of Innocence. 2
Ferd. Jage mann, Goethe-Bildnis. 2
Arhat in drohender Haltung.3
Largilliere, Die schöne Straßburgerin .... 4
Gestalt des Futurismus auf die Entwicklung
der modernen Kunst genommen hat, indem sie
dem Expressionismus und Kubismus (und da-
mit einer neuen Ausdruckskunst und einer
neuen Tektonik des Bildaufbaues) den Boden
bereitete, nicht einmal eine annähernde Vor-
stellung; ebensowenig von der starken nationa-
len Note, die in der neoklassizistischen
Richtung und der Anlehnung mancher Künstler
an die Großzeiten italienischer Kunst zum Aus-
druck kommt. Wichtige Künstler von ausge-
prägter Eigenart wie der monumentale Ubaldo
Oppi, der feinnervige Ausdruckskünstler Mo-
digliani, der vom Expressionismus zu einem
veristisch gefärbten Neoklassizismus überge-
gangene Severini fehlen. Was an bekannten
und bedeutenden Namen vorhanden ist (und es
ist wahrlich noch immer genug), ist, mit weni-
gen Ausnahmen, nur mit Werken von geringem
Belang zur Stelle, die von Art und Weise der
betreffenden Künstler nur eine unklare An-
schauung vermitteln. Darunter aber leidet die
Veranschaulichung der einzelnen Kunstrichtun-
gen, von denen wir solcherart nur einen ver-
schwommenen Eindruck empfangen.
Besonders ungünstig fährt dabei der Neo-
klassizismus, in Frankreich und Italien der Er-
satz für die deutsche „Neue Sachlichkeit“. Von
G. de Chirico ein kleines Gladiatorenbild, das
zur Kennzeichnung seines klassizistischen
Stiles keineswegs ausreicht, dafür zwei künst-
lerisch herzlich uninteressante Akte in der Art
Renoirs, die eine mehr imitative als eigene Be-
gabung bekunden. Auch vor den kleinen, an-
tikisierenden Bildern von A. Funi vermag man
kaum zu einem abschließenden Urteil über den
Künstler zu gelangen. Ähnlich müßte man aus
den Bildern, die man von Campigli zu sehen be-
kommt, und die teils Anregungen der
Pharaonenkunst, teils solche des alexandrini-
schen Hellenismus in der Art der Fajüm-
portraits der ersten Kaiserzeit verwerten, die
Folgerung ziehen, daß es sich hier um einen
stark überschätzten Künstler handelt.
Auch von Casorati und Sironi, die beide das
Naturbild auf seine wesentlichen, struktiven
Elemente zurückführen, sind nur unbeträcht-
lichere Arbeiten vorhanden. Doch lassen
immerhin die Bilder Sironis aus der Prägnanz
ihrer Formung, ihrem sparsamen, doch aus-
drucksreichen und leuchtkräftigen Kolorit die
Ausdruckskraft des Künstlers erkennen, der zu
den Ursprünglichsten, am stärksten im Volks-
tum Verankerten unter den Jungen zählt.
Einer der wenigen Künstler, von denen ihres
Rufes würdige Arbeiten zur Schau gestellt
sind, ist Carrä. Die Frauen nach dem Bade
sind mit der strengen Gliederung des Bildauf-
baues, der Geschlossenheit der Komposition und
ihrer Rhythmik wohl die bedeutsamste Schöp-
fung der Ausstellung.
Noch unzureichender als die Wiedergabe der
Malerei des Neuen Italien ist, was an Plastik
gezeigt wird. Sie ist das schwächste, am we-
nigsten eigene, noch allzusehr mit der Vergan-
genheit verknüpfte Kapitel der modernen italie-
nischen Kunst, von der uns die Ausstellung, die
allzu oberflächlich vorbereitet wurde, nur ein
verzerrtes Bild gibt. St. P.-N.
Neue
deutsche Romantik
Kestner-Gesellschaft, Hannover
Die Ausstellung „Neue deutsche Romantik“
in der Kestner-Gesellschaft Hannover vereinigt
Sonderausstellungen von drei Malern, zwei
Süddeutschen, Schrimpf und Kanoldt, und
einem Norddeutschen, Radziwill. Für alle drei
ist bezeichnend, daß sie fern der Großstadt
auf dem Lande leben: Kanoldt in Garmisch,
Schrimpf in Lochhausen bei München, Radzi-
will in Dangast an der Nordsee: sie suchen die
Stille. Daß die Bilder dieser Maler Bildern der
romantischen Schule des frühen 19. Jahrhun-
derts, bei Radziwill zudem der holländischen
Schule des 17. Jahrhunderts verwandt erschei-
nen, ist weniger durch nachahmende Be-
mühung, als durch Verwandtschaft in den gei-
stigen Zielen bewirkt. Wenn Schrimpf über
seine künstlerischen Absichten äußert: „was
ich gerne möchte, und schon lange verfolge, ist
dies: klar, einfach und eindeutig zu sein (und
dazu gehört auch dieselbe menschliche Vor-
aussetzung)“, so ist das eine Äußerung, wie
sie ähnlich auch ein Runge oder Friedrich ge-
tan haben könnte. Durch Aufnahme einiger
Piperdrucke nach Werken Runges und Fried-
richs in die Ausstellung wird ein Vergleich er-
möglicht. Er erweist, daß diese modernen Ro-
mantiker doch auf anderem Boden stehen, sie
sind durch den Expressionismus hindurch-
gegangen bei aller „Hingabe an die ewige
Natur“ (Kanoldt), an „das größte Wunder, die
Wirklichkeit“ (Radziwill) sehen sie doch groß-
formiger, ungeduldiger für das Kleine, für die
Vielfalt naturhaften Lebens. Mehr noch als
die alten Romantiker suchen sie in der Wirk-
lichkeit Bestätigung eines innerlich geschauten
Bildes; realistische Treue und traumhafte
Stille, die jede Bewegung im Figürlichen wie
im Lichtgang ausschließt, vereinen sich in die-
sen Bildern. Im Anschluß an die Bildfolgen
dieser drei Maler zeigt die Kestner-Gesell-
schaft schließlich noch eine Folge von Photo-
graphien von Renger-Patzsch, die im Thema
verwandt, auch in der romantischen Art des
Sehens gleichartig erscheint: die unberührte
Landschaft oder die Häßlichkeit wirrer Vor-
stadtbezirke wird hier gleichermaßen zum
schönen Bilde. b.
Goethebildnisse
in Rußland
Der soeben erschienene umfassende Goethe-
band der Moskauer Zeitschrift „Literaturnoje
Nasledstwo“ (Das literarische Erbe), in
welchem die Redaktion sich die Aufgabe ge-
stellt hat, die Wechselbeziehungen des deut-
schen Dichters mit Rußland und seine Aus-
strahlungen in der russischen Literatur und
Kunst in einem Gesamtbilde zusammenzu-
fassen, bringt u. a. auch einen Aufsatz aus
der Feder des Kunstschriftstellers A.Ephross
über die russische Goethe-Ikonographie und
die in russischen Sammlungen befindlichen
Goethebildnisse zeitgenössischer Provenienz.
Diese Ikonographie bewegt sich ausschließ-
lich im Rahmen graphischer Kunst. Sie setzt
mit dem ersten Jahrzehnt des verflossenen
Jahrhunderts ein und umfaßt eine Reihe gra-
phischer Blätter in diverser Technik nach
fremden Vorlagen, an welche sich zur
Jubiläumsfeier einige moderne Original-
gravüren — an der Spitze ein aparter Holz-
schnitt von Wladimir Fawonskij — ange-
schlossen haben. Auch das bedeutendste der
russischen Goethebildnisse, das 1823 in Marien-
bad von Orest A. Kipcenskij ausgeführte
Porträt, ist ja nur in einer graphischen Wie-
dergabe •—■ der prächtigen Pariser Lithogra-
phie H. Grevedons, auf uns gekommen, und die
Originalzeichnung ist leider bisher nicht auf-
gefunden worden. Dagegen ist letzthin ein
zweites zeitgenössisches Goethebildnis eines
weniger hervorragenden russischen Künstlers,
des Balten Gerhard Wilhelm von Reutern
(1794—1865), in einer Leningrader Privat-
sammlung zum Vorschein gekommen. Diese
Federzeichnung des linksarmigen Reutern —
den rechten hatte er in der Schlacht bei
Leipzig eingebüßt —, den Goethe, wie bekannt,
als Menschen und Künstler hochschätzte, trägt
die eigenhändige Aufschrift des letzteren:
„Nach einer Handzeichnung in Aquarell von
J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar,
den 23-ten May 1830. 81 Jahre alt“ und weicht
von dem Original des Münchener Hofmalers
hauptsächlich in der Behandlung der Augen
Goethes ab. Ein zweites Goethebildnis Reuters
in Aquarell befand sich seinerzeit im Besitz
seiner Nachkommen und figurierte 1894 auf
einer Nachlaßausstellung des Künstlers in
St. Petersburg, doch konnte der Befund dieser
Zeichnung vor der Hand nicht eruiert werden.
Neben der Reuterschen Zeichnung repro-
duziert die Moskauer Goethepublikation noch
zwei weitere Originalbildnisse des Dichters aus
den Sammlungen des Ermitage-Museums in
Leningrad, wo dieselben erst nach der
russischen Revolution Eingang gefunden haben.
Da ist vor allem die herrliche Marmor-
büste von Christian Rauch, deren Pedigree sich
vorerst noch nicht genau bestimmen läßt und
die von dem Gipsabguß im Goethe-National-
Museum einige Abweichungen aufweist. An-
statt des leichten Sockels, der dort die Büste
Ferd. Jagemann, Goethe-Bildnis
Leningrad, Eremitage
trägt, ist in dem Leningrader Werk die Brust
in voller Breite heroenartig behandelt, was den
pathetischen Eindruck des Bildnisses noch ver-
stärkt.
An Bedeutung und Wirkung steht das
zweite Goetheporträt der Ermitage weit hinter
der Rauchschen Büste zurück. Es handelt sich
um das in Öl gemalte Brustbild von Ferdinand
Jagemann, eine zweite verkürzte Replik des
steifen, ministeriellen Kniestücks von 1818,
deren andere sich im Museum zu Weimar
befindet. Die beiden Brustbilder unter-
scheiden sich hauptsächlich durch ihren
Ordensschmuck. Während das Weimarer
Exemplar eine ganze Reihe diverser Orden auf-
weist, ist in dem Leningrader Gemälde als
Brustdekoration nur der Falkenorden ver-
wendet worden. Dieses Bild stammt aus der
Sammlung des einstigen russischen Ministers
der Volksaufklärung Grafen Ssergej
S. Uwarow, der mit Goethe im Briefwechsel
stand, und befand sich bis zur Nationalisierung
im Jahre 1920 auf dem Familiengut der
Uwarows „Poretschje“ im früheren Gouverne-
ment Smolensk. Noch zu Lebzeiten des Grafen
ist 1853 ein Katalog seiner Kunstsammlungen
erschienen, in welchem das Jagemannsche
Goethebildnis mit dem Vermerk „nach der
Natur 1816 gemalt“ figuriert, was aber kaum
der Wirklichkeit entsprechen dürfte.
P. Ettinger
Neue Forschungen
um St. Maria Maggiore
Die umfangreichen Restaurationen, die in
den letzten Jahren an den frühchristlichen
Triumphbogen- und mittelalterlichen Apsis-
mosaiken von St. Maria Maggiore in Rom vor-
genommen werden mußten, werden nunmehr
zum Beginn des heiligen Jahres soweit beendet
sein, daß die ganze Kirche den Romfahrern
wieder allenthalben zugänglich sein wird.
Die Wiederherstellungsarbeiten haben im
Jahre 1928 begonnen, nachdem man an Hand
der 1904 für das Wilpertsche Mosaikenwerk an-
gefertigten Photographien den in den letzten
GALERIE WESTFELD
Wuppertal-Elberfeld
Gemälde erster Meister
Ankauf — Tausch — Verkauf
Abonnieren Sie die
„WELTKUNST11
Fotowerkstatt PRESTOPHOTON
fotografiert Kunstgegenstände
Versandphotos Katalogphotos
besonders Gemälde und Skulpturen
Für erstklassige Ausführung wird garantiert
Berlin W62, Kurfürstenstr. 75, Bavaria B4, 4754