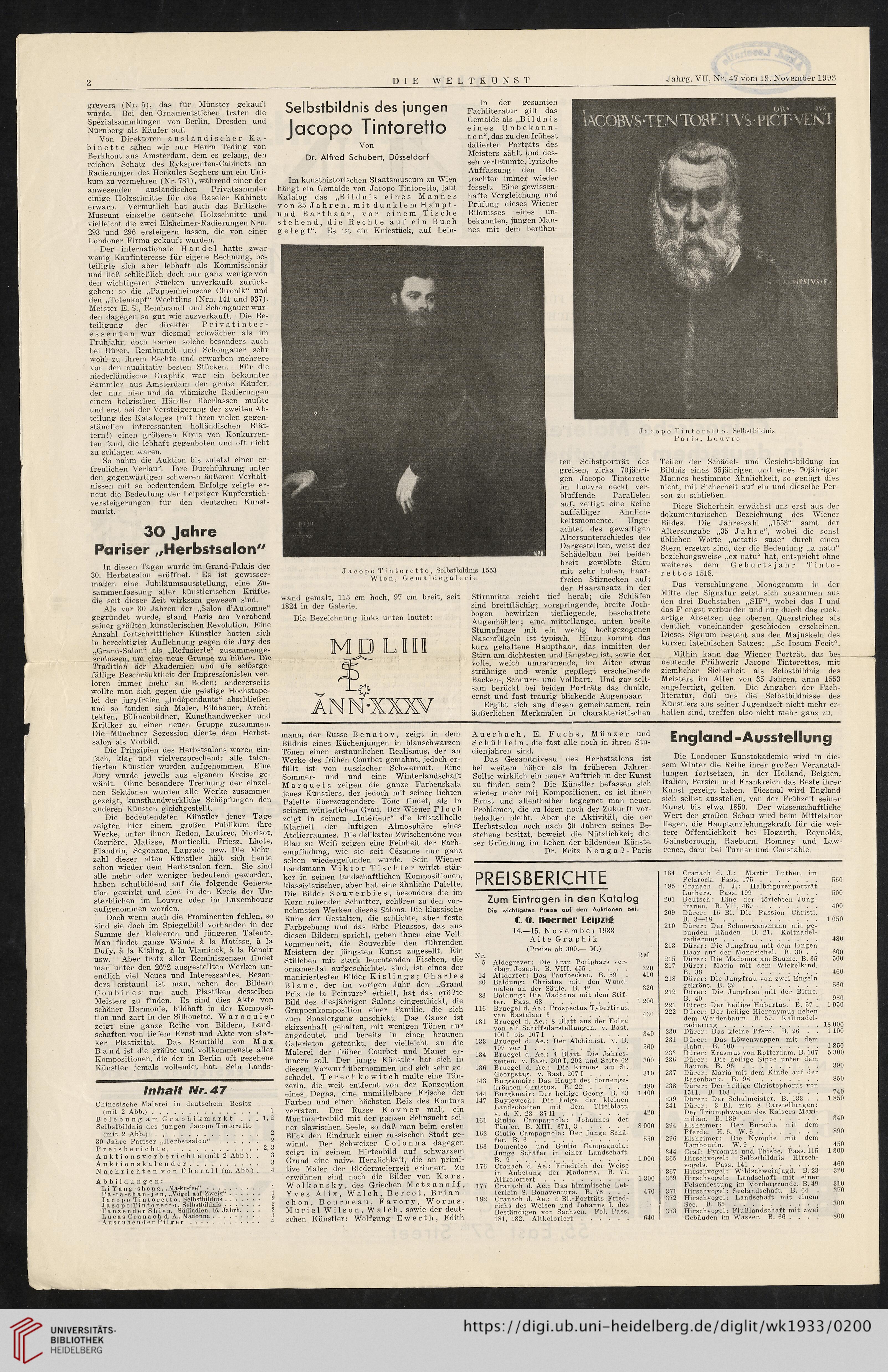2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993
grevers (Nr. 5), das für Münster gekauft
wurde. Bei den Ornamentstichen traten die
Spezialsammlungen von Berlin, Dresden und
Nürnberg als Käufer auf.
Von Direktoren ausländischer Ka-
binette sahen wir nur Herrn Teding van
Berkhout aus Amsterdam, dem es gelang, den
reichen Schatz des Ryksprenten-Cabinets an
Radierungen des Herkules Seghers um ein Uni-
kum zu vermehren (Nr. 781), während einer der
anwesenden ausländischen Privatsammler
einige Holzschnitte für das Baseler Kabinett
erwarb. Vermutlich hat auch das Britische
Museum einzelne deutsche Holzschnitte und
vielleicht die zwei Elsheimer-Radierungen Nrn.
293 und 296 ersteigern lassen, die von einer
Londoner Firma gekauft wurden.
Der internationale Handel hatte zwar
wenig Kaufinteresse für eigene Rechnung, be-
teiligte sich aber lebhaft als Kommissionär
und ließ schließlich doch nur ganz wenige von
den wichtigeren Stücken unverkauft zurück-
gehen: so die „Pappenheimsche Chronik“ und
den „Totenkopf“ Wechtlins (Nrn. 141 und 937).
Meister E. S., Rembrandt und Schongauer wur-
den dagegen so gut wie ausverkauft. Die Be-
teiligung der direkten Privatinter-
essenten war diesmal schwächer als im
Frühjahr, doch kamen solche besonders auch
bei Dürer, Rembrandt und Schongauer sehr
wohl zu ihrem Rechte und erwarben mehrere
von den qualitativ besten Stücken. Für die
niederländische Graphik war ein bekannter
Sammler aus Amsterdam der große Käufer,
der nur hier und da vlämische Radierungen
einem belgischen Händler überlassen mußte
und erst bei der Versteigerung der zweiten Ab-
teilung des Kataloges (mit ihren vielen gegen-
ständlich interessanten holländischen Blät-
tern!) einen größeren Kreis von Konkurren-
ten fand, die lebhaft gegenboten und oft nicht
zu schlagen waren.
So nahm die Auktion bis zuletzt einen er-
freulichen Verlauf. Ihre Durchführung unter
den gegenwärtigen schweren äußeren Verhält-
nissen mit so bedeutendem Erfolge zeigte er-
neut die Bedeutung der Leipziger Kupferstich-
versteigerungen für den deutschen Kunst-
markt.
30 Jahre
Pariser „Herbstsalon77
In diesen Tagen wurde im Grand-Palais der
30. Herbstsalon eröffnet. Es ist gewisser-
maßen eine Jubiläumsausstellung, eine Zu-
sammenfassung aller künstlerischen Kräfte,
die seit dieser Zeit wirksam gewesen sind.
Als vor 30 Jahren der „Salon d’Automne“
gegründet wurde, stand Paris am Vorabend
seiner größten künstlerischen Revolution. Eine
Anzahl fortschrittlicher Künstler hatten sich
in berechtigter Auflehnung gegen die Jury des
„Grand-Salon“ als „Refüsierte“ zusammenge-
schlossen, um eine neue Gruppe zu bilden. Die
Tradition der Akademien und die selbstge-
fällige Beschränktheit der Impressionisten ver-
loren immer mehr an Boden; andererseits
wollte man sich gegen die geistige Hochstape-
lei der juryfreien „Independants“ abschließen
und so fanden sich Maler, Bildhauer, Archi-
tekten, Bühnenbildner, Kunsthandwerker und
Kritiker zu einer neuen Gruppe zusammen.
Die Münchner Sezession diente dem Herbst-
salon als Vorbild.
Die Prinzipien des Herbstsalons waren ein-
fach, klar und vielversprechend: alle talen-
tierten Künstler wurden aufgenommen. Eine
Jury wurde jeweils aus eigenem Kreise ge-
wählt. Ohne besondere Trennung der einzel-
nen Sektionen wurden alle Werke zusammen
gezeigt, kunsthandwerkliche Schöpfungen den
anderen Künsten gleichgestellt.
Die bedeutendsten Künstler jener Tage
zeigten hier einem großen Publikum ihre
Werke, unter ihnen Redon, Lautrec, Morisot,
Carriere, Matisse, Monticelli, Friesz, Lhote,
Flandrin, Segonzac, Laprade usw. Die Mehr-
zahl dieser alten Künstler hält sich heute
schon wieder dem Herbstsalon fern. Sie sind
alle mehr oder weniger bedeutend geworden,
haben schulbildend auf die folgende Genera-
tion gewirkt und sind in den Kreis der Un-
sterblichen im Louvre oder im Luxembourg
aufgenommen worden.
Doch wenn auch die Prominenten fehlen, so
sind sie doch im Spiegelbild vorhanden in der
Summe der kleineren und jüngeren Talente.
Man findet ganze Wände ä la Matisse, ä la
Dufy, ä la Kisling, a la Vlaminck, ä la Renoir
usw. Aber trotz aller Reminiszenzen findet
man unter den 2672 ausgestellten Werken un-
endlich viel Neues und interessantes. Beson-
ders erstaunt ist man, neben den Bildern
C o u b i n e s nun auch Plastiken desselben
Meisters zu finden. Es sind dies Akte von
schöner Harmonie, bildhaft in der Komposi-
tion und zart in der Silhouette. Waroquier
zeigt eine ganze Reihe von Bildern, Land-
schaften von tiefem Ernst und Akte von star-
ker Plastizität. Das Brautbild von Max
Band ist die größte und vollkommenste aller
Kompositionen, die der in Berlin oft gesehene
Künstler jemals vollendet hat. Sein Lands-
Inhalt Nr. 47
Chinesische Malerei in deutschem Besitz
(mit 2 Abb.). 1
Belebungam Graphikmarkt . . . 1,2
Selbstbildnis des jungen Jacopo Tintoretto
(mit 2 Abb.). 2
30 Jahre Pariser „Herbstsalon1* . 2
Preisberichte.2,3
Auktionsvorberichte (mit 2 Abb.). . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Nachrichten von Überall (m. Abb.) . 4
Abbildungen:
Li Yang-sheng, „Ma-ku-fee“. 1
Pa-ta-shan-jen, „Vögel auf Zweig“. 1
Jacopo Tintoretto. Selbstbildnis ....... 2
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis. 2
Tanzender Shiva. Siidindien, 16. Jahrh. ... 2
Lucas Cranach d. A.. Madonna. 3
Ausruhender Pilger. 4
Im kunsthistorischen Staatsmuseum zu Wien
hängt ein Gemälde von Jacopo Tintoretto, laut
Katalog das „Bildnis eines Mannes
von 35 Jahren, mit dunklem Haupt-
und Barthaar, vor einem Tische
stehend, die Rechte auf ein Buch
g e 1 e g t“. Es ist ein Kniestück, auf Lein-
In der gesamten
Fachliteratur gilt das
Gemälde als „Bildnis
eines Unbekann-
ten“, das zu den frühest
datierten Porträts des
Meisters zählt und des-
sen verträumte, lyrische
Auffassung den Be-
trachter immer wieder
fesselt. Eine gewissen-
hafte Vergleichung und
Prüfung dieses Wiener
Bildnisses eines un-
bekannten, jungen Man-
nes mit dem berühm-
Selbstbildnis des jungen
Jacopo Tintoretto
Von
Dr. Alfred Schubert, Düsseldorf
Selbstporträt des
dieselbe Per-
erst aus der
des Wiener
samt der
Tintoretto
deckt ver-
Parallelen
eine Reihe
Ähnlich-
Unge-
wand gemalt, 115 cm hoch, 97 cm breit, seit
1824 in der Galerie.
Die Bezeichnung links unten lautet:
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis 1553
Wien, Gemäldegalerie
ten
greisen, zirka 70jähri-
gen Jacopo
im Louvre
blüffende
auf, zeitigt
auffälliger
keitsmomente.
achtet des gewaltigen
Altersunterschiedes des
Dargestellten, weist der
J Schädelbau bei beiden
breit gewölbte Stirn
mit sehr hohen, haar-
freien Stirnecken auf;
der Haaransatz in der
tief herab; die Schläfen
vorspringende, breite Joch-
tiefliegende, beschattete
Stirnmitte reicht
sind breitflächig;
bogen bewirken
Augenhöhlen; eine mittellange, unten breite
Stumpfnase mit ein wenig hochgezogenen
Nasenflügeln ist typisch. Hinzu kommt das
kurz gehaltene Haupthaar, das inmitten der
Stirn am dichtesten und längsten ist, sowie der
volle, weich umrahmende, im Alter etwas
strähnige und wenig gepflegt erscheinende
Backen-, Schnurr- und Vollbart. Und gar selt-
sam berückt bei beiden Porträts das dunkle,
ernst und fast traurig blickende Augenpaar.
Ergibt sich aus diesen gemeinsamen, rein
äußerlichen Merkmalen in charakteristischen
Teilen der Schädel- und Gesichtsbildung im
Bildnis eines 35jährigen und eines 70jährigen
Mannes bestimmte Ähnlichkeit, so genügt dies
nicht, mit Sicherheit auf ein und " " ~
son zu schließen.
Diese Sicherheit erwächst uns
dokumentarischen Bezeichnung
Bildes. Die Jahreszahl „1553“
Altersangabe „35 Jahr e“, wobei die sonst
üblichen Worte „aetatis suae“ durch einen
Stern ersetzt sind, der die Bedeutung „a natu“
beziehungsweise „ex natu“ hat, entspricht ohne
weiteres dem Geburtsjahr Tinto-
retto s 1518.
Das verschlungene Monogramm in der
Mitte der Signatur setzt sich zusammen aus
den drei Buchstaben „SIF“, wobei das I und
das F engst verbunden und nur durch das ruck-
artige Absetzen des oberen Querstriches als
deutlich voneinander geschieden erscheinen.
Dieses Signum besteht aus den Majuskeln des
kurzen lateinischen Satzes: „Se Ipsum Fecit“.
Mithin kann das Wiener Porträt, das be-
deutende Frühwerk Jacopo Tintorettos, mit
ziemlicher Sicherheit als Selbstbildnis des
Meisters im Alter von 35 Jahren-, anno 1553
angefertigt, gelten. Die Angaben der Fach-
literatur, daß uns die Selbstbildnisse des
Künstlers aus seiner Jugendzeit nicht mein- er-
halten sind, treffen also nicht mehr ganz zu.
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis
Paris, Louvre
1PSIVSW-
5 OK* 1VS
IACOBV8-TENTORE1 'VS- P1CTVEN1
mann, der Russe B e n a t o v , zeigt in dem
Bildnis eines Küchenjungen in blauschwarzen
Tönen einen erstaunlichen Realismus, der an
Werke des frühen Courbet gemahnt, jedoch er-
füllt ist von russischer Schwermut. Eine
Sommer- und und eine Winterlandschaft
Marquets zeigen die ganze Farbenskala
jenes Künstlers, der jedoch mit seiner lichten
Palette überzeugendere Töne findet, als in
seinem winterlichen Grau. Der Wiener F1 o c h
zeigt in seinem „Interieur“ die kristallhelle
Klarheit der luftigen Atmosphäre eines
Atelierraumes. Die delikaten Zwischentöne von
Blau zu Weiß zeigen eine Feinheit der Farb-
empfindung, wie sie seit Cezanne nur ganz
selten wiedergefunden wurde. Sein Wiener
Landsmann Viktor Tischler wirkt stär-
ker in seinen landschaftlichen Kompositionen,
klassizistischer, aber hat eine ähnliche Palette.
Die Bilder Souverbies, besonders die im
Korn ruhenden Schnitter, gehören zu den vor-
nehmsten Werken dieses Salons. Die klassische
Ruhe der Gestalten, die schlichte, aber feste
Farbgebung und das Erbe Picassos, das aus
diesen Bildern spricht, geben ihnen eine Voll-
kommenheit, die Souverbie den führenden
Meistern der jüngsten Kunst zugesellt. Ein
Stilleben mit stark leuchtenden Fischen, die
ornamental aufgeschichtet sind, ist eines der
maniriertesten Bilder Kislings; Charles
Blanc, der im vorigen Jahr den „Grand
Prix de la Peinture“ erhielt, hat das größte
Bild des diesjährigen Salons eingeschickt, die
Gruppenkomposition einer Familie, die sich
zum Spaziergang anschickt. Das Ganze ist
skizzenhaft gehalten, mit wenigen Tönen nur
angedeutet und bereits in einen braunen
Galerieton getränkt, der vielleicht an die
Malerei der frühen Courbet und Manet er-
innern soll. Der junge Künstler hat sich in
diesem Vorwurf übernommen und sich sehr ge-
schadet. Terechkowitch malte eine Tän-
zerin, die weit entfernt von der Konzeption
eines Degas, eine unmittelbare Frische der
Farben und einen höchsten Reiz des Konturs
verraten. Der Russe K o v n e r malt ein
Montmartrebild mit der ganzen Sehnsucht sei-
ner slawischen Seele, so daß man beim ersten
Blick den Eindruck einer russischen Stadt ge-
winnt. Der Schweizer Colonna dagegen
zeigt in seinem Hirtenbild auf schwarzem
Grund eine naive Herzlichkeit, die an primi-
tive Maler der Biedermeierzeit erinnert. Zu
erwähnen sind noch die Bilder von Kars,
Wolkonsky, des Griechen Metzanoff,
Yves Alix, Walch, Bercot, Brian-
chon, Bourneau, Favory, Worms,
Muriel Wilson, Walch, sowie der deut-
schen Künstler: Wolfgang E werth, Edith
Auerbach, E. Fuchs, Münzer und
S c h ü h 1 e i n , die fast alle noch in ihren Stu-
dienjahren sind.
Das Gesamtniveau des Herbstsalons ist
bei weitem höher als in früheren Jahren.
Sollte wirklich ein neuer Auftrieb in der Kunst
zu finden sein? Die Künstler befassen sich
wieder mehr mit Kompositionen, es ist ihnen
Ernst und allenthalben begegnet man neuen
Problemen, die zu lösen noch der Zukunft Vor-
behalten bleibt. Aber die Aktivität, die der
Herbstsalon noch nach 30 Jahren seines Be-
stehens besitzt, beweist die Nützlichkeit die-
ser Gründung im Leben der bildenden Künste.
Dr. Fritz N e u g a ß - Paris
England - Ausstellung
Die Londoner Kunstakademie wird in die-
sem Winter die Reihe ihrer großen Veranstal-
tungen fortsetzen, in der Holland, Belgien,
Italien, Persien und Frankreich das Beste ihrer
Kunst gezeigt haben. Diesmal wird England
sich selbst ausstellen, von der Frühzeit seiner
Kunst bis etwa 1850. Der wissenschaftliche
Wert der großen Schau wird beim Mittelalter
liegen, die Hauptanziehungskraft für die wei-
tere Öffentlichkeit bei Hogarth, Reynolds,
Gainsborough, Raeburn, Romney und Law-
rence, dann bei Turner und Constable.
PREISBERICHTE
Zum Einträgen in den Katalog
Di« wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:
C. 6. Boerner Leipzig
14.—15. November 1933
Alte Graphik
(Preise ab 300.— M.)
Nr. RM
5 Aldegrever: Die Frau Potiphars ver-
klagt Joseph. B. VIII. 455 . 320
14 Altdorfer: Das Taufbecken. B. 59 . 410
20 Baldung: Christus mit den Wund-
malen an der Säule. B. 42 . . . . 320
23 Baldung: Die Madonna mit dem Stif-
ter. Pass. 68 . 1 200
116 Bruegel d. Ae.: Prospectus Tybertinus.
van Bastelaer 3 . 430
131 Bruegel d. Ae.: 8 Blatt aus der Folge
von elf Schiffsdarstellungen, v. Bast.
100 1 bis 107 1 . 340
133 Bruegel d. Ae.: Der Alchimist, v. B.
197 vor I. 560
134 Bruegel d. Ae.: 4 Blatt. Die Jahres-
zeiten. v. Bast. 200 I, 202 und Seite 62 300
136 Bruegel d. Ae.: Die Kirmes am St.
Georgstag. v. Bast. 207 I. 310
143 Burgkmair: Das Haupt des dornenge-
krönten Christus. B. 22 . 480
144 Burgkmair: Der heilige Georg. B. 23 1 400
147 Buytewecn: Die Folge der kleinen
Landschaften mit dem Titelblatt,
v. d. K. 28—37 II. 420
161 Giulio Campagnola: Johannes der
Täufer. B. XIII. 371, 3 .. 8 000
162 Giulio Campagnola: Der junge Schä-
fer. B. 6. 550
163 Domenico und Giulio Campagnola:
Junge Schäfer in einer Landschaft.
B. 9.1000
176 Cranach d. Ae.: Friedrich der Weise
in Anbetung der Madonna. B. 77.
Altkoloriert . . . ..1300
177 Cranach d. Ae.: Das himmlische Let-
terlein S. Bonaventura. B. 78 . . . 470
182 Cranach d. Ae.: 2 Bl.-Porträts Fried-
richs des Weisen und Johanns I. des
Beständigen von Sachsen. Fol. Pass.
181, 182. Altkoloriert. 640
184 Cranach d. J.: Martin Luther, im
Pelzrock. Pass. 175 . 560
185 Cranach d. J.: Halbfigurenporträt
Luthers. Pass. 199 . 500
201 Deutsch: Eine der törichten Jung-
frauen. B. VII, 469 . 400
209 Dürer: 16 Bl. Die Passion Christi.
B. 3—18.1050
210 Dürer: Der Schmerzensmann mit ge-
bunden Händen B. 21. Kaltnadel-
radierung . 480
213 Dürer: Die Jungfrau mit dem langen
Haar auf der Mondsichel. B. 30 . . 600
215 Dürer: Die Madonna am Baume. B. 35 500
217 Dürer: Maria mit dem Wickelkind.
B. 38 . 460
218 Dürer: Die Jungfrau von zwei Engeln
gekrönt. B. 39 . .. 560
219 Dürer: Die Jungfrau mit der Birne.
B. 40 .*. 950
221 Dürer: Der heilige Hubertus. B. 57 . 1 050
222 Dürer: Der heilige Hieronymus neben
dem Weidenbaum. B. 59. Kaitnadel-
radierung. 18 000
230 Dürer: Das kleine Pferd. B. 96 . . 1100
231 Dürer: Das Löwenwappen mit dem
Hahn. B. 100 .. 1 850
233 Dürer: Erasmus von Rotterdam. B.107 5 300
236 Dürer: Die heilige Sippe unter dem
Baume. B. 96 . 390
237 Dürer: Maria mit dem Kinde auf der
Rasenbank. B. 98 . 850
238 Dürer: Der heilige Christophorus von
1511. B. 103 . 740
239 Dürer: Der Schulmeister. B. 133 . . 1 850
241 Dürer: 3 Bl. mit 8 Darstellungen:
Der Triumphwagen des Kaisers Maxi-
milian. B. 139 . 340
294 Elsheimer: Der Bursche mit dem
Pferde. H. 6. W. 6. 890
296 Elsheimer: Die Nymphe mit dem
Tambourin. W. 9. 450
344 Graf: Pyramus und Thisbe. Pass. 115 1300
365 Hirschvogel: Selbstbildnis Hirsch-
vogels. Pass. 141. 460
367 Hirschvogel: Wildschweinjagd. B. 23 320
369 Hirschvogel: Landschaft mit einer
Felsenfestung im Vordergründe. B. 49 310
371 Hirschvogel: Seelandschaft. B. 64 . 370
372 Hirschvogel: Landschaft mit einem
See. B. 65 . 300
373 Hirschvogel: Flußlandschaft mit zwei
Gebäuden im Wasser. B. 66 . . . . 800
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993
grevers (Nr. 5), das für Münster gekauft
wurde. Bei den Ornamentstichen traten die
Spezialsammlungen von Berlin, Dresden und
Nürnberg als Käufer auf.
Von Direktoren ausländischer Ka-
binette sahen wir nur Herrn Teding van
Berkhout aus Amsterdam, dem es gelang, den
reichen Schatz des Ryksprenten-Cabinets an
Radierungen des Herkules Seghers um ein Uni-
kum zu vermehren (Nr. 781), während einer der
anwesenden ausländischen Privatsammler
einige Holzschnitte für das Baseler Kabinett
erwarb. Vermutlich hat auch das Britische
Museum einzelne deutsche Holzschnitte und
vielleicht die zwei Elsheimer-Radierungen Nrn.
293 und 296 ersteigern lassen, die von einer
Londoner Firma gekauft wurden.
Der internationale Handel hatte zwar
wenig Kaufinteresse für eigene Rechnung, be-
teiligte sich aber lebhaft als Kommissionär
und ließ schließlich doch nur ganz wenige von
den wichtigeren Stücken unverkauft zurück-
gehen: so die „Pappenheimsche Chronik“ und
den „Totenkopf“ Wechtlins (Nrn. 141 und 937).
Meister E. S., Rembrandt und Schongauer wur-
den dagegen so gut wie ausverkauft. Die Be-
teiligung der direkten Privatinter-
essenten war diesmal schwächer als im
Frühjahr, doch kamen solche besonders auch
bei Dürer, Rembrandt und Schongauer sehr
wohl zu ihrem Rechte und erwarben mehrere
von den qualitativ besten Stücken. Für die
niederländische Graphik war ein bekannter
Sammler aus Amsterdam der große Käufer,
der nur hier und da vlämische Radierungen
einem belgischen Händler überlassen mußte
und erst bei der Versteigerung der zweiten Ab-
teilung des Kataloges (mit ihren vielen gegen-
ständlich interessanten holländischen Blät-
tern!) einen größeren Kreis von Konkurren-
ten fand, die lebhaft gegenboten und oft nicht
zu schlagen waren.
So nahm die Auktion bis zuletzt einen er-
freulichen Verlauf. Ihre Durchführung unter
den gegenwärtigen schweren äußeren Verhält-
nissen mit so bedeutendem Erfolge zeigte er-
neut die Bedeutung der Leipziger Kupferstich-
versteigerungen für den deutschen Kunst-
markt.
30 Jahre
Pariser „Herbstsalon77
In diesen Tagen wurde im Grand-Palais der
30. Herbstsalon eröffnet. Es ist gewisser-
maßen eine Jubiläumsausstellung, eine Zu-
sammenfassung aller künstlerischen Kräfte,
die seit dieser Zeit wirksam gewesen sind.
Als vor 30 Jahren der „Salon d’Automne“
gegründet wurde, stand Paris am Vorabend
seiner größten künstlerischen Revolution. Eine
Anzahl fortschrittlicher Künstler hatten sich
in berechtigter Auflehnung gegen die Jury des
„Grand-Salon“ als „Refüsierte“ zusammenge-
schlossen, um eine neue Gruppe zu bilden. Die
Tradition der Akademien und die selbstge-
fällige Beschränktheit der Impressionisten ver-
loren immer mehr an Boden; andererseits
wollte man sich gegen die geistige Hochstape-
lei der juryfreien „Independants“ abschließen
und so fanden sich Maler, Bildhauer, Archi-
tekten, Bühnenbildner, Kunsthandwerker und
Kritiker zu einer neuen Gruppe zusammen.
Die Münchner Sezession diente dem Herbst-
salon als Vorbild.
Die Prinzipien des Herbstsalons waren ein-
fach, klar und vielversprechend: alle talen-
tierten Künstler wurden aufgenommen. Eine
Jury wurde jeweils aus eigenem Kreise ge-
wählt. Ohne besondere Trennung der einzel-
nen Sektionen wurden alle Werke zusammen
gezeigt, kunsthandwerkliche Schöpfungen den
anderen Künsten gleichgestellt.
Die bedeutendsten Künstler jener Tage
zeigten hier einem großen Publikum ihre
Werke, unter ihnen Redon, Lautrec, Morisot,
Carriere, Matisse, Monticelli, Friesz, Lhote,
Flandrin, Segonzac, Laprade usw. Die Mehr-
zahl dieser alten Künstler hält sich heute
schon wieder dem Herbstsalon fern. Sie sind
alle mehr oder weniger bedeutend geworden,
haben schulbildend auf die folgende Genera-
tion gewirkt und sind in den Kreis der Un-
sterblichen im Louvre oder im Luxembourg
aufgenommen worden.
Doch wenn auch die Prominenten fehlen, so
sind sie doch im Spiegelbild vorhanden in der
Summe der kleineren und jüngeren Talente.
Man findet ganze Wände ä la Matisse, ä la
Dufy, ä la Kisling, a la Vlaminck, ä la Renoir
usw. Aber trotz aller Reminiszenzen findet
man unter den 2672 ausgestellten Werken un-
endlich viel Neues und interessantes. Beson-
ders erstaunt ist man, neben den Bildern
C o u b i n e s nun auch Plastiken desselben
Meisters zu finden. Es sind dies Akte von
schöner Harmonie, bildhaft in der Komposi-
tion und zart in der Silhouette. Waroquier
zeigt eine ganze Reihe von Bildern, Land-
schaften von tiefem Ernst und Akte von star-
ker Plastizität. Das Brautbild von Max
Band ist die größte und vollkommenste aller
Kompositionen, die der in Berlin oft gesehene
Künstler jemals vollendet hat. Sein Lands-
Inhalt Nr. 47
Chinesische Malerei in deutschem Besitz
(mit 2 Abb.). 1
Belebungam Graphikmarkt . . . 1,2
Selbstbildnis des jungen Jacopo Tintoretto
(mit 2 Abb.). 2
30 Jahre Pariser „Herbstsalon1* . 2
Preisberichte.2,3
Auktionsvorberichte (mit 2 Abb.). . 3
A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3
Nachrichten von Überall (m. Abb.) . 4
Abbildungen:
Li Yang-sheng, „Ma-ku-fee“. 1
Pa-ta-shan-jen, „Vögel auf Zweig“. 1
Jacopo Tintoretto. Selbstbildnis ....... 2
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis. 2
Tanzender Shiva. Siidindien, 16. Jahrh. ... 2
Lucas Cranach d. A.. Madonna. 3
Ausruhender Pilger. 4
Im kunsthistorischen Staatsmuseum zu Wien
hängt ein Gemälde von Jacopo Tintoretto, laut
Katalog das „Bildnis eines Mannes
von 35 Jahren, mit dunklem Haupt-
und Barthaar, vor einem Tische
stehend, die Rechte auf ein Buch
g e 1 e g t“. Es ist ein Kniestück, auf Lein-
In der gesamten
Fachliteratur gilt das
Gemälde als „Bildnis
eines Unbekann-
ten“, das zu den frühest
datierten Porträts des
Meisters zählt und des-
sen verträumte, lyrische
Auffassung den Be-
trachter immer wieder
fesselt. Eine gewissen-
hafte Vergleichung und
Prüfung dieses Wiener
Bildnisses eines un-
bekannten, jungen Man-
nes mit dem berühm-
Selbstbildnis des jungen
Jacopo Tintoretto
Von
Dr. Alfred Schubert, Düsseldorf
Selbstporträt des
dieselbe Per-
erst aus der
des Wiener
samt der
Tintoretto
deckt ver-
Parallelen
eine Reihe
Ähnlich-
Unge-
wand gemalt, 115 cm hoch, 97 cm breit, seit
1824 in der Galerie.
Die Bezeichnung links unten lautet:
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis 1553
Wien, Gemäldegalerie
ten
greisen, zirka 70jähri-
gen Jacopo
im Louvre
blüffende
auf, zeitigt
auffälliger
keitsmomente.
achtet des gewaltigen
Altersunterschiedes des
Dargestellten, weist der
J Schädelbau bei beiden
breit gewölbte Stirn
mit sehr hohen, haar-
freien Stirnecken auf;
der Haaransatz in der
tief herab; die Schläfen
vorspringende, breite Joch-
tiefliegende, beschattete
Stirnmitte reicht
sind breitflächig;
bogen bewirken
Augenhöhlen; eine mittellange, unten breite
Stumpfnase mit ein wenig hochgezogenen
Nasenflügeln ist typisch. Hinzu kommt das
kurz gehaltene Haupthaar, das inmitten der
Stirn am dichtesten und längsten ist, sowie der
volle, weich umrahmende, im Alter etwas
strähnige und wenig gepflegt erscheinende
Backen-, Schnurr- und Vollbart. Und gar selt-
sam berückt bei beiden Porträts das dunkle,
ernst und fast traurig blickende Augenpaar.
Ergibt sich aus diesen gemeinsamen, rein
äußerlichen Merkmalen in charakteristischen
Teilen der Schädel- und Gesichtsbildung im
Bildnis eines 35jährigen und eines 70jährigen
Mannes bestimmte Ähnlichkeit, so genügt dies
nicht, mit Sicherheit auf ein und " " ~
son zu schließen.
Diese Sicherheit erwächst uns
dokumentarischen Bezeichnung
Bildes. Die Jahreszahl „1553“
Altersangabe „35 Jahr e“, wobei die sonst
üblichen Worte „aetatis suae“ durch einen
Stern ersetzt sind, der die Bedeutung „a natu“
beziehungsweise „ex natu“ hat, entspricht ohne
weiteres dem Geburtsjahr Tinto-
retto s 1518.
Das verschlungene Monogramm in der
Mitte der Signatur setzt sich zusammen aus
den drei Buchstaben „SIF“, wobei das I und
das F engst verbunden und nur durch das ruck-
artige Absetzen des oberen Querstriches als
deutlich voneinander geschieden erscheinen.
Dieses Signum besteht aus den Majuskeln des
kurzen lateinischen Satzes: „Se Ipsum Fecit“.
Mithin kann das Wiener Porträt, das be-
deutende Frühwerk Jacopo Tintorettos, mit
ziemlicher Sicherheit als Selbstbildnis des
Meisters im Alter von 35 Jahren-, anno 1553
angefertigt, gelten. Die Angaben der Fach-
literatur, daß uns die Selbstbildnisse des
Künstlers aus seiner Jugendzeit nicht mein- er-
halten sind, treffen also nicht mehr ganz zu.
Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis
Paris, Louvre
1PSIVSW-
5 OK* 1VS
IACOBV8-TENTORE1 'VS- P1CTVEN1
mann, der Russe B e n a t o v , zeigt in dem
Bildnis eines Küchenjungen in blauschwarzen
Tönen einen erstaunlichen Realismus, der an
Werke des frühen Courbet gemahnt, jedoch er-
füllt ist von russischer Schwermut. Eine
Sommer- und und eine Winterlandschaft
Marquets zeigen die ganze Farbenskala
jenes Künstlers, der jedoch mit seiner lichten
Palette überzeugendere Töne findet, als in
seinem winterlichen Grau. Der Wiener F1 o c h
zeigt in seinem „Interieur“ die kristallhelle
Klarheit der luftigen Atmosphäre eines
Atelierraumes. Die delikaten Zwischentöne von
Blau zu Weiß zeigen eine Feinheit der Farb-
empfindung, wie sie seit Cezanne nur ganz
selten wiedergefunden wurde. Sein Wiener
Landsmann Viktor Tischler wirkt stär-
ker in seinen landschaftlichen Kompositionen,
klassizistischer, aber hat eine ähnliche Palette.
Die Bilder Souverbies, besonders die im
Korn ruhenden Schnitter, gehören zu den vor-
nehmsten Werken dieses Salons. Die klassische
Ruhe der Gestalten, die schlichte, aber feste
Farbgebung und das Erbe Picassos, das aus
diesen Bildern spricht, geben ihnen eine Voll-
kommenheit, die Souverbie den führenden
Meistern der jüngsten Kunst zugesellt. Ein
Stilleben mit stark leuchtenden Fischen, die
ornamental aufgeschichtet sind, ist eines der
maniriertesten Bilder Kislings; Charles
Blanc, der im vorigen Jahr den „Grand
Prix de la Peinture“ erhielt, hat das größte
Bild des diesjährigen Salons eingeschickt, die
Gruppenkomposition einer Familie, die sich
zum Spaziergang anschickt. Das Ganze ist
skizzenhaft gehalten, mit wenigen Tönen nur
angedeutet und bereits in einen braunen
Galerieton getränkt, der vielleicht an die
Malerei der frühen Courbet und Manet er-
innern soll. Der junge Künstler hat sich in
diesem Vorwurf übernommen und sich sehr ge-
schadet. Terechkowitch malte eine Tän-
zerin, die weit entfernt von der Konzeption
eines Degas, eine unmittelbare Frische der
Farben und einen höchsten Reiz des Konturs
verraten. Der Russe K o v n e r malt ein
Montmartrebild mit der ganzen Sehnsucht sei-
ner slawischen Seele, so daß man beim ersten
Blick den Eindruck einer russischen Stadt ge-
winnt. Der Schweizer Colonna dagegen
zeigt in seinem Hirtenbild auf schwarzem
Grund eine naive Herzlichkeit, die an primi-
tive Maler der Biedermeierzeit erinnert. Zu
erwähnen sind noch die Bilder von Kars,
Wolkonsky, des Griechen Metzanoff,
Yves Alix, Walch, Bercot, Brian-
chon, Bourneau, Favory, Worms,
Muriel Wilson, Walch, sowie der deut-
schen Künstler: Wolfgang E werth, Edith
Auerbach, E. Fuchs, Münzer und
S c h ü h 1 e i n , die fast alle noch in ihren Stu-
dienjahren sind.
Das Gesamtniveau des Herbstsalons ist
bei weitem höher als in früheren Jahren.
Sollte wirklich ein neuer Auftrieb in der Kunst
zu finden sein? Die Künstler befassen sich
wieder mehr mit Kompositionen, es ist ihnen
Ernst und allenthalben begegnet man neuen
Problemen, die zu lösen noch der Zukunft Vor-
behalten bleibt. Aber die Aktivität, die der
Herbstsalon noch nach 30 Jahren seines Be-
stehens besitzt, beweist die Nützlichkeit die-
ser Gründung im Leben der bildenden Künste.
Dr. Fritz N e u g a ß - Paris
England - Ausstellung
Die Londoner Kunstakademie wird in die-
sem Winter die Reihe ihrer großen Veranstal-
tungen fortsetzen, in der Holland, Belgien,
Italien, Persien und Frankreich das Beste ihrer
Kunst gezeigt haben. Diesmal wird England
sich selbst ausstellen, von der Frühzeit seiner
Kunst bis etwa 1850. Der wissenschaftliche
Wert der großen Schau wird beim Mittelalter
liegen, die Hauptanziehungskraft für die wei-
tere Öffentlichkeit bei Hogarth, Reynolds,
Gainsborough, Raeburn, Romney und Law-
rence, dann bei Turner und Constable.
PREISBERICHTE
Zum Einträgen in den Katalog
Di« wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:
C. 6. Boerner Leipzig
14.—15. November 1933
Alte Graphik
(Preise ab 300.— M.)
Nr. RM
5 Aldegrever: Die Frau Potiphars ver-
klagt Joseph. B. VIII. 455 . 320
14 Altdorfer: Das Taufbecken. B. 59 . 410
20 Baldung: Christus mit den Wund-
malen an der Säule. B. 42 . . . . 320
23 Baldung: Die Madonna mit dem Stif-
ter. Pass. 68 . 1 200
116 Bruegel d. Ae.: Prospectus Tybertinus.
van Bastelaer 3 . 430
131 Bruegel d. Ae.: 8 Blatt aus der Folge
von elf Schiffsdarstellungen, v. Bast.
100 1 bis 107 1 . 340
133 Bruegel d. Ae.: Der Alchimist, v. B.
197 vor I. 560
134 Bruegel d. Ae.: 4 Blatt. Die Jahres-
zeiten. v. Bast. 200 I, 202 und Seite 62 300
136 Bruegel d. Ae.: Die Kirmes am St.
Georgstag. v. Bast. 207 I. 310
143 Burgkmair: Das Haupt des dornenge-
krönten Christus. B. 22 . 480
144 Burgkmair: Der heilige Georg. B. 23 1 400
147 Buytewecn: Die Folge der kleinen
Landschaften mit dem Titelblatt,
v. d. K. 28—37 II. 420
161 Giulio Campagnola: Johannes der
Täufer. B. XIII. 371, 3 .. 8 000
162 Giulio Campagnola: Der junge Schä-
fer. B. 6. 550
163 Domenico und Giulio Campagnola:
Junge Schäfer in einer Landschaft.
B. 9.1000
176 Cranach d. Ae.: Friedrich der Weise
in Anbetung der Madonna. B. 77.
Altkoloriert . . . ..1300
177 Cranach d. Ae.: Das himmlische Let-
terlein S. Bonaventura. B. 78 . . . 470
182 Cranach d. Ae.: 2 Bl.-Porträts Fried-
richs des Weisen und Johanns I. des
Beständigen von Sachsen. Fol. Pass.
181, 182. Altkoloriert. 640
184 Cranach d. J.: Martin Luther, im
Pelzrock. Pass. 175 . 560
185 Cranach d. J.: Halbfigurenporträt
Luthers. Pass. 199 . 500
201 Deutsch: Eine der törichten Jung-
frauen. B. VII, 469 . 400
209 Dürer: 16 Bl. Die Passion Christi.
B. 3—18.1050
210 Dürer: Der Schmerzensmann mit ge-
bunden Händen B. 21. Kaltnadel-
radierung . 480
213 Dürer: Die Jungfrau mit dem langen
Haar auf der Mondsichel. B. 30 . . 600
215 Dürer: Die Madonna am Baume. B. 35 500
217 Dürer: Maria mit dem Wickelkind.
B. 38 . 460
218 Dürer: Die Jungfrau von zwei Engeln
gekrönt. B. 39 . .. 560
219 Dürer: Die Jungfrau mit der Birne.
B. 40 .*. 950
221 Dürer: Der heilige Hubertus. B. 57 . 1 050
222 Dürer: Der heilige Hieronymus neben
dem Weidenbaum. B. 59. Kaitnadel-
radierung. 18 000
230 Dürer: Das kleine Pferd. B. 96 . . 1100
231 Dürer: Das Löwenwappen mit dem
Hahn. B. 100 .. 1 850
233 Dürer: Erasmus von Rotterdam. B.107 5 300
236 Dürer: Die heilige Sippe unter dem
Baume. B. 96 . 390
237 Dürer: Maria mit dem Kinde auf der
Rasenbank. B. 98 . 850
238 Dürer: Der heilige Christophorus von
1511. B. 103 . 740
239 Dürer: Der Schulmeister. B. 133 . . 1 850
241 Dürer: 3 Bl. mit 8 Darstellungen:
Der Triumphwagen des Kaisers Maxi-
milian. B. 139 . 340
294 Elsheimer: Der Bursche mit dem
Pferde. H. 6. W. 6. 890
296 Elsheimer: Die Nymphe mit dem
Tambourin. W. 9. 450
344 Graf: Pyramus und Thisbe. Pass. 115 1300
365 Hirschvogel: Selbstbildnis Hirsch-
vogels. Pass. 141. 460
367 Hirschvogel: Wildschweinjagd. B. 23 320
369 Hirschvogel: Landschaft mit einer
Felsenfestung im Vordergründe. B. 49 310
371 Hirschvogel: Seelandschaft. B. 64 . 370
372 Hirschvogel: Landschaft mit einem
See. B. 65 . 300
373 Hirschvogel: Flußlandschaft mit zwei
Gebäuden im Wasser. B. 66 . . . . 800