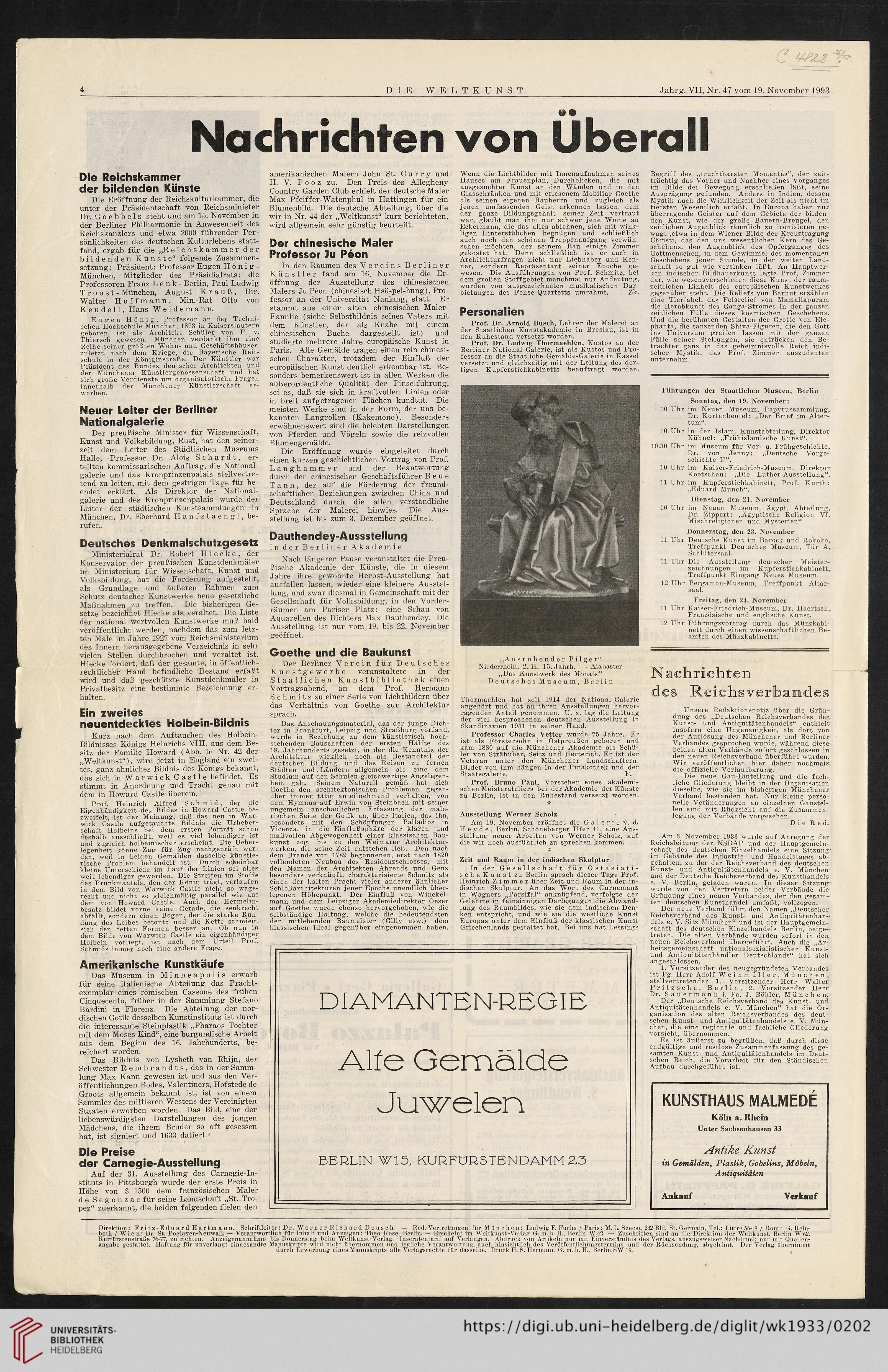DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993
Nachrichten von Überall
Die Reichskammer
der bildenden Künste
Die Eröffnung der Reichskulturkammer, die
unter der Präsidentschaft von Reichsminister
Dr. G o e b b e 1 s steht und am 15. November in
der Berliner Philharmonie in Anwesenheit des
Reichskanzlers und etwa 2000 führender Per-
sönlichkeiten des deutschen Kulturlebens statt-
fand, ergab für die „R e i c h s k a m m e r der
bildenden Künste“ folgende Zusammen-
setzung: Präsident: Professor Eugen Honig-
München, Mitglieder des Präsidialrats: die
Professoren Franz Lenk- Berlin, Paul Ludwig
T r o o s t - München, August Krauß, Dir.
Walter Hoffmann, Min.-Rat Otto von
K e u d e 11, Hans Weidemann.
Eugen Honig, Professor an der Techni-
schen Hochschule München. 1873 in Kaiserslautern
geboren, ist als Architekt Schüler von F. V.
Thiersch gewesen. München verdankt ihm eine
Reihe seiner größten Wohn- und Geschäftshäuser
zuletzt, nach dem Kriege, die Bayerische Reit-
schule in der König'instraße. Der Künstler war
Präsident des Bundes deutscher Architekten und
der Münchener Künstlergenossenschaft und hat
sich große Verdienste um organisatorische Fragen
innerhalb der Münchener Künstlerschaft er-
worben.
Neuer Leiter der Berliner
Nationalgalerie
Der preußische Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung, Rust, hat den seiner-
zeit dem Leiter des Städtischen Museums
Halle, Professor Dr. Alois Schardt, er-
teilten kommissarischen Auftrag, die National-
galerie und das Kronprinzenpalais stellvertre-
tend zu leiten, mit dem gestrigen Tage für be-
endet erklärt. Als Direktor der National-
galerie und des Kronprinzenpalais wurde der
Leiter der städtischen Kunstsammlungen in
München, Dr. Eberhard Hanfstaengl, be-
rufen.
Deutsches Denkmalschutzgesetz
Ministerialrat Dr. Robert H i e c k e , der
Konservator der preußischen Kunstdenkmäler
im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung, hat die Forderung aufgestellt,
als Grundlage und äußeren Rahmen zum
Schutz deutscher Kunstwerke neue gesetzliche
Maßnahmen zu treffen. Die bisherigen Ge-
setze bezeichnet Hiecke als veraltet. Die Liste
der national wertvollen Kunstwerke muß bald
veröffentlicht werden, nachdem das zum letz-
ten Male im Jahre 1927 vom Reichsministerium
des Innern herausgegebene Verzeichnis in sehr
vielen Stellen durchbrochen und veraltet ist.
Hiecke fordert, daß der gesamte, in öffentlich-
rechtlicher Hand befindliche Bestand erfaßt
wird und daß geschützte Kunstdenkmäler in
Privatbesitz eine bestimmte Bezeichnung er-
halten.
Ein zweites
neuentdecktes Holbein-Bildnis
Kurz nach dem Auftauchen des Holbein-
Bildnisses Königs Heinrichs VIII. aus dem Be-
sitz der Familie Howard (Abb. in Nr. 42 der
„Weltkunst“), wird jetzt in England ein zwei-
tes, ganz ähnliches Bildnis des Königs bekannt,
das sich in W arwick Castle befindet. Es
stimmt in Anordnung und Tracht genau mit
dem in Howard Castle überein.
Prof. Heinrich Alfred Schmid, der die
Eigenhändigkeit des Bildes in Howard Castle be-
zweifelt, ist der Meinung, daß das neu in War-
wick Castle aufgetauchte Bildnis die Urheber-
schaft Holbeins bei dem ersten Porträt schon
deshalb ausschließt, weil es viel lebendiger ist
und zugleich holbeinischer erscheint. Die Ueber-
legenheit könne Zug für Zug nachgeprüft wer-
den, weil in beiden Gemälden dasselbe künstle-
rische Problem behandelt ist. Durch scheinbar-
kleine Unterschiede im Lauf der Linien, sei alles
weit lebendiger geworden. Die Streifen im Stoffe
des Prunkmantels, den der König trägt, verlaufen
in dem Bild von Warwick Castle nicht so wage-
recht und nicht so gleichmäßig parallel wie auf
dem von Howard Castle. Auch der Hermelin-
besatz bildet vorne keine Gerade, die senkrecht
abfällt, sondern einen Bogen, der die starke Run-
dung des Leibes betont; und die Kette schmiegt
sich den fetten Formen besser an. Ob nun in
dem Bilde von Warwick Castle ein eigenhändiger
Holbein vorliegt, ist nach dem Urteil Prof.
Schmids immer noch eine andere Frage.
Amerikanische Kunstkäufe
Das Museum in Minneapolis erwarb
für seine italienische Abteilung das Pracht-
exemplar eines römischen Cassone des frühen
Cinquecento, früher in der Sammlung Stefano
Bardini in Florenz. Die Abteilung der nor-
dischen Gotik desselben Kunstinstituts ist durch
die interessante Steinplastik „Pharaos Tochter
mit dem Moses-Kind“, eine burgundische Arbeit
aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, be-
reichert worden.
Das Bildnis von Lysbeth van Rhijn, der
Schwester Rembrandts, das in der Samm-
lung Max Kann gewesen ist und aus den Ver-
öffentlichungen Bodes, Valentiners, Hofstede de
Groots allgemein bekannt ist, ist von einem
Sammler des mittleren Westens der Vereinigten
Staaten erworben worden. Das Bild, eine der
liebenswürdigsten Darstellungen des jungen
Mädchens, die ihrem Bruder so oft gesessen
hat, ist signiert und 1633 datiert.
Die Preise
der Carnegie-Ausstellung
Auf der 31. Ausstellung des Carnegie-In-
stituts in Pittsburgh wurde der erste Preis in
Höhe von $ 1500 dem französischen Maler
de Segonzac für seine Landschaft „St. Tro-
pez“ zuerkannt, die beiden folgenden fielen den
amerikanischen Malern John St. Curry und
H. V. P o o z zu. Den Preis des Allegheny
Country Garden Club erhielt der deutsche Maler
Max Pfeiffer-Watenphul in Hattingen für ein
Blumenbild. Die deutsche Abteilung, über die
wir in Nr. 44 der „Weltkunst“ kurz berichteten,
wird allgemein sehr günstig beurteilt.
Der chinesische Maler
Professor Ju Peon
In den Räumen des Vereins Berliner
Künstler fand am 16. November die Er-
öffnung der Ausstellung des chinesischen
Malers Ju Peon (chinesisch Hsü-pei-hung), Pro-
fessor an der Universität Nanking, statt. Er
stammt aus einer alten chinesischen Maler-
Familie (siehe Selbstbildnis seines Vaters mit
dem Künstler, der als Knabe mit einem
chinesischen Buche dargestellt ist) und
studierte mehrere Jahre europäische Kunst in
Paris. Alle Gemälde tragen einen rein chinesi-
schen Charakter, trotzdem der Einfluß der
europäischen Kunst deutlich erkennbar ist. Be-
sonders bemerkenswert ist in allen Werken die
außerordentliche Qualität der Pinselführung,
sei es, daß sie sich in kraftvollen Linien oder
in breit aufgetragenen Flächen kundtut. Die
meisten Werke sind in der Form, der uns be-
kannten Langrollen (Kakemono). Besonders
erwähnenswert sind die belebten Darstellungen
von Pferden und Vögeln sowie die reizvollen
Blumengemälde.
Die Eröffnung wurde eingeleitet durch
einen kurzen geschichtlichen Vortrag von Prof.
L ang hämmer und der Beantwortung
durch den chinesischen Geschäftsführer B e u e
Tann, der auf die Förderung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen China und
Deutschland durch die allen verständliche
Sprache der Malerei hinwies. Die Aus-
stellung ist bis zum 3. Dezember geöffnet.
Dauthendey-Aussstellung
in der Berliner Akademie
Nach längerer Pause veranstaltet die Preu-
ßische Akademie der Künste, die in diesem
Jahre ihre gewohnte Herbst-Ausstellung hat
ausfallen lassen, -wieder eine kleinere Ausstel-
lung, und zwar diesmal in Gemeinschaft mit der
Gesellschaft für Volksbildung, in den Vorder-
räumen am Pariser Platz: eine Schau von
Aquarellen des Dichters Max Dauthendey. Die
Ausstellung ist nur vom 19. bis 22. November
geöffnet.
Goethe und die Baukunst
Der Berliner Verein für Deutsches
Kunstgewerbe veranstaltete in der
Staatlichen Kunstbibliothek einen
Vortragsabend, an dem Prof. Hermann
Schmitz zu einer Serie von Lichtbildern über
das Verhältnis von Goethe zur Architektur
sprach.
Das Anschauungsmaterial, das der junge Dich-
ter in Frankfurt, Leipzig und Straßburg vorfand,
wurde in Beziehung zu dem künstlerisch hoch-
stehenden Bauschaffen der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts gesetzt, in der die Kenntnis der
Architektur wirklich noch als Bestandteil der
deutschen Bildung und das Reisen zu fernen
Städten und. Ländern allgemein als eine dem
Studium auf den Schulen gleichwertige Angelegen-
heit galt. Seinem Naturell gemäß hat sich
Goethe den architektonischen Problemen gegen-
über immer tätig anteilnehmend verhalten, von
dem Hymnus auf Erwin von Steinbach mit seiner
ungemein anschaulichen Erfassung der male-
rischen Seite der Gotik an, über Italien, das ihn,
besonders mit den Schöpfungen Palladios in
Vicenza, in die Einflußsphäre der klaren und
maßvollen Abgewogenheit einer klassischen Bau-
kunst zog, bis zu den Weimarer Architektur-
werken, die seine Zeit entstehen ließ. Den nach
dem Brande von 1789 begonnenen, erst nach 1820
vollendeten Neubau des Residenzschlosses, mit
den Namen der Architekten Ahrends und Genz
besonders verknüpft, charakterisierte Schmitz als
einen der kalten Pracht vieler anderer ähnlicher
Schloßarchitekturen jener Epoche unendlich über-
legenen Höhepunkt. Der Einfluß von Winckel-
mann und dem Leipziger Akademiedirektor Oeser
auf Goethe wurde ebenso hervorgehoben, wie die
selbständige Haltung, welche die bedeutendsten
der mitlebenden Baumeister (Gilly usw.) dem
klassischen Ideal gegenüber eingenommen haben.
Wenn die Lichtbilder mit Innenaufnahmen seines
Hauses am Frauenplan, Durchblicken, die mit
ausgesuchter Kunst an den Wänden und in den
Glasschränken und mit erlesenem Mobiliar Goethe
als seinen eigenen Bauherrn und zugleich als
jenen umfassenden Geist erkennen lassen, dem
der ganze Bildungsgehalt seiner Zeit vertraut
war, glaubt man ihm nur schwer jene Worte an
Eckermann, die das alles ablehnen, sich mit wink-
ligen Hinterstübchen begnügen und schließlich
auch noch den schönen Treppenaufgang verwün-
schen möchten, der seinem Bau einige Zimmer
gekostet hat. Denn schließlich ist er auch in
Architekturfragen nicht nur Liebhaber und Ken-
ner, sondern Repräsentant seiner Epoche ge-
wesen. Die Ausführungen von Prof. Schmitz, bei
dem großen Stoffgebiet manchmal nur Andeutung,
wurden von ausgezeichneten musikalischen Dar-
bietungen des Fehse-Quartetts umrahmt. Zk.
Personalien
Prof. Dr. Arnold Busch, Lehrer der Malerei an
der Staatlichen Kunstakademie in Breslau, ist in
den Ruhestand versetzt worden.
Prof. Dr. Ludwig Thormaehlen, Kustos an der
Berliner National-Galerie, ist als Kustos und Pro-
fessor an die Staatliche Gemälde-Galerie in Kassel
versetzt und gleichzeitig mit der Leitung des dor-
tigen Kupferstichkabinetts beauftragt worden.
,,A usr uhender Pilger“
Niederrhein, 2. H. 15. Jahrh. — Alabaster
„Das Kunstwerk des Monats“
Deutsches Museum, Berlin
Thormaehlen hat seit 1914 der National-Galerie
angehört und hat an ihren Ausstellungen hervor-
ragenden Anteil genommen. U. a. lag die Leitung
der viel besprochenen deutschen Ausstellung in
Skandinavien 1931 in seiner Hand.
Professor Charles Vetter wurde 75 Jahre. Er
ist als Förstersohn in Ostpreußen geboren und
kam 1880 auf die Münchener Akademie als Schü-
ler von Strähuber, Seitz und Herterich. Er ist der
Veteran unter den Münchener Landschaftern.
Bilder von ihm hängen in der Pinakothek und der
Staatsgalerie. F’.
Prof. Bruno Paul, Vorsteher eines akademi-
schen Meisterateliers bei der Akademie der Künste
zu Berlin, ist in den Ruhestand versetzt worden.
*
Ausstellung Werner Scholz
Am 19. November eröffnet die Galerie v. d.
H e y d e , Berlin, Schöneberger Ufer 41, eine Aus-
stellung neuer Arbeiten von Werner Scholz, auf
die wir noch ausführlich zu sprechen kommen.
Zeit und Raum in der indischen Skulptur
In der Gesellschaft für Ostasiati-
sche Kunst zu Berlin sprach dieser Tage Prof.
Heinrich Zimmer über Zeit und Raum in der in-
dischen Skulptur. An das Wort des Gurnemanz
in Wagners „Parsifal“ anknüpfend, verfolgte der
Gelehrte in feinsinnigen Darlegungen die Abwand-
lung des Raumbildes, wie sie dem indischen Den-
ken entspricht, und wie sie die westliche Kunst
Europas unter dem Einfluß der klassischen Kunst
Griechenlands gestaltet hat. Bei uns hat Lessings
DIAMANTEN-REGIE
Alte Gemälde
Juwelen
BERLIN Wlö, KURFURSTENDAMM 23
Begriff des „fruchtbarsten Momentes“, der zeit-
trächtig das Vorher und Nachher eines Vorganges
im Bilde der Bewegung erschließen läßt, seine
Ausprägung gefunden. Anders in Indien, dessen
Mystik auch die Wirklichkeit der Zeit als nicht im
tiefsten Wesentlich erfaßt. In Europa haben nur
überragende Geister auf dem Gebiete der bilden-
den Kunst, wie der große Bauern-Breugel, den
zeitlichen Augenblick räumlich zu ironisieren ge-
wagt ,etwa in dem Wiener Bilde der Kreuztragung
Christi, das den uns wesentlichen Kern des Ge-
schehens, den Augenblick des Opferganges des
Gottmenschen, in dem Gewimmel des momentanen
Geschehens jener Stunde, in der weiten Land-
schaft so gut wie versinken läßt. An Hauptwer-
ken indischer Bildhauerkunst legte Prof. Zimmer
dar, wie wesensverschieden diese Kunst der raum-
zeitlichen Einheit des europäischen Kunstwerkes
gegenüber steht. Die Reliefs von Barhut erzählen
eine Tierfabel, das Felsrelief von Mamallapuram
die Herabkunft des Ganga-Stromes in der ganzen
zeitlichen Fülle dieses kosmischen Geschehens.
Und die berühmten Gestalten der Grotte von Ele-
phanta, die tanzenden Shiva-Figuren, die den Gott
ins Universum greifen lassen mit der ganzen
Fülle seiner Stellungen, sie entrücken den Be-
trachter ganz in das geheimnisvolle Reich indi-
scher Mystik, das Prof. Zimmer auszudeuten
unternahm.
Führungen der Staatlichen Museen, Berlin
Sonntag, den 19. November:
10 Uhr im Neuen Museum, Papyrussammlung,
Dr. Kortenbeutel: „Der Brief im Alter-
tum“.
10 Uhr in der Islam. Kunstabteilung, Direktor
Kühnel:' „Frühislamische Kunst“.
10.30 Uhr im Museum für Vor- u. Frühgeschichte,
Dr. von Jenny: „Deutsche Vorge-
schichte II“.
10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Museum, Direktor
Koetschau: „Die Luther-Ausstellung“.
11 Uhr im Kupferstichkabinett, Prof. Kurth:
„Eduard Munch“.
Dienstag, den 21. November
10 Uhr im Neuen Museum, Ägypt. Abteilung,
Dr. Zippert: „Ägyptische Religion VI.
Mischreligionen und Mysterien“.
Donnerstag, den 23. November
11 Uhr Deutsche Kunst im Barock und Rokoko,
Treffpunkt Deutsches Museum, Tür A,
Schlütersaal.
11 Uhr Die Ausstellung deutscher Meister-
zeichnungen im Kupferstichkabinett,
Treffpunkt Eingang Neues Museum.
12 Uhr Pergamon-Museum, Treffpunkt Altar-
saal.
Freitag, den 24. November
11 Uhr Kaiser-Friedrich-Museum, Dr. Haertsch,
Französische und englische Kunst.
12 Uhr Führungsvortrag durch das Münzkabi-
nett durch einen wissenschaftlichen Be-
amten des Münzkabinetts.
Nachrichten
des Reichsverbandes
Unsere Redaktionsnotiz über die Grün-
dung des „Deutschen Reichsverbandes des
Kunst- und Antiquitätenhandels“ enthielt
insofern eine Ungenauigkeit, als dort von
der Auflösung des Münchener und Berliner
Verbandes gesprochen wurde, während diese
beiden alten Verbände sofort geschlossen in
den neuen Reichsverband überführt wurden.
Wir veröffentlichen hier daher nochmals
die offizielle Verlautbarung.
Die neue Gau-Einteilung und die fach-
liche Gliederung bleibt in der Organisation
dieselbe, wie sie im bisherigen Münchener
Verband bestanden hat. Nur kleine perso-
nelle Veränderungen an einzelnen Gaustel-
len sind mit Rücksicht auf die Zusammen-
legung der Verbände vorgesehen.
Die Red-
Arn 6. November 1933 wurde auf Anregung der
Reichsleitung der NSDAP und der Hauptgemein-
schaft des deutschen Einzelhandels eine Sitzung-
im Gebäude des Industrie- und Handelstages ab-
gehalten, zu der der Reichsverband des deutschen
Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. München
und der Deutsche Reichsverband des Kunsthandels
e. V. Berlin, geladen waren. In dieser Sitzung
wurde von den Vertretern beider Verbände die
Gründung eines neuen Verbandes, der den gesam-
ten deutschen Kunsthandel umfaßt, vollzogen.
Der neue Verband führt den Namen „Deutscher
Reichsverband des Kunst- und Antiquitätenhan-
dels e. V. Sitz München“ und ist der Hauptgemein-
schaft des deutschen Einzelhandels Berlin, beige-
treten. Die alten Verbände wurden sofort in den
neuen Reichsverband übergeführt. Auch die „Ar-
beitsgemeinschaft nationalsozialistischer Kunst-
und Antiquitätenhändler Deutschlands“ hat sich
angeschlossen.
1. Vorsitzender des neugegründeten Verbandes
ist Pg. Herr Adolf Weinmüller, München,
stellvertretender 1. Vorsitzender Herr Walter
Fritzsche, Berlin, 2. Vorsitzender Herr
Dr. Sauermann i. Fa. J. Böhler, München.
Der „Deutsche Reichsverband des Kunst- und
Antiquitätenhandels e. V. München“ hat die Or-
ganisation des alten Reichsverbandes des deut-
schen Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. Mün-
chen, die eine regionale und fachliche Gliederung
vorsieht, übernommen.
Es ist äußerst zu begrüßen, daß durch diese
endgültige und restlose Zusammenfassung des ge-
samten Kunst- und Antiquitätenhandels im Deut-
schen Reich, die Vorarbeit für den Ständischen
Aufbau durchgeführt ist.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h a r d D e u s c h. — Red.-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77? zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19.
Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993
Nachrichten von Überall
Die Reichskammer
der bildenden Künste
Die Eröffnung der Reichskulturkammer, die
unter der Präsidentschaft von Reichsminister
Dr. G o e b b e 1 s steht und am 15. November in
der Berliner Philharmonie in Anwesenheit des
Reichskanzlers und etwa 2000 führender Per-
sönlichkeiten des deutschen Kulturlebens statt-
fand, ergab für die „R e i c h s k a m m e r der
bildenden Künste“ folgende Zusammen-
setzung: Präsident: Professor Eugen Honig-
München, Mitglieder des Präsidialrats: die
Professoren Franz Lenk- Berlin, Paul Ludwig
T r o o s t - München, August Krauß, Dir.
Walter Hoffmann, Min.-Rat Otto von
K e u d e 11, Hans Weidemann.
Eugen Honig, Professor an der Techni-
schen Hochschule München. 1873 in Kaiserslautern
geboren, ist als Architekt Schüler von F. V.
Thiersch gewesen. München verdankt ihm eine
Reihe seiner größten Wohn- und Geschäftshäuser
zuletzt, nach dem Kriege, die Bayerische Reit-
schule in der König'instraße. Der Künstler war
Präsident des Bundes deutscher Architekten und
der Münchener Künstlergenossenschaft und hat
sich große Verdienste um organisatorische Fragen
innerhalb der Münchener Künstlerschaft er-
worben.
Neuer Leiter der Berliner
Nationalgalerie
Der preußische Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung, Rust, hat den seiner-
zeit dem Leiter des Städtischen Museums
Halle, Professor Dr. Alois Schardt, er-
teilten kommissarischen Auftrag, die National-
galerie und das Kronprinzenpalais stellvertre-
tend zu leiten, mit dem gestrigen Tage für be-
endet erklärt. Als Direktor der National-
galerie und des Kronprinzenpalais wurde der
Leiter der städtischen Kunstsammlungen in
München, Dr. Eberhard Hanfstaengl, be-
rufen.
Deutsches Denkmalschutzgesetz
Ministerialrat Dr. Robert H i e c k e , der
Konservator der preußischen Kunstdenkmäler
im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung, hat die Forderung aufgestellt,
als Grundlage und äußeren Rahmen zum
Schutz deutscher Kunstwerke neue gesetzliche
Maßnahmen zu treffen. Die bisherigen Ge-
setze bezeichnet Hiecke als veraltet. Die Liste
der national wertvollen Kunstwerke muß bald
veröffentlicht werden, nachdem das zum letz-
ten Male im Jahre 1927 vom Reichsministerium
des Innern herausgegebene Verzeichnis in sehr
vielen Stellen durchbrochen und veraltet ist.
Hiecke fordert, daß der gesamte, in öffentlich-
rechtlicher Hand befindliche Bestand erfaßt
wird und daß geschützte Kunstdenkmäler in
Privatbesitz eine bestimmte Bezeichnung er-
halten.
Ein zweites
neuentdecktes Holbein-Bildnis
Kurz nach dem Auftauchen des Holbein-
Bildnisses Königs Heinrichs VIII. aus dem Be-
sitz der Familie Howard (Abb. in Nr. 42 der
„Weltkunst“), wird jetzt in England ein zwei-
tes, ganz ähnliches Bildnis des Königs bekannt,
das sich in W arwick Castle befindet. Es
stimmt in Anordnung und Tracht genau mit
dem in Howard Castle überein.
Prof. Heinrich Alfred Schmid, der die
Eigenhändigkeit des Bildes in Howard Castle be-
zweifelt, ist der Meinung, daß das neu in War-
wick Castle aufgetauchte Bildnis die Urheber-
schaft Holbeins bei dem ersten Porträt schon
deshalb ausschließt, weil es viel lebendiger ist
und zugleich holbeinischer erscheint. Die Ueber-
legenheit könne Zug für Zug nachgeprüft wer-
den, weil in beiden Gemälden dasselbe künstle-
rische Problem behandelt ist. Durch scheinbar-
kleine Unterschiede im Lauf der Linien, sei alles
weit lebendiger geworden. Die Streifen im Stoffe
des Prunkmantels, den der König trägt, verlaufen
in dem Bild von Warwick Castle nicht so wage-
recht und nicht so gleichmäßig parallel wie auf
dem von Howard Castle. Auch der Hermelin-
besatz bildet vorne keine Gerade, die senkrecht
abfällt, sondern einen Bogen, der die starke Run-
dung des Leibes betont; und die Kette schmiegt
sich den fetten Formen besser an. Ob nun in
dem Bilde von Warwick Castle ein eigenhändiger
Holbein vorliegt, ist nach dem Urteil Prof.
Schmids immer noch eine andere Frage.
Amerikanische Kunstkäufe
Das Museum in Minneapolis erwarb
für seine italienische Abteilung das Pracht-
exemplar eines römischen Cassone des frühen
Cinquecento, früher in der Sammlung Stefano
Bardini in Florenz. Die Abteilung der nor-
dischen Gotik desselben Kunstinstituts ist durch
die interessante Steinplastik „Pharaos Tochter
mit dem Moses-Kind“, eine burgundische Arbeit
aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, be-
reichert worden.
Das Bildnis von Lysbeth van Rhijn, der
Schwester Rembrandts, das in der Samm-
lung Max Kann gewesen ist und aus den Ver-
öffentlichungen Bodes, Valentiners, Hofstede de
Groots allgemein bekannt ist, ist von einem
Sammler des mittleren Westens der Vereinigten
Staaten erworben worden. Das Bild, eine der
liebenswürdigsten Darstellungen des jungen
Mädchens, die ihrem Bruder so oft gesessen
hat, ist signiert und 1633 datiert.
Die Preise
der Carnegie-Ausstellung
Auf der 31. Ausstellung des Carnegie-In-
stituts in Pittsburgh wurde der erste Preis in
Höhe von $ 1500 dem französischen Maler
de Segonzac für seine Landschaft „St. Tro-
pez“ zuerkannt, die beiden folgenden fielen den
amerikanischen Malern John St. Curry und
H. V. P o o z zu. Den Preis des Allegheny
Country Garden Club erhielt der deutsche Maler
Max Pfeiffer-Watenphul in Hattingen für ein
Blumenbild. Die deutsche Abteilung, über die
wir in Nr. 44 der „Weltkunst“ kurz berichteten,
wird allgemein sehr günstig beurteilt.
Der chinesische Maler
Professor Ju Peon
In den Räumen des Vereins Berliner
Künstler fand am 16. November die Er-
öffnung der Ausstellung des chinesischen
Malers Ju Peon (chinesisch Hsü-pei-hung), Pro-
fessor an der Universität Nanking, statt. Er
stammt aus einer alten chinesischen Maler-
Familie (siehe Selbstbildnis seines Vaters mit
dem Künstler, der als Knabe mit einem
chinesischen Buche dargestellt ist) und
studierte mehrere Jahre europäische Kunst in
Paris. Alle Gemälde tragen einen rein chinesi-
schen Charakter, trotzdem der Einfluß der
europäischen Kunst deutlich erkennbar ist. Be-
sonders bemerkenswert ist in allen Werken die
außerordentliche Qualität der Pinselführung,
sei es, daß sie sich in kraftvollen Linien oder
in breit aufgetragenen Flächen kundtut. Die
meisten Werke sind in der Form, der uns be-
kannten Langrollen (Kakemono). Besonders
erwähnenswert sind die belebten Darstellungen
von Pferden und Vögeln sowie die reizvollen
Blumengemälde.
Die Eröffnung wurde eingeleitet durch
einen kurzen geschichtlichen Vortrag von Prof.
L ang hämmer und der Beantwortung
durch den chinesischen Geschäftsführer B e u e
Tann, der auf die Förderung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen China und
Deutschland durch die allen verständliche
Sprache der Malerei hinwies. Die Aus-
stellung ist bis zum 3. Dezember geöffnet.
Dauthendey-Aussstellung
in der Berliner Akademie
Nach längerer Pause veranstaltet die Preu-
ßische Akademie der Künste, die in diesem
Jahre ihre gewohnte Herbst-Ausstellung hat
ausfallen lassen, -wieder eine kleinere Ausstel-
lung, und zwar diesmal in Gemeinschaft mit der
Gesellschaft für Volksbildung, in den Vorder-
räumen am Pariser Platz: eine Schau von
Aquarellen des Dichters Max Dauthendey. Die
Ausstellung ist nur vom 19. bis 22. November
geöffnet.
Goethe und die Baukunst
Der Berliner Verein für Deutsches
Kunstgewerbe veranstaltete in der
Staatlichen Kunstbibliothek einen
Vortragsabend, an dem Prof. Hermann
Schmitz zu einer Serie von Lichtbildern über
das Verhältnis von Goethe zur Architektur
sprach.
Das Anschauungsmaterial, das der junge Dich-
ter in Frankfurt, Leipzig und Straßburg vorfand,
wurde in Beziehung zu dem künstlerisch hoch-
stehenden Bauschaffen der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts gesetzt, in der die Kenntnis der
Architektur wirklich noch als Bestandteil der
deutschen Bildung und das Reisen zu fernen
Städten und. Ländern allgemein als eine dem
Studium auf den Schulen gleichwertige Angelegen-
heit galt. Seinem Naturell gemäß hat sich
Goethe den architektonischen Problemen gegen-
über immer tätig anteilnehmend verhalten, von
dem Hymnus auf Erwin von Steinbach mit seiner
ungemein anschaulichen Erfassung der male-
rischen Seite der Gotik an, über Italien, das ihn,
besonders mit den Schöpfungen Palladios in
Vicenza, in die Einflußsphäre der klaren und
maßvollen Abgewogenheit einer klassischen Bau-
kunst zog, bis zu den Weimarer Architektur-
werken, die seine Zeit entstehen ließ. Den nach
dem Brande von 1789 begonnenen, erst nach 1820
vollendeten Neubau des Residenzschlosses, mit
den Namen der Architekten Ahrends und Genz
besonders verknüpft, charakterisierte Schmitz als
einen der kalten Pracht vieler anderer ähnlicher
Schloßarchitekturen jener Epoche unendlich über-
legenen Höhepunkt. Der Einfluß von Winckel-
mann und dem Leipziger Akademiedirektor Oeser
auf Goethe wurde ebenso hervorgehoben, wie die
selbständige Haltung, welche die bedeutendsten
der mitlebenden Baumeister (Gilly usw.) dem
klassischen Ideal gegenüber eingenommen haben.
Wenn die Lichtbilder mit Innenaufnahmen seines
Hauses am Frauenplan, Durchblicken, die mit
ausgesuchter Kunst an den Wänden und in den
Glasschränken und mit erlesenem Mobiliar Goethe
als seinen eigenen Bauherrn und zugleich als
jenen umfassenden Geist erkennen lassen, dem
der ganze Bildungsgehalt seiner Zeit vertraut
war, glaubt man ihm nur schwer jene Worte an
Eckermann, die das alles ablehnen, sich mit wink-
ligen Hinterstübchen begnügen und schließlich
auch noch den schönen Treppenaufgang verwün-
schen möchten, der seinem Bau einige Zimmer
gekostet hat. Denn schließlich ist er auch in
Architekturfragen nicht nur Liebhaber und Ken-
ner, sondern Repräsentant seiner Epoche ge-
wesen. Die Ausführungen von Prof. Schmitz, bei
dem großen Stoffgebiet manchmal nur Andeutung,
wurden von ausgezeichneten musikalischen Dar-
bietungen des Fehse-Quartetts umrahmt. Zk.
Personalien
Prof. Dr. Arnold Busch, Lehrer der Malerei an
der Staatlichen Kunstakademie in Breslau, ist in
den Ruhestand versetzt worden.
Prof. Dr. Ludwig Thormaehlen, Kustos an der
Berliner National-Galerie, ist als Kustos und Pro-
fessor an die Staatliche Gemälde-Galerie in Kassel
versetzt und gleichzeitig mit der Leitung des dor-
tigen Kupferstichkabinetts beauftragt worden.
,,A usr uhender Pilger“
Niederrhein, 2. H. 15. Jahrh. — Alabaster
„Das Kunstwerk des Monats“
Deutsches Museum, Berlin
Thormaehlen hat seit 1914 der National-Galerie
angehört und hat an ihren Ausstellungen hervor-
ragenden Anteil genommen. U. a. lag die Leitung
der viel besprochenen deutschen Ausstellung in
Skandinavien 1931 in seiner Hand.
Professor Charles Vetter wurde 75 Jahre. Er
ist als Förstersohn in Ostpreußen geboren und
kam 1880 auf die Münchener Akademie als Schü-
ler von Strähuber, Seitz und Herterich. Er ist der
Veteran unter den Münchener Landschaftern.
Bilder von ihm hängen in der Pinakothek und der
Staatsgalerie. F’.
Prof. Bruno Paul, Vorsteher eines akademi-
schen Meisterateliers bei der Akademie der Künste
zu Berlin, ist in den Ruhestand versetzt worden.
*
Ausstellung Werner Scholz
Am 19. November eröffnet die Galerie v. d.
H e y d e , Berlin, Schöneberger Ufer 41, eine Aus-
stellung neuer Arbeiten von Werner Scholz, auf
die wir noch ausführlich zu sprechen kommen.
Zeit und Raum in der indischen Skulptur
In der Gesellschaft für Ostasiati-
sche Kunst zu Berlin sprach dieser Tage Prof.
Heinrich Zimmer über Zeit und Raum in der in-
dischen Skulptur. An das Wort des Gurnemanz
in Wagners „Parsifal“ anknüpfend, verfolgte der
Gelehrte in feinsinnigen Darlegungen die Abwand-
lung des Raumbildes, wie sie dem indischen Den-
ken entspricht, und wie sie die westliche Kunst
Europas unter dem Einfluß der klassischen Kunst
Griechenlands gestaltet hat. Bei uns hat Lessings
DIAMANTEN-REGIE
Alte Gemälde
Juwelen
BERLIN Wlö, KURFURSTENDAMM 23
Begriff des „fruchtbarsten Momentes“, der zeit-
trächtig das Vorher und Nachher eines Vorganges
im Bilde der Bewegung erschließen läßt, seine
Ausprägung gefunden. Anders in Indien, dessen
Mystik auch die Wirklichkeit der Zeit als nicht im
tiefsten Wesentlich erfaßt. In Europa haben nur
überragende Geister auf dem Gebiete der bilden-
den Kunst, wie der große Bauern-Breugel, den
zeitlichen Augenblick räumlich zu ironisieren ge-
wagt ,etwa in dem Wiener Bilde der Kreuztragung
Christi, das den uns wesentlichen Kern des Ge-
schehens, den Augenblick des Opferganges des
Gottmenschen, in dem Gewimmel des momentanen
Geschehens jener Stunde, in der weiten Land-
schaft so gut wie versinken läßt. An Hauptwer-
ken indischer Bildhauerkunst legte Prof. Zimmer
dar, wie wesensverschieden diese Kunst der raum-
zeitlichen Einheit des europäischen Kunstwerkes
gegenüber steht. Die Reliefs von Barhut erzählen
eine Tierfabel, das Felsrelief von Mamallapuram
die Herabkunft des Ganga-Stromes in der ganzen
zeitlichen Fülle dieses kosmischen Geschehens.
Und die berühmten Gestalten der Grotte von Ele-
phanta, die tanzenden Shiva-Figuren, die den Gott
ins Universum greifen lassen mit der ganzen
Fülle seiner Stellungen, sie entrücken den Be-
trachter ganz in das geheimnisvolle Reich indi-
scher Mystik, das Prof. Zimmer auszudeuten
unternahm.
Führungen der Staatlichen Museen, Berlin
Sonntag, den 19. November:
10 Uhr im Neuen Museum, Papyrussammlung,
Dr. Kortenbeutel: „Der Brief im Alter-
tum“.
10 Uhr in der Islam. Kunstabteilung, Direktor
Kühnel:' „Frühislamische Kunst“.
10.30 Uhr im Museum für Vor- u. Frühgeschichte,
Dr. von Jenny: „Deutsche Vorge-
schichte II“.
10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Museum, Direktor
Koetschau: „Die Luther-Ausstellung“.
11 Uhr im Kupferstichkabinett, Prof. Kurth:
„Eduard Munch“.
Dienstag, den 21. November
10 Uhr im Neuen Museum, Ägypt. Abteilung,
Dr. Zippert: „Ägyptische Religion VI.
Mischreligionen und Mysterien“.
Donnerstag, den 23. November
11 Uhr Deutsche Kunst im Barock und Rokoko,
Treffpunkt Deutsches Museum, Tür A,
Schlütersaal.
11 Uhr Die Ausstellung deutscher Meister-
zeichnungen im Kupferstichkabinett,
Treffpunkt Eingang Neues Museum.
12 Uhr Pergamon-Museum, Treffpunkt Altar-
saal.
Freitag, den 24. November
11 Uhr Kaiser-Friedrich-Museum, Dr. Haertsch,
Französische und englische Kunst.
12 Uhr Führungsvortrag durch das Münzkabi-
nett durch einen wissenschaftlichen Be-
amten des Münzkabinetts.
Nachrichten
des Reichsverbandes
Unsere Redaktionsnotiz über die Grün-
dung des „Deutschen Reichsverbandes des
Kunst- und Antiquitätenhandels“ enthielt
insofern eine Ungenauigkeit, als dort von
der Auflösung des Münchener und Berliner
Verbandes gesprochen wurde, während diese
beiden alten Verbände sofort geschlossen in
den neuen Reichsverband überführt wurden.
Wir veröffentlichen hier daher nochmals
die offizielle Verlautbarung.
Die neue Gau-Einteilung und die fach-
liche Gliederung bleibt in der Organisation
dieselbe, wie sie im bisherigen Münchener
Verband bestanden hat. Nur kleine perso-
nelle Veränderungen an einzelnen Gaustel-
len sind mit Rücksicht auf die Zusammen-
legung der Verbände vorgesehen.
Die Red-
Arn 6. November 1933 wurde auf Anregung der
Reichsleitung der NSDAP und der Hauptgemein-
schaft des deutschen Einzelhandels eine Sitzung-
im Gebäude des Industrie- und Handelstages ab-
gehalten, zu der der Reichsverband des deutschen
Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. München
und der Deutsche Reichsverband des Kunsthandels
e. V. Berlin, geladen waren. In dieser Sitzung
wurde von den Vertretern beider Verbände die
Gründung eines neuen Verbandes, der den gesam-
ten deutschen Kunsthandel umfaßt, vollzogen.
Der neue Verband führt den Namen „Deutscher
Reichsverband des Kunst- und Antiquitätenhan-
dels e. V. Sitz München“ und ist der Hauptgemein-
schaft des deutschen Einzelhandels Berlin, beige-
treten. Die alten Verbände wurden sofort in den
neuen Reichsverband übergeführt. Auch die „Ar-
beitsgemeinschaft nationalsozialistischer Kunst-
und Antiquitätenhändler Deutschlands“ hat sich
angeschlossen.
1. Vorsitzender des neugegründeten Verbandes
ist Pg. Herr Adolf Weinmüller, München,
stellvertretender 1. Vorsitzender Herr Walter
Fritzsche, Berlin, 2. Vorsitzender Herr
Dr. Sauermann i. Fa. J. Böhler, München.
Der „Deutsche Reichsverband des Kunst- und
Antiquitätenhandels e. V. München“ hat die Or-
ganisation des alten Reichsverbandes des deut-
schen Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. Mün-
chen, die eine regionale und fachliche Gliederung
vorsieht, übernommen.
Es ist äußerst zu begrüßen, daß durch diese
endgültige und restlose Zusammenfassung des ge-
samten Kunst- und Antiquitätenhandels im Deut-
schen Reich, die Vorarbeit für den Ständischen
Aufbau durchgeführt ist.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h a r d D e u s c h. — Red.-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77? zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19.