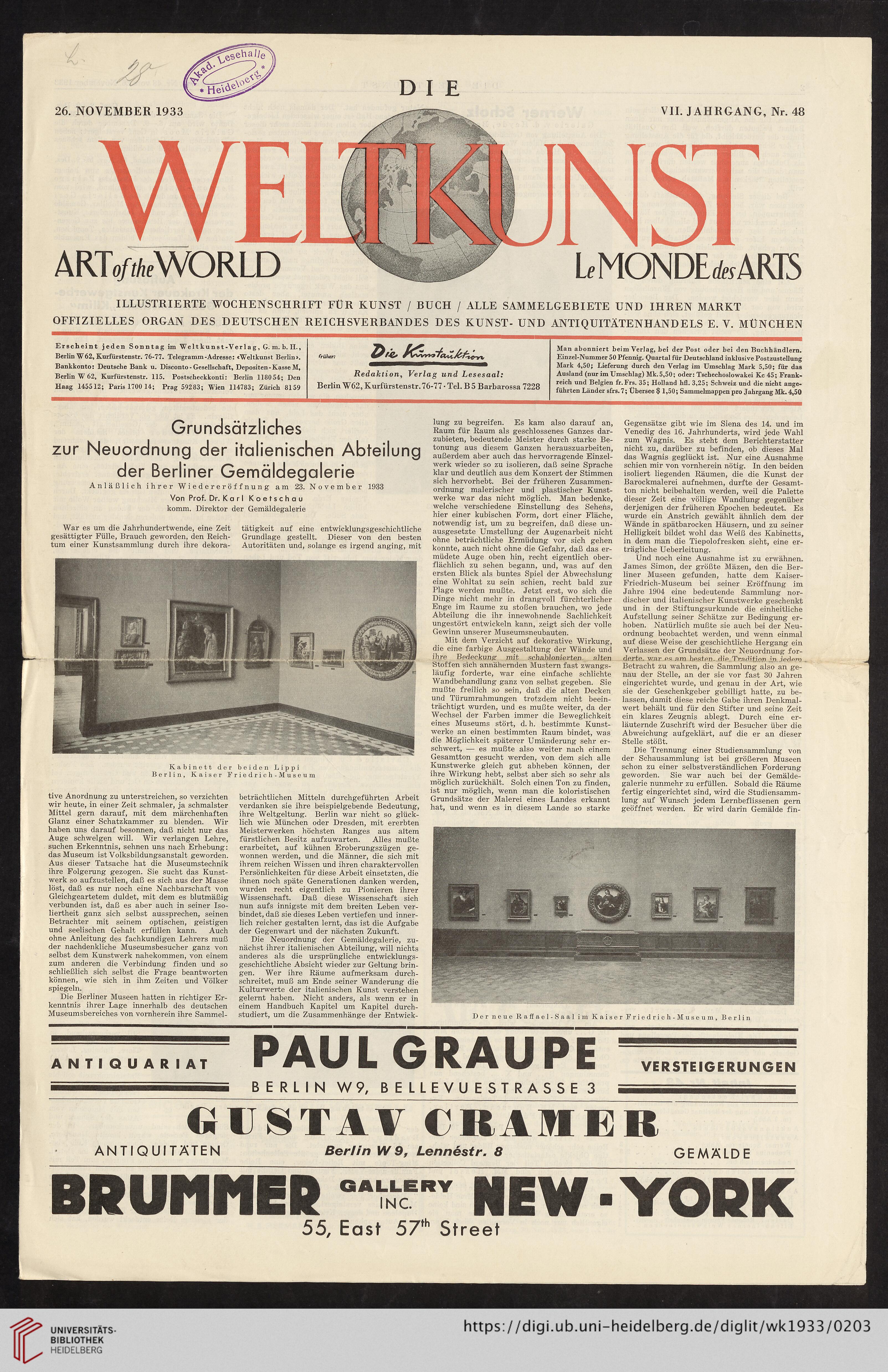26. NOVEMBER 1933
VII. JAHRGANG, Nr. 48
ILLUSTRIERTE WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST / BUCH / ALLE SAMMELGEBIETE UND IHREN MARKT
OFFIZIELLES ORGAN DES DEUTSCHEN REICHSVERBANDES DES KUNST- UND ANTIQUITÄTEN HAN DE LS E. V. MÜNCHEN
Erscheint jeden Sonntag im Weltkunst-Verlag, G. m. b. II.,
Berlin W62, Kurfürstenstr. 76-77. Telegramm-Adresse: «Weltkunst Berlin».
Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto - Gesellschaft, Depositen - Kasse M,
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 115. Postscheckkonti: Berlin 1180 54; Den
Haag 145512; Paris 1700 14; Prag 59283; Wien 114783; Zürich 8159
Redaktion, Verlag und Lesesaal:
Berlin W62, Kurfürstenstr.76-77 • Tel. B 5 Barbarossa 7228
Man abonniert beim Verlag, bei der Post oder bei den Buchhändlern.
Einzel-Nummer 50 Pfennig. Quartal für Deutschland inklusive Postzustellung
Mark 4,50; Lieferung durch den Verlag im Umschlag Mark 5,50; für das
Ausland (nur im Umschlag) Mk.5,50; oder: Tschechoslowakei Kc 45; Frank-
reich und Belgien fr. Frs. 35; Holland hfl. 3,25; Schweiz und die nicht ange-
führten Länder sfrs. 7; Übersee $ 1,50; Sammelmappen pro Jahrgang Mk. 4,50
Grundsätzliches
zur Neuordnung der italienischen Abteilung
der Berliner Gemäldegalerie
Anläßlich ihrer Wiedereröffnung am 23. November 1933
Von Prof. Dr. Karl Koetsch au
komm. Direktor der Gemäldegalerie
War es um die Jahrhundertwende, eine Zeit
gesättigter Fülle, Brauch geworden, den Reich-
tum einer Kunstsammlung durch ihre dekora-
tätigkeit auf eine entwicklungsgeschichtliche
Grundlage gestellt. Dieser von den besten
Autoritäten und, solange es irgend anging, mit
Kabinett der beiden Lippi
Berlin, Kaiser Friedrich-Museum
tive Anordnung zu unterstreichen, so verzichten
wir heute, in einer Zeit schmaler, ja schmälster
Mittel gern darauf, mit dem märchenhaften
Glanz einer Schatzkammer zu blenden. Wir
haben uns darauf besonnen, daß nicht nur das
Auge schwelgen will. Wir verlangen Lehre,
suchen Erkenntnis, sehnen uns nach Erhebung:
das Museum ist Volksbildungsanstalt geworden.
Aus dieser Tatsache hat die Museumstechnik
ihre Folgerung gezogen. Sie sucht das Kunst-
werk so aufzustellen, daß es sich aus der Masse
löst, daß es nur noch eine Nachbarschaft von
Gleichgeartetem duldet, mit dem es blutmäßig
verbunden ist, daß es aber auch in seiner Iso-
liertheit ganz sich selbst aussprechen, seinen
Betrachter mit seinem optischen, geistigen
und seelischen Gehalt erfüllen kann. Auch
ohne Anleitung des fachkundigen Lehrers muß
der nachdenkliche Museumsbesucher ganz von
selbst dem Kunstwerk nahekommen, von einem
zum anderen die Verbindung finden und so
schließlich sich selbst die Frage beantworten
können, wie sich in ihm Zeiten und Völker
spiegeln.
Die Berliner Museen hatten in richtiger Er-
kenntnis ihrer Lage innerhalb des deutschen
Museumsbereiches von vornherein ihre Sammel-
beträchtlichen Mitteln durchgeführten Arbeit
verdanken sie ihre beispielgebende Bedeutung,
ihre Weltgeltung. Berlin war nicht so glück-
lich wie München oder Dresden, mit ererbten
Meisterwerken höchsten Ranges aus altem
fürstlichen Besitz aufzuwarten. Alles mußte
erarbeitet, auf kühnen Eroberungszügen ge-
wonnen werden, und die Männer, die sich mit
ihrem reichen Wissen und ihren charaktervollen
Persönlichkeiten für diese Arbeit einsetzten, die
ihnen noch späte Generationen danken werden,
wurden recht eigentlich zu Pionieren ihrer
Wissenschaft. Daß diese Wissenschaft sich
nun aufs innigste mit dem breiten Leben ver-
bindet, daß sie dieses Leben vertiefen und inner-
lich reicher gestalten lernt, das ist die Aufgabe
der Gegenwart und der nächsten Zukunft.
Die Neuordnung der Gemäldegalerie, zu-
nächst ihrer italienischen Abteilung, will nichts
anderes als die ursprüngliche entwicklungs-
geschichtliche Absicht wieder zur Geltung brin-
gen. Wer ihre Räume aufmerksam durch-
schreitet, muß am Ende seiner Wanderung die
Kulturwerte der italienischen Kunst verstehen
gelernt haben. Nicht anders, als wenn er in
einem Handbuch Kapitel um Kapitel durch-
studiert, um die Zusammenhänge der Entwick-
lung zu begreifen. Es kam also darauf an,
Raum für Raum als geschlossenes Ganzes dar-
zubieten, bedeutende Meister durch starke Be-
tonung aus diesem Ganzen herauszuarbeiten,
außerdem aber auch das hervorragende Einzel-
werk wieder so zu isolieren, daß seine Sprache
klar und deutlich aus dem Konzert der Stimmen
sich hervorhebt. Bei der früheren Zusammen-
ordnung malerischer und plastischer Kunst-
werke war das nicht möglich. Man bedenke,
welche verschiedene Einstellung des Sehens,
hier einer kubischen Form, dort einer Fläche,
notwendig ist, um zu begreifen, daß diese un-
ausgesetzte Umstellung der Augenarbeit nicht
ohne beträchtliche Ermüdung vor sich gehen
konnte, auch nicht ohne die Gefahr, daß das er-
müdete Auge oben hin, recht eigentlich ober-
flächlich zu sehen begann, und, was auf den
ersten Blick als buntes Spiel der Abwechslung
eine Wohltat zu sein schien, recht bald zur
Plage werden mußte. Jetzt erst, wo sich die
Dinge nicht mehr in drangvoll fürchterlicher
Enge im Raume zu stoßen brauchen, wo jede
Abteilung die ihr innewohnende Sachlichkeit
ungestört entwickeln kann, zeigt sich der volle
Gewinn unserer Museumsneubauten.
Mit dem Verzicht auf dekorative Wirkung,
die eine farbige Ausgestaltung der Wände und
ihre Bedeckung mit schablonierten alten
Stoffen sich annähernden Mustern fast zwangs-
läufig forderte, war eine einfache schlichte
Wandbehandlung ganz von selbst gegeben. Sie
mußte freilich so sein, daß die alten Decken
und Türumrahmungen trotzdem nicht beein-
trächtigt wurden, und es mußte weiter, da der
Wechsel der Farben immer die Beweglichkeit
eines Museums stört, d. h. bestimmte Kunst-
werke an einen bestimmten Raum bindet, was
die Möglichkeit späterer Umänderung sehr er-
schwert, — es mußte also weiter nach einem
Gesamtton gesucht werden, von dem sich alle
Kunstwerke gleich gut abheben können, der
ihre Wirkung hebt, selbst aber sich so sehr als
möglich zurückhält. Solch einen Ton zu finden,
ist nur möglich, wenn man die koloristischen
Grundsätze der Malerei eines Landes erkannt
hat, und wenn es in diesem Lande so starke
Gegensätze gibt wie im Siena des 14. und im
Venedig des 16. Jahrhunderts, wird jede Wahl
zum Wagnis. Es steht dem Berichterstatter
nicht zu, darüber zu befinden, ob dieses Mal
das Wagnis geglückt ist. Nur eine Ausnahme
schien mir von vornherein nötig. In den beiden
isoliert liegenden Räumen, die die Kunst der
Barockmalerei aufnehmen, durfte der Gesamt-
ton nicht beibehalten werden, weil die Palette
dieser Zeit eine völlige Wandlung gegenüber
derjenigen der früheren Epochen bedeutet. Es
wurde ein Anstrich gewählt ähnlich dem der
Wände in spätbarocken Häusern, und zu seiner
Helligkeit bildet wohl das Weiß des Kabinetts,
in dem man die Tiepolofresken sieht, eine er-
trägliche Ueberleitung.
Und noch eine Ausnahme ist zu erwähnen.
James Simon, der größte Mäzen, den die Ber-
liner Museen gefunden, hatte dem Kaiser-
Friedrich-Museum bei seiner Eröffnung im
Jahre 1904 eine bedeutende Sammlung nor-
discher und italienischer Kunstwerke geschenkt
und in der Stiftungsurkunde die einheitliche
Aufstellung seiner Schätze zur Bedingung er-
hoben. Natürlich mußte sie auch bei der Neu-
ordnung beobachtet werden, und wenn einmal
auf diese Weise der geschichtliche Hergang ein
Verlassen der Grundsätze der Neuordnung for-
derte- war es am besten, die Tradition 'n iedem
Betracht zu wahren, die Sammlung also an ge-
nau der Stelle, an der sie vor fast 30 Jahren
eingerichtet wurde, und genau in der Art, wie
sie der Geschenkgeber gebilligt hatte, zu be-
lassen, damit diese reiche Gabe ihren Denkmal-
wert behält und für den Stifter und seine Zeit
ein klares Zeugnis ablegt. Durch eine er-
läuternde Zuschrift wird der Besucher über die
Abweichung aufgeklärt, auf die er an dieser
Stelle stößt.
Die Trennung einer Studiensammlung von
der Schausammlung ist bei größeren Museen
schon zu einer selbstverständlichen Forderung
geworden. Sie war auch bei der Gemälde-
galerie nunmehr zu erfüllen. Sobald die Räume
fertig eingerichtet sind, wird die Studiensamm-
lung auf Wunsch jedem Lernbeflissenen gern
geöffnet werden. Er wird darin Gemälde fin-
Der neue Raffael-Saal im Kaiser Friedrich- Museum, Berlin
ANTIQUARIAT
PAUL GRAUPE
VERSTEIGERUNGEN
BERLIN W 9, BELLEVUESTRASSE 3 ...... i
GUSTAV CRAMER
ANTIQUITÄTEN
Berlin IV 9, Lennestr. 8
GEMÄLDE
BRUNNER NEW-YORK
55, East 57th Street
VII. JAHRGANG, Nr. 48
ILLUSTRIERTE WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST / BUCH / ALLE SAMMELGEBIETE UND IHREN MARKT
OFFIZIELLES ORGAN DES DEUTSCHEN REICHSVERBANDES DES KUNST- UND ANTIQUITÄTEN HAN DE LS E. V. MÜNCHEN
Erscheint jeden Sonntag im Weltkunst-Verlag, G. m. b. II.,
Berlin W62, Kurfürstenstr. 76-77. Telegramm-Adresse: «Weltkunst Berlin».
Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto - Gesellschaft, Depositen - Kasse M,
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 115. Postscheckkonti: Berlin 1180 54; Den
Haag 145512; Paris 1700 14; Prag 59283; Wien 114783; Zürich 8159
Redaktion, Verlag und Lesesaal:
Berlin W62, Kurfürstenstr.76-77 • Tel. B 5 Barbarossa 7228
Man abonniert beim Verlag, bei der Post oder bei den Buchhändlern.
Einzel-Nummer 50 Pfennig. Quartal für Deutschland inklusive Postzustellung
Mark 4,50; Lieferung durch den Verlag im Umschlag Mark 5,50; für das
Ausland (nur im Umschlag) Mk.5,50; oder: Tschechoslowakei Kc 45; Frank-
reich und Belgien fr. Frs. 35; Holland hfl. 3,25; Schweiz und die nicht ange-
führten Länder sfrs. 7; Übersee $ 1,50; Sammelmappen pro Jahrgang Mk. 4,50
Grundsätzliches
zur Neuordnung der italienischen Abteilung
der Berliner Gemäldegalerie
Anläßlich ihrer Wiedereröffnung am 23. November 1933
Von Prof. Dr. Karl Koetsch au
komm. Direktor der Gemäldegalerie
War es um die Jahrhundertwende, eine Zeit
gesättigter Fülle, Brauch geworden, den Reich-
tum einer Kunstsammlung durch ihre dekora-
tätigkeit auf eine entwicklungsgeschichtliche
Grundlage gestellt. Dieser von den besten
Autoritäten und, solange es irgend anging, mit
Kabinett der beiden Lippi
Berlin, Kaiser Friedrich-Museum
tive Anordnung zu unterstreichen, so verzichten
wir heute, in einer Zeit schmaler, ja schmälster
Mittel gern darauf, mit dem märchenhaften
Glanz einer Schatzkammer zu blenden. Wir
haben uns darauf besonnen, daß nicht nur das
Auge schwelgen will. Wir verlangen Lehre,
suchen Erkenntnis, sehnen uns nach Erhebung:
das Museum ist Volksbildungsanstalt geworden.
Aus dieser Tatsache hat die Museumstechnik
ihre Folgerung gezogen. Sie sucht das Kunst-
werk so aufzustellen, daß es sich aus der Masse
löst, daß es nur noch eine Nachbarschaft von
Gleichgeartetem duldet, mit dem es blutmäßig
verbunden ist, daß es aber auch in seiner Iso-
liertheit ganz sich selbst aussprechen, seinen
Betrachter mit seinem optischen, geistigen
und seelischen Gehalt erfüllen kann. Auch
ohne Anleitung des fachkundigen Lehrers muß
der nachdenkliche Museumsbesucher ganz von
selbst dem Kunstwerk nahekommen, von einem
zum anderen die Verbindung finden und so
schließlich sich selbst die Frage beantworten
können, wie sich in ihm Zeiten und Völker
spiegeln.
Die Berliner Museen hatten in richtiger Er-
kenntnis ihrer Lage innerhalb des deutschen
Museumsbereiches von vornherein ihre Sammel-
beträchtlichen Mitteln durchgeführten Arbeit
verdanken sie ihre beispielgebende Bedeutung,
ihre Weltgeltung. Berlin war nicht so glück-
lich wie München oder Dresden, mit ererbten
Meisterwerken höchsten Ranges aus altem
fürstlichen Besitz aufzuwarten. Alles mußte
erarbeitet, auf kühnen Eroberungszügen ge-
wonnen werden, und die Männer, die sich mit
ihrem reichen Wissen und ihren charaktervollen
Persönlichkeiten für diese Arbeit einsetzten, die
ihnen noch späte Generationen danken werden,
wurden recht eigentlich zu Pionieren ihrer
Wissenschaft. Daß diese Wissenschaft sich
nun aufs innigste mit dem breiten Leben ver-
bindet, daß sie dieses Leben vertiefen und inner-
lich reicher gestalten lernt, das ist die Aufgabe
der Gegenwart und der nächsten Zukunft.
Die Neuordnung der Gemäldegalerie, zu-
nächst ihrer italienischen Abteilung, will nichts
anderes als die ursprüngliche entwicklungs-
geschichtliche Absicht wieder zur Geltung brin-
gen. Wer ihre Räume aufmerksam durch-
schreitet, muß am Ende seiner Wanderung die
Kulturwerte der italienischen Kunst verstehen
gelernt haben. Nicht anders, als wenn er in
einem Handbuch Kapitel um Kapitel durch-
studiert, um die Zusammenhänge der Entwick-
lung zu begreifen. Es kam also darauf an,
Raum für Raum als geschlossenes Ganzes dar-
zubieten, bedeutende Meister durch starke Be-
tonung aus diesem Ganzen herauszuarbeiten,
außerdem aber auch das hervorragende Einzel-
werk wieder so zu isolieren, daß seine Sprache
klar und deutlich aus dem Konzert der Stimmen
sich hervorhebt. Bei der früheren Zusammen-
ordnung malerischer und plastischer Kunst-
werke war das nicht möglich. Man bedenke,
welche verschiedene Einstellung des Sehens,
hier einer kubischen Form, dort einer Fläche,
notwendig ist, um zu begreifen, daß diese un-
ausgesetzte Umstellung der Augenarbeit nicht
ohne beträchtliche Ermüdung vor sich gehen
konnte, auch nicht ohne die Gefahr, daß das er-
müdete Auge oben hin, recht eigentlich ober-
flächlich zu sehen begann, und, was auf den
ersten Blick als buntes Spiel der Abwechslung
eine Wohltat zu sein schien, recht bald zur
Plage werden mußte. Jetzt erst, wo sich die
Dinge nicht mehr in drangvoll fürchterlicher
Enge im Raume zu stoßen brauchen, wo jede
Abteilung die ihr innewohnende Sachlichkeit
ungestört entwickeln kann, zeigt sich der volle
Gewinn unserer Museumsneubauten.
Mit dem Verzicht auf dekorative Wirkung,
die eine farbige Ausgestaltung der Wände und
ihre Bedeckung mit schablonierten alten
Stoffen sich annähernden Mustern fast zwangs-
läufig forderte, war eine einfache schlichte
Wandbehandlung ganz von selbst gegeben. Sie
mußte freilich so sein, daß die alten Decken
und Türumrahmungen trotzdem nicht beein-
trächtigt wurden, und es mußte weiter, da der
Wechsel der Farben immer die Beweglichkeit
eines Museums stört, d. h. bestimmte Kunst-
werke an einen bestimmten Raum bindet, was
die Möglichkeit späterer Umänderung sehr er-
schwert, — es mußte also weiter nach einem
Gesamtton gesucht werden, von dem sich alle
Kunstwerke gleich gut abheben können, der
ihre Wirkung hebt, selbst aber sich so sehr als
möglich zurückhält. Solch einen Ton zu finden,
ist nur möglich, wenn man die koloristischen
Grundsätze der Malerei eines Landes erkannt
hat, und wenn es in diesem Lande so starke
Gegensätze gibt wie im Siena des 14. und im
Venedig des 16. Jahrhunderts, wird jede Wahl
zum Wagnis. Es steht dem Berichterstatter
nicht zu, darüber zu befinden, ob dieses Mal
das Wagnis geglückt ist. Nur eine Ausnahme
schien mir von vornherein nötig. In den beiden
isoliert liegenden Räumen, die die Kunst der
Barockmalerei aufnehmen, durfte der Gesamt-
ton nicht beibehalten werden, weil die Palette
dieser Zeit eine völlige Wandlung gegenüber
derjenigen der früheren Epochen bedeutet. Es
wurde ein Anstrich gewählt ähnlich dem der
Wände in spätbarocken Häusern, und zu seiner
Helligkeit bildet wohl das Weiß des Kabinetts,
in dem man die Tiepolofresken sieht, eine er-
trägliche Ueberleitung.
Und noch eine Ausnahme ist zu erwähnen.
James Simon, der größte Mäzen, den die Ber-
liner Museen gefunden, hatte dem Kaiser-
Friedrich-Museum bei seiner Eröffnung im
Jahre 1904 eine bedeutende Sammlung nor-
discher und italienischer Kunstwerke geschenkt
und in der Stiftungsurkunde die einheitliche
Aufstellung seiner Schätze zur Bedingung er-
hoben. Natürlich mußte sie auch bei der Neu-
ordnung beobachtet werden, und wenn einmal
auf diese Weise der geschichtliche Hergang ein
Verlassen der Grundsätze der Neuordnung for-
derte- war es am besten, die Tradition 'n iedem
Betracht zu wahren, die Sammlung also an ge-
nau der Stelle, an der sie vor fast 30 Jahren
eingerichtet wurde, und genau in der Art, wie
sie der Geschenkgeber gebilligt hatte, zu be-
lassen, damit diese reiche Gabe ihren Denkmal-
wert behält und für den Stifter und seine Zeit
ein klares Zeugnis ablegt. Durch eine er-
läuternde Zuschrift wird der Besucher über die
Abweichung aufgeklärt, auf die er an dieser
Stelle stößt.
Die Trennung einer Studiensammlung von
der Schausammlung ist bei größeren Museen
schon zu einer selbstverständlichen Forderung
geworden. Sie war auch bei der Gemälde-
galerie nunmehr zu erfüllen. Sobald die Räume
fertig eingerichtet sind, wird die Studiensamm-
lung auf Wunsch jedem Lernbeflissenen gern
geöffnet werden. Er wird darin Gemälde fin-
Der neue Raffael-Saal im Kaiser Friedrich- Museum, Berlin
ANTIQUARIAT
PAUL GRAUPE
VERSTEIGERUNGEN
BERLIN W 9, BELLEVUESTRASSE 3 ...... i
GUSTAV CRAMER
ANTIQUITÄTEN
Berlin IV 9, Lennestr. 8
GEMÄLDE
BRUNNER NEW-YORK
55, East 57th Street