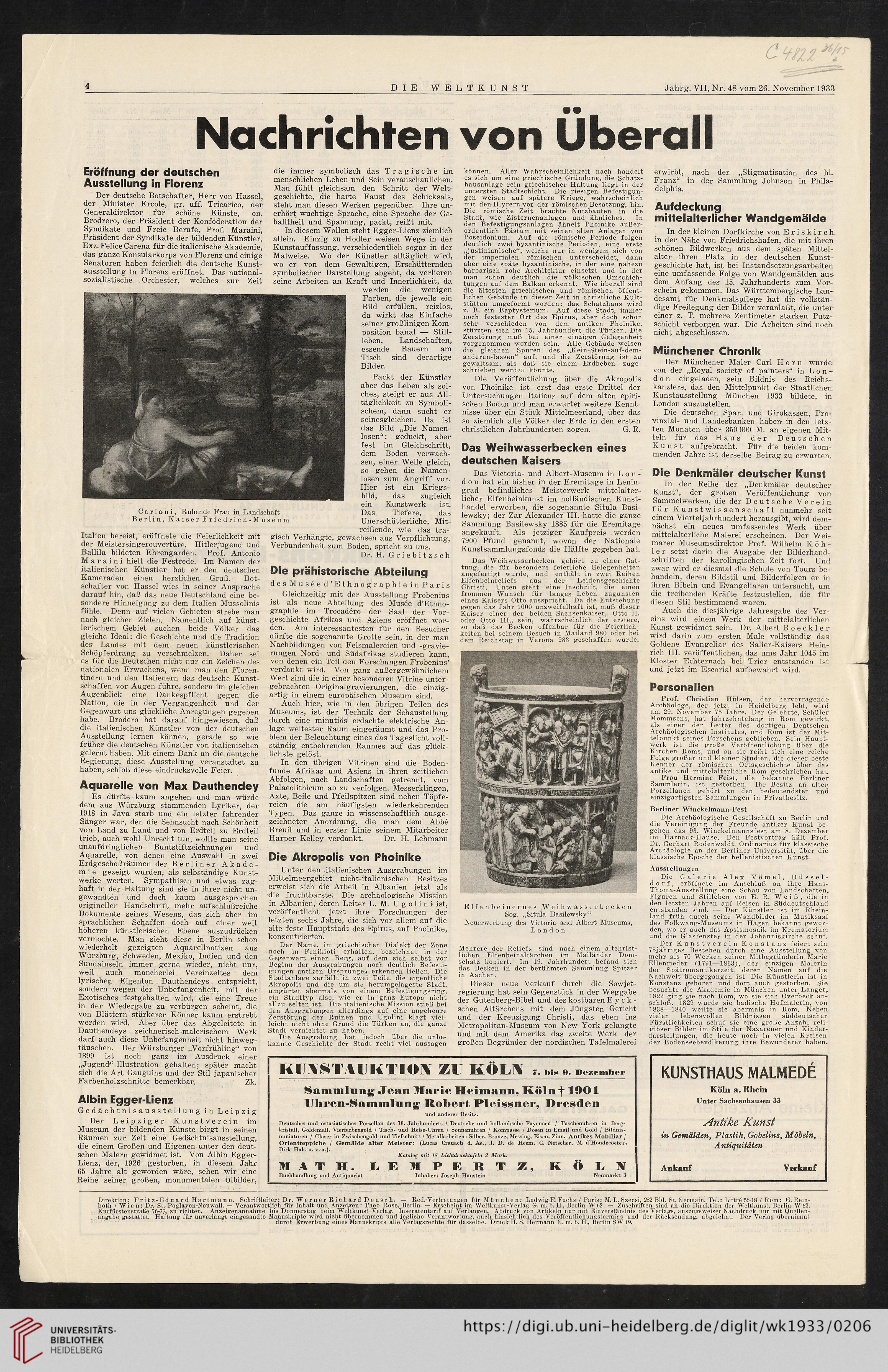4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 48 vom 26. November 1933
• •
Nachrichten von Überall
Eröffnung der deutschen
Ausstellung in Florenz
Der deutsche Botschafter, Herr von Hassel,
der Minister Ercole, gr. uff. Tricarico, der
Generaldirektor für schöne Künste, on.
Brodrero, der Präsident der Konföderation der
Syndikate und Freie Berufe, Prof. Maraini,
Präsident der Syndikate der bildenden Künstler,
Exz. Felice Carena für die italienische Akademie,
das ganze Konsularkorps von Florenz und einige
Senatoren haben feierlich die deutsche Kunst-
ausstellung in Florenz eröffnet. Das national-
sozialistische Orchester, welches zur Zeit
die immer symbolisch das Tragische im
menschlichen Leben und Sein veranschaulichen.
Man fühlt gleichsam den Schritt der Welt-
geschichte, die harte Faust des Schicksals,
steht man diesen Werken gegenüber. Ihre un-
erhört wuchtige Sprache, eine Sprache der Ge-
balltheit und Spannung, packt, reißt mit.
In diesem Wollen steht Egger-Lienz ziemlich
allein. Einzig zu Hodler weisen Wege in der
Kunstauffassung, verschiedentlich sogar in der
Malweise. Wo der Künstler alltäglich wird,
wo er von dem Gewaltigen, Erschütternden
symbolischer Darstellung abgeht, da verlieren
seine Arbeiten an Kraft und Innerlichkeit, da
C a r i a n i, Ruhende Frau in Landschaft
Berlin, Kaiser Friedrich- Museum
werden die wenigen
Farben, die jeweils ein
Bild erfüllen, reizlos,
da wirkt das Einfache
seiner großlinigen Kom-
position banal — Still-
leben, Landschaften,
essende Bauern am
Tisch sind derartige
Bilder.
Packt der Künstler
aber das Leben als sol-
ches, steigt er aus All-
täglichkeit zu Symboli-
schem, dann sucht er
seinesgleichen. Da ist
das Bild „Die Namen-
losen“ : geduckt, aber
fest im Gleichschritt,
dem Boden verwach-
sen, einer Welle gleich,
so gehen die Namen-
losen zum Angriff vor.
Hier ist ein Kriegs-
bild, das zugleich
ein Kunstwerk ist.
Das Tiefere, das
Unerschütterliche, Mit-
Italien bereist, eröffnete die Feierlichkeit mit
der Meistersingerouvertüre. Hitlerjugend und
Bailila bildeten Ehrengarden. Prof. Antonio
Maraini hielt die Festrede. Im Namen der
italienischen Künstler bot er den deutschen
Kameraden einen herzlichen Gruß. Bot-
schafter von Hassel wies in seiner Ansprache
darauf hin, daß das neue Deutschland eine be-
sondere Hinneigung zu dem Italien Mussolinis
fühle. Denn auf vielen Gebieten strebe man
nach gleichen Zielen. Namentlich auf künst-
lerischem Gebiet suchen beide Völker das
gleiche Ideal: die Geschichte und die Tradition
des Landes mit dem neuen künstlerischen
Schöpferdrang zu verschmelzen. Daher sei
es für die Deutschen nicht nur ein Zeichen des
nationalen Erwachens, wenn man den Floren-
tinern und den Italienern das deutsche Kunst-
schaffen vor Augen führe, sondern im gleichen
Augenblick eine Dankespflicht gegen die
Nation, die in der Vergangenheit und der
Gegenwart uns glückliche Anregungen gegeben
habe. Brodero hat darauf hingewiesen, daß
die italienischen Künstler von der deutschen
Ausstellung lernen können, gerade so wie
früher die deutschen Künstler von italienischen
gelernt haben. Mit einem Dank an die deutsche
Regierung, diese Ausstellung veranstaltet zu
haben, schloß diese eindrucksvolle Feier.
Aquarelle von Max Dauthendey
Es dürfte kaum angehen und man würde
dem aus Würzburg stammenden Lyriker, der
1918 in Java starb und ein letzter fahrender
Sänger war, den die Sehnsucht nach Schönheit
von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil
trieb, auch wohl Unrecht tun, wollte man seine
unaufdringlichen Buntstiftzeichnungen und
Aquarelle, von denen eine Auswahl in zwei
Erdgeschoßräumen der Berliner Akade-
m i e gezeigt wurden, als selbständige Kunst-
werke werten. Sympathisch und etwas zag-
haft in der Haltung sind sie in ihrer nicht un-
gewandten und doch kaum ausgesprochen
originellen Handschrift mehr aufschlußreiche
Dokumente seines Wesens, das sich aber im
sprachlichen Schaffen doch auf einer weit
höheren künstlerischen Ebene auszudrücken
vermochte. Man sieht diese in Berlin schon
wiederholt gezeigten Aquarellnotizen aus
Würzburg, Schweden, Mexiko, Indien und den
Sundainseln immer gerne wieder, nicht nur,
weil auch mancherlei Vereinzeltes dem
lyrischen Eigenton Dauthendeys entspricht,
sondern wegen der Unbefangenheit, mit der
Exotisches festgehalten wird, die eine Treue
in der Wiedergabe zu verbürgen scheint, die
von Blättern stärkerer Könner kaum erstrebt
werden wird. Aber über das Abgeleitete in
Dauthendeys zeichnerisch-malerischem Werk
darf auch diese Unbefangenheit nicht hinweg-
täuschen. Der Würzburger „Vorfrühling“ von
reißende, wie das tra-
gisch Verhängte, gewachsen aus Verpflichtung,
Verbundenheit zum Boden, spricht zu uns.
Dr. H. Griebitzsch
Die prähistorische Abteilung
des Musee d’Ethnographie in Paris
Gleichzeitig mit der Ausstellung Frobenius
ist als neue Abteilung des Musee d’Ethno-
graphie im Trocadero der Saal der Vor-
geschichte Afrikas und Asiens eröffnet wor-
den. Am interessantesten für den Besucher
dürfte die sogenannte Grotte sein, in der man
Nachbildungen von Felsmalereien und -gravie-
rungen Nord- und Südafrikas studieren kann,
von denen ein Teil den Forschungen Frobenius’
verdankt wird. Von ganz außergewöhnlichem
Wert sind die in einer besonderen Vitrine unter-
gebrachten Originalgravierungen, die einzig-
artig in einem europäischen Museum sind.
Auch hier, wie in den übrigen Teilen des
Museums, ist der Technik der Schaustellung
durch eine minutiös erdachte elektrische An-
lage weitester Raum eingeräumt und das Pro-
blem der Beleuchtung eines das Tageslicht voll-
ständig entbehrenden Raumes auf das glück-
lichste gelöst.
In den übrigen Vitrinen sind die Boden-
funde Afrikas und Asiens in ihren zeitlichen
Abfolgen, nach Landschaften getrennt, vom
Palaeolithicum ab zu verfolgen. Messerklingen,
Äxte, Beile und Pfeilspitzen sind neben Töpfe-
reien die am häufigsten wiederkehrenden
Typen. Das ganze in wissenschaftlich ausge-
zeichneter Anordnung, die man dem Abbe
Breuil und in erster Linie seinem Mitarbeiter
Harper Kelley verdankt. Dr. H. Lehmann
Die Akropolis von Phoinike
Unter den italienischen Ausgrabungen im
Mittelmeergebiet nicht-italienischen Besitzes
erweist sich die Arbeit in Albanien jetzt als
die fruchtbarste. Die archäologische Mission
in Albanien, deren Leiter L. M. U g o 1 i n i ist,
veröffentlicht jetzt ihre Forschungen der
letzten sechs Jahre, die sich vor allem auf die
alte feste Hauptstadt des Epirus, auf Phoinike,
konzentrierten.
Der Name, im griechischen Dialekt der Zone
noch in Fenikioti erhalten, bezeichnet in der
Gegenwart einen Berg, auf dem sich selbst vor
Beginn der Ausgrabungen noch deutlich Befesti-
gungen antiken Ursprunges erkennen ließen. Die
Stadtanlage zerfällt in zwei Teile, die eigentliche
Akropolis und die um sie herumgelagerte Stadt,
umgürtet abermals von einem Befestigungsring,
ein Stadttyp also, wie er in ganz Europa nicht
allzu selten ist. Die italienische Mission stieß bei
den Ausgrabungen allerdings auf eine ungeheure
Zerstörung der Ruinen und Ugolini klagt viel-
leicht nicht ohne Grund die Türken an, die ganze
Stadt vernichtet zu haben.
Die Ausgrabung hat jedoch über die unbe-
kannte Geschichte der Stadt recht viel aussagen
können. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt
es sich um eine griechische Gründung, die Schatz-
hausanlage rein griechischer Haltung liegt in der
untersten Stadtschicht. Die riesigen Befestigun-
gen weisen auf spätere Kriege, wahrscheinlich
mit den Illyrern vor der römischen Besatzung, hin.
Die römische Zeit brachte Nutzbauten in die
Stadt, wie Zisternenanlagen und ähnliches. In
den Befestigungsanlagen ähnelt Phoinike außer-
ordentlich Pästum mit seinen alten Anlagen von
Poseidonium. Auf die römische Periode folgen
deutlich zwei byzantinische Perioden, eine erste
„justinianische“, welche nur in wenigem sich von
der imperialen römischen unterscheidet, dann
aber eine späte byzantinische, in der eine nahezu
barbarisch rohe Architektur einsetzt und in der
man schon deutlich die völkischen Umschich-
tungen auf dem Balkan erkennt. Wie überall sind
die ältesten griechischen und römischen öffent-
lichen Gebäude in dieser Zeit in christliche Kult-
stätten umgeformt worden: das Schatzhaus wird
z. B. ein Baptysterium. Auf diese Stadt, immer
noch festester Ort des Epirus, aber doch schon
sehr verschieden von dem antiken Phoinike,
stürzten sich im 15. Jahrhundert die Türken. Die
Zerstörung muß bei einer einzigen Gelegenheit
vorgenommen worden sein. Alle Gebäude weisen
die gleichen Spuren des „Kein-Stein-auf-dem-
anderen-lassen“ auf, und die Zerstörung ist zu
gewaltsam, als daß sie einem Erdbeben zuge-
schrieben werden könnte.
Die Veröffentlichung über die Akropolis
von Phoinike ist erst das erste Drittel der
Untersuchungen Italiens auf dem alten epiri-
schen Boden und man erwartet weitere Kennt-
nisse über ein Stück Mittelmeerland, über das
so ziemlich alle Völker der Erde in den ersten
christlichen Jahrhunderten zogen. G. R.
Das Weihwasserbecken eines
deutschen Kaisers
Das Victoria- und Albert-Museum in Lon-
don hat ein bisher in der Eremitage in Lenin-
grad befindliches Meisterwerk mittelalter-
licher Elfenbeinkunst im holländischen Kunst-
handel erworben, die sogenannte Situla Basi-
lewsky; der Zar Alexander III. hatte die ganze
Sammlung Basilewsky 1885 für die Eremitage
angekauft. Als jetziger Kaufpreis werden
7900 Pfund genannt, wovon der Nationale
Kunstsammlungsfonds die Hälfte gegeben hat.
Das Weihwasserbecken gehört zu einer Gat-
tung, die für besonders feierliche Gelegenheiten
angefertigt wurde, und enthält in zwei Reihen
Elfenbeinreliefs aus der Leidensgeschichte
Christi. Unten steht eine Inschrift, die einen
frommen Wunsch für langes Leben zugunsten
eines Kaisers Otto ausspricht. Da die Entstehung
gegen das Jahr 1000 unzweifelhaft ist, muß dieser
Kaiser einer der beiden Sachsenkaiser, Otto II.
oder Otto III., sein, wahrscheinlich der erstere,
so daß das Becken offenbar für die Feierlich-
keiten bei seinem Besuch in Mailand 980 oder bei
dem Reichstag in Verona 983 geschaffen wurde.
Elfenbeinernes Weihwasserbecken
Sog. „Situla Basilewsky“
Neuerwerbung des Victoria and Albert Museums,
London
Mehrere der Reliefs sind nach einem altchrist-
lichen Elfenbeinaltärchen im Mailänder Dom-
schatz kopiert. Im 19. Jahrhundert befand sich
das Becken in der berühmten Sammlung Spitzer
in Aachen.
Dieser neue Verkauf durch die Sowjet-
regierung hat sein Gegenstück in der Weggabe
der Gutenberg-Bibel und des kostbaren Eyck-
sehen Altärchens mit dem Jüngsten Gericht
und der Kreuzigung Christi, das eben ins
Metropolitan-Museum von New York gelangte
und mit dem Amerika das zweite Werk der
großen Begründer der nordischen Tafelmalerei
1899 ist noch ganz im Ausdruck einer
„Jugend“-Illustration gehalten; später macht
sich die Art Gauguins und der Stil japanischer
Farbenholzschnitte bemerkbar. Zk.
Albin Egger-Lienz
Gedächtnisausstellung in Leipzig
Der Leipziger Kunstverein im
Museum der bildenden Künste birgt in seinen
Räumen zur Zeit eine Gedächtnisausstellung,
die einem Großen und Eigenen unter den deut-
schen Malern gewidmet ist. Von Albin Egger-
Lienz, der, 1926 gestorben, in diesem Jahr
65 Jahre alt geworden wäre, sehen wir eine
Reihe seiner großen, monumentalen Ölbilder,
KU1¥STA<JKTIO1¥ ZU KÖI \ 7. bis 9. Ilezembei*
Sammlung Jean Marie Heimann, Kölnf 1901
Uhren-Sammlung Robert Pleissner, Dresden
und anderer Besitz.
Deutsches und ostasiatisches Porzellan des 18. Jahrhunderts / Deutsche und holländische Fayencen / Taschenuhren in Berg-
kristall, Goldemail, Vierfarbengold / Tisch- und Reise-Uhren / Sonnenuhren / Kompasse / Dosen in Email und Gold / Bildnis-
miniaturen / Gläser in Zwischengold und Tiefschnitt / Metallarbeiten: Silber, Bronze, Messing, Eisen, Zinn. Antikes Mobiliar /
Orientteppiche / Gemälde alter Meister: (Lucas Cranach d. Ae., J. D. de Heem, C. Netscher, M. d’Hondecoeter»
Dirk Hals u. v. a.).
Katalog mit 18 Lichtdrucktafeln 2 Mark.
MATH. EEMPERTZ, K Ö D >
Buchhandlung und Antiquariat Inhaber: Joseph Haustein Neumarkt 3
erwirbt, nach der „Stigmatisation des hl.
Franz“ in der Sammlung Johnson in Phila-
delphia.
Aufdeckung
mittelalterlicher Wandgemälde
In der kleinen Dorfkirche von Eriskirch
in der Nähe von Friedrichshafen, die mit ihren
schönen Bildwerken aus dem späten Mittel-
alter ihren Platz in der deutschen Kunst-
geschichte hat, ist bei Instandsetzungsarbeiten
eine umfassende Folge von Wandgemälden aus
dem Anfang des 15. Jahrhunderts zum Vor-
schein gekommen. Das Württembergische Lan-
desamt für Denkmalspflege hat die vollstän-
dige Freilegung der Bilder veranlaßt, die unter
einer z. T. mehrere Zentimeter starken Putz-
schicht verborgen war. Die Arbeiten sind noch
nicht abgeschlossen.
Münchener Chronik
Der Münchener Maler Carl Horn wurde
von der „Royal society of painters“ in Lon-
don eingeladen, sein Bildnis des Reichs-
kanzlers, das den Mittelpunkt der Staatlichen.
Kunstausstellung München 1933 bildete, in
London auszustellen.
Die deutschen Spar- und Girokassen, Pro-
vinzial- und Landesbanken haben in den letz-
ten Monaten über 350 000 M. an eigenen Mit-
teln für das Haus der Deutschen
Kunst aufgebracht. Für die beiden kom-
menden Jahre ist derselbe Betrag zu erwarten.
Die Denkmäler deutscher Kunst
In der Reihe der „Denkmäler deutscher
Kunst“, der großen Veröffentlichung von
Sammelwerken, die der Deutsche Verein
für Kunstwissenschaft nunmehr seit
einem Vierteljahrhundert herausgibt, wird dem-
nächst ein neues umfassendes Werk über
mittelalterliche Malerei erscheinen. Der Wei-
marer Museumsdirektor Prof. Wilhelm Köh-
1 e r setzt darin die Ausgabe der Bilderhand-
schriften der karolingischen Zeit fort. Und
zwar wird er diesmal die Schule von Tours be-
handeln, deren Bildstil und Bilderfolgen er in
ihren Bibeln und Evangeliaren untersucht, um
die treibenden Kräfte festzustellen, die für
diesen Stil bestimmend waren.
Auch die diesjährige Jahresgabe des Ver-
eins wird einem Werk der mittelalterlichen
Kunst gewidmet sein. Dr. Albert B o e c k 1 e r
wird darin zum ersten Male vollständig das
Goldene Evangeliar des Salier-Kaisers Hein-
rich III. veröffentlichen, das ums Jahr 1045 im
Kloster Echternach bei Trier entstanden ist
und jetzt im Escorial aufbewahrt wird.
Personalien
Prof. Christian Hülsen, der hervorragende
Archäologe, der jetzt in Heidelberg lebt, wird
am 29. November 75 Jahre. Der Gelehrte, Schüler
Mommsens, hat jahrzehntelang in Rom gewirkt,
als einer der Leiter des dortigen Deutschen
Archäologischen Institutes, und Rom ist der Mit-
telpunkt seines Forschens geblieben. Sein Haupt-
werk ist die große Veröffentlichung über die
Kirchen Roms, und an sie reiht sich eine reiche
Folge großer und kleiner Studien, die dieser beste
Kenner der römischen Oftsgeschichte über das
antike und mittelalterliche Rom geschrieben hat.
Frau Hermine Feist, die bekannte Berliner
Sammlerin, ist gestorben. Ihr Besitz an alten
Porzellanen gehört zu den bedeutendsten und
einzigartigsten Sammlungen in Privatbesitz.
Berliner Winckelmann-Fest
Die Archäologische Gesellschaft zu Berlin und
die Vereinigung der Freunde antiker Kunst be-
gehen das 93. Winckelmannsfest am 8. Dezember
im Harnack-Hause. Den Festvortrag hält Prof.
Dr. Gerhart Rodenwaldt. Ordinarius für klassische
Archäologie an der Berliner Universität, über die
klassische Epoche der hellenistischen Kunst.
Ausstellungen
Die Galerie Alex Vömel, Düssel-
dorf, eröffnete im Anschluß an ihre Hans-
Thoma-Ausstellung eine Schau von Landschaften,
Figuren und Stilleben von E. R. Weiß, die in
den letzten Jahren auf Reisen in Süddeutschland
entstanden sind. — Der Künstler ist im Rhein-
land früh durch seine Wandbilder im Musiksaal
des Folkwang-Museums in Hagen bekannt gewor-
den, wo er auch das Apsismosaik im Krematorium:
und die Glasfenster in der Johanniskirche schuf.
Der Kunstverein Konstanz feiert sein.
75jähriges Bestehen durch eine Ausstellung von
mehr als 70 Werken seiner Mitbegründerin Marie
Ellenrieder (1791—1863), der einzigen Malerin
der Spätromantikerzeit, deren Namen auf die
Nachwelt übergegangen ist Die Künstlerin ist in
Konstanz geboren und dort auch gestorben. Sie
besuchte die Akademie in München unter Langer,
1822 ging sie nach Rom, wo sie sich Overbeck an-
schloß. 1829 wurde sie badische Hofmalerin, von
1838—1840 weilte sie abermals in Rom. Neben
vielen lebensvollen Bildnissen süddeutscher
Fürstlichkeiten schuf sie eine große Anzahl reli-
giöser Bilder im Stile der Nazarener und Kinder-
darstellungen, die heute noch in vielen Kreisen
der Bodenseebevölkerung ihre Bewunderer haben.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Sduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s e h. — Red-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich fiir Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. -- Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln mir mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung fiir unverlangt'eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck II. S. Hermann G. m. b. II., Berlin SW 19.
DIE WELTKUNST
Jahrg. VII, Nr. 48 vom 26. November 1933
• •
Nachrichten von Überall
Eröffnung der deutschen
Ausstellung in Florenz
Der deutsche Botschafter, Herr von Hassel,
der Minister Ercole, gr. uff. Tricarico, der
Generaldirektor für schöne Künste, on.
Brodrero, der Präsident der Konföderation der
Syndikate und Freie Berufe, Prof. Maraini,
Präsident der Syndikate der bildenden Künstler,
Exz. Felice Carena für die italienische Akademie,
das ganze Konsularkorps von Florenz und einige
Senatoren haben feierlich die deutsche Kunst-
ausstellung in Florenz eröffnet. Das national-
sozialistische Orchester, welches zur Zeit
die immer symbolisch das Tragische im
menschlichen Leben und Sein veranschaulichen.
Man fühlt gleichsam den Schritt der Welt-
geschichte, die harte Faust des Schicksals,
steht man diesen Werken gegenüber. Ihre un-
erhört wuchtige Sprache, eine Sprache der Ge-
balltheit und Spannung, packt, reißt mit.
In diesem Wollen steht Egger-Lienz ziemlich
allein. Einzig zu Hodler weisen Wege in der
Kunstauffassung, verschiedentlich sogar in der
Malweise. Wo der Künstler alltäglich wird,
wo er von dem Gewaltigen, Erschütternden
symbolischer Darstellung abgeht, da verlieren
seine Arbeiten an Kraft und Innerlichkeit, da
C a r i a n i, Ruhende Frau in Landschaft
Berlin, Kaiser Friedrich- Museum
werden die wenigen
Farben, die jeweils ein
Bild erfüllen, reizlos,
da wirkt das Einfache
seiner großlinigen Kom-
position banal — Still-
leben, Landschaften,
essende Bauern am
Tisch sind derartige
Bilder.
Packt der Künstler
aber das Leben als sol-
ches, steigt er aus All-
täglichkeit zu Symboli-
schem, dann sucht er
seinesgleichen. Da ist
das Bild „Die Namen-
losen“ : geduckt, aber
fest im Gleichschritt,
dem Boden verwach-
sen, einer Welle gleich,
so gehen die Namen-
losen zum Angriff vor.
Hier ist ein Kriegs-
bild, das zugleich
ein Kunstwerk ist.
Das Tiefere, das
Unerschütterliche, Mit-
Italien bereist, eröffnete die Feierlichkeit mit
der Meistersingerouvertüre. Hitlerjugend und
Bailila bildeten Ehrengarden. Prof. Antonio
Maraini hielt die Festrede. Im Namen der
italienischen Künstler bot er den deutschen
Kameraden einen herzlichen Gruß. Bot-
schafter von Hassel wies in seiner Ansprache
darauf hin, daß das neue Deutschland eine be-
sondere Hinneigung zu dem Italien Mussolinis
fühle. Denn auf vielen Gebieten strebe man
nach gleichen Zielen. Namentlich auf künst-
lerischem Gebiet suchen beide Völker das
gleiche Ideal: die Geschichte und die Tradition
des Landes mit dem neuen künstlerischen
Schöpferdrang zu verschmelzen. Daher sei
es für die Deutschen nicht nur ein Zeichen des
nationalen Erwachens, wenn man den Floren-
tinern und den Italienern das deutsche Kunst-
schaffen vor Augen führe, sondern im gleichen
Augenblick eine Dankespflicht gegen die
Nation, die in der Vergangenheit und der
Gegenwart uns glückliche Anregungen gegeben
habe. Brodero hat darauf hingewiesen, daß
die italienischen Künstler von der deutschen
Ausstellung lernen können, gerade so wie
früher die deutschen Künstler von italienischen
gelernt haben. Mit einem Dank an die deutsche
Regierung, diese Ausstellung veranstaltet zu
haben, schloß diese eindrucksvolle Feier.
Aquarelle von Max Dauthendey
Es dürfte kaum angehen und man würde
dem aus Würzburg stammenden Lyriker, der
1918 in Java starb und ein letzter fahrender
Sänger war, den die Sehnsucht nach Schönheit
von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil
trieb, auch wohl Unrecht tun, wollte man seine
unaufdringlichen Buntstiftzeichnungen und
Aquarelle, von denen eine Auswahl in zwei
Erdgeschoßräumen der Berliner Akade-
m i e gezeigt wurden, als selbständige Kunst-
werke werten. Sympathisch und etwas zag-
haft in der Haltung sind sie in ihrer nicht un-
gewandten und doch kaum ausgesprochen
originellen Handschrift mehr aufschlußreiche
Dokumente seines Wesens, das sich aber im
sprachlichen Schaffen doch auf einer weit
höheren künstlerischen Ebene auszudrücken
vermochte. Man sieht diese in Berlin schon
wiederholt gezeigten Aquarellnotizen aus
Würzburg, Schweden, Mexiko, Indien und den
Sundainseln immer gerne wieder, nicht nur,
weil auch mancherlei Vereinzeltes dem
lyrischen Eigenton Dauthendeys entspricht,
sondern wegen der Unbefangenheit, mit der
Exotisches festgehalten wird, die eine Treue
in der Wiedergabe zu verbürgen scheint, die
von Blättern stärkerer Könner kaum erstrebt
werden wird. Aber über das Abgeleitete in
Dauthendeys zeichnerisch-malerischem Werk
darf auch diese Unbefangenheit nicht hinweg-
täuschen. Der Würzburger „Vorfrühling“ von
reißende, wie das tra-
gisch Verhängte, gewachsen aus Verpflichtung,
Verbundenheit zum Boden, spricht zu uns.
Dr. H. Griebitzsch
Die prähistorische Abteilung
des Musee d’Ethnographie in Paris
Gleichzeitig mit der Ausstellung Frobenius
ist als neue Abteilung des Musee d’Ethno-
graphie im Trocadero der Saal der Vor-
geschichte Afrikas und Asiens eröffnet wor-
den. Am interessantesten für den Besucher
dürfte die sogenannte Grotte sein, in der man
Nachbildungen von Felsmalereien und -gravie-
rungen Nord- und Südafrikas studieren kann,
von denen ein Teil den Forschungen Frobenius’
verdankt wird. Von ganz außergewöhnlichem
Wert sind die in einer besonderen Vitrine unter-
gebrachten Originalgravierungen, die einzig-
artig in einem europäischen Museum sind.
Auch hier, wie in den übrigen Teilen des
Museums, ist der Technik der Schaustellung
durch eine minutiös erdachte elektrische An-
lage weitester Raum eingeräumt und das Pro-
blem der Beleuchtung eines das Tageslicht voll-
ständig entbehrenden Raumes auf das glück-
lichste gelöst.
In den übrigen Vitrinen sind die Boden-
funde Afrikas und Asiens in ihren zeitlichen
Abfolgen, nach Landschaften getrennt, vom
Palaeolithicum ab zu verfolgen. Messerklingen,
Äxte, Beile und Pfeilspitzen sind neben Töpfe-
reien die am häufigsten wiederkehrenden
Typen. Das ganze in wissenschaftlich ausge-
zeichneter Anordnung, die man dem Abbe
Breuil und in erster Linie seinem Mitarbeiter
Harper Kelley verdankt. Dr. H. Lehmann
Die Akropolis von Phoinike
Unter den italienischen Ausgrabungen im
Mittelmeergebiet nicht-italienischen Besitzes
erweist sich die Arbeit in Albanien jetzt als
die fruchtbarste. Die archäologische Mission
in Albanien, deren Leiter L. M. U g o 1 i n i ist,
veröffentlicht jetzt ihre Forschungen der
letzten sechs Jahre, die sich vor allem auf die
alte feste Hauptstadt des Epirus, auf Phoinike,
konzentrierten.
Der Name, im griechischen Dialekt der Zone
noch in Fenikioti erhalten, bezeichnet in der
Gegenwart einen Berg, auf dem sich selbst vor
Beginn der Ausgrabungen noch deutlich Befesti-
gungen antiken Ursprunges erkennen ließen. Die
Stadtanlage zerfällt in zwei Teile, die eigentliche
Akropolis und die um sie herumgelagerte Stadt,
umgürtet abermals von einem Befestigungsring,
ein Stadttyp also, wie er in ganz Europa nicht
allzu selten ist. Die italienische Mission stieß bei
den Ausgrabungen allerdings auf eine ungeheure
Zerstörung der Ruinen und Ugolini klagt viel-
leicht nicht ohne Grund die Türken an, die ganze
Stadt vernichtet zu haben.
Die Ausgrabung hat jedoch über die unbe-
kannte Geschichte der Stadt recht viel aussagen
können. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt
es sich um eine griechische Gründung, die Schatz-
hausanlage rein griechischer Haltung liegt in der
untersten Stadtschicht. Die riesigen Befestigun-
gen weisen auf spätere Kriege, wahrscheinlich
mit den Illyrern vor der römischen Besatzung, hin.
Die römische Zeit brachte Nutzbauten in die
Stadt, wie Zisternenanlagen und ähnliches. In
den Befestigungsanlagen ähnelt Phoinike außer-
ordentlich Pästum mit seinen alten Anlagen von
Poseidonium. Auf die römische Periode folgen
deutlich zwei byzantinische Perioden, eine erste
„justinianische“, welche nur in wenigem sich von
der imperialen römischen unterscheidet, dann
aber eine späte byzantinische, in der eine nahezu
barbarisch rohe Architektur einsetzt und in der
man schon deutlich die völkischen Umschich-
tungen auf dem Balkan erkennt. Wie überall sind
die ältesten griechischen und römischen öffent-
lichen Gebäude in dieser Zeit in christliche Kult-
stätten umgeformt worden: das Schatzhaus wird
z. B. ein Baptysterium. Auf diese Stadt, immer
noch festester Ort des Epirus, aber doch schon
sehr verschieden von dem antiken Phoinike,
stürzten sich im 15. Jahrhundert die Türken. Die
Zerstörung muß bei einer einzigen Gelegenheit
vorgenommen worden sein. Alle Gebäude weisen
die gleichen Spuren des „Kein-Stein-auf-dem-
anderen-lassen“ auf, und die Zerstörung ist zu
gewaltsam, als daß sie einem Erdbeben zuge-
schrieben werden könnte.
Die Veröffentlichung über die Akropolis
von Phoinike ist erst das erste Drittel der
Untersuchungen Italiens auf dem alten epiri-
schen Boden und man erwartet weitere Kennt-
nisse über ein Stück Mittelmeerland, über das
so ziemlich alle Völker der Erde in den ersten
christlichen Jahrhunderten zogen. G. R.
Das Weihwasserbecken eines
deutschen Kaisers
Das Victoria- und Albert-Museum in Lon-
don hat ein bisher in der Eremitage in Lenin-
grad befindliches Meisterwerk mittelalter-
licher Elfenbeinkunst im holländischen Kunst-
handel erworben, die sogenannte Situla Basi-
lewsky; der Zar Alexander III. hatte die ganze
Sammlung Basilewsky 1885 für die Eremitage
angekauft. Als jetziger Kaufpreis werden
7900 Pfund genannt, wovon der Nationale
Kunstsammlungsfonds die Hälfte gegeben hat.
Das Weihwasserbecken gehört zu einer Gat-
tung, die für besonders feierliche Gelegenheiten
angefertigt wurde, und enthält in zwei Reihen
Elfenbeinreliefs aus der Leidensgeschichte
Christi. Unten steht eine Inschrift, die einen
frommen Wunsch für langes Leben zugunsten
eines Kaisers Otto ausspricht. Da die Entstehung
gegen das Jahr 1000 unzweifelhaft ist, muß dieser
Kaiser einer der beiden Sachsenkaiser, Otto II.
oder Otto III., sein, wahrscheinlich der erstere,
so daß das Becken offenbar für die Feierlich-
keiten bei seinem Besuch in Mailand 980 oder bei
dem Reichstag in Verona 983 geschaffen wurde.
Elfenbeinernes Weihwasserbecken
Sog. „Situla Basilewsky“
Neuerwerbung des Victoria and Albert Museums,
London
Mehrere der Reliefs sind nach einem altchrist-
lichen Elfenbeinaltärchen im Mailänder Dom-
schatz kopiert. Im 19. Jahrhundert befand sich
das Becken in der berühmten Sammlung Spitzer
in Aachen.
Dieser neue Verkauf durch die Sowjet-
regierung hat sein Gegenstück in der Weggabe
der Gutenberg-Bibel und des kostbaren Eyck-
sehen Altärchens mit dem Jüngsten Gericht
und der Kreuzigung Christi, das eben ins
Metropolitan-Museum von New York gelangte
und mit dem Amerika das zweite Werk der
großen Begründer der nordischen Tafelmalerei
1899 ist noch ganz im Ausdruck einer
„Jugend“-Illustration gehalten; später macht
sich die Art Gauguins und der Stil japanischer
Farbenholzschnitte bemerkbar. Zk.
Albin Egger-Lienz
Gedächtnisausstellung in Leipzig
Der Leipziger Kunstverein im
Museum der bildenden Künste birgt in seinen
Räumen zur Zeit eine Gedächtnisausstellung,
die einem Großen und Eigenen unter den deut-
schen Malern gewidmet ist. Von Albin Egger-
Lienz, der, 1926 gestorben, in diesem Jahr
65 Jahre alt geworden wäre, sehen wir eine
Reihe seiner großen, monumentalen Ölbilder,
KU1¥STA<JKTIO1¥ ZU KÖI \ 7. bis 9. Ilezembei*
Sammlung Jean Marie Heimann, Kölnf 1901
Uhren-Sammlung Robert Pleissner, Dresden
und anderer Besitz.
Deutsches und ostasiatisches Porzellan des 18. Jahrhunderts / Deutsche und holländische Fayencen / Taschenuhren in Berg-
kristall, Goldemail, Vierfarbengold / Tisch- und Reise-Uhren / Sonnenuhren / Kompasse / Dosen in Email und Gold / Bildnis-
miniaturen / Gläser in Zwischengold und Tiefschnitt / Metallarbeiten: Silber, Bronze, Messing, Eisen, Zinn. Antikes Mobiliar /
Orientteppiche / Gemälde alter Meister: (Lucas Cranach d. Ae., J. D. de Heem, C. Netscher, M. d’Hondecoeter»
Dirk Hals u. v. a.).
Katalog mit 18 Lichtdrucktafeln 2 Mark.
MATH. EEMPERTZ, K Ö D >
Buchhandlung und Antiquariat Inhaber: Joseph Haustein Neumarkt 3
erwirbt, nach der „Stigmatisation des hl.
Franz“ in der Sammlung Johnson in Phila-
delphia.
Aufdeckung
mittelalterlicher Wandgemälde
In der kleinen Dorfkirche von Eriskirch
in der Nähe von Friedrichshafen, die mit ihren
schönen Bildwerken aus dem späten Mittel-
alter ihren Platz in der deutschen Kunst-
geschichte hat, ist bei Instandsetzungsarbeiten
eine umfassende Folge von Wandgemälden aus
dem Anfang des 15. Jahrhunderts zum Vor-
schein gekommen. Das Württembergische Lan-
desamt für Denkmalspflege hat die vollstän-
dige Freilegung der Bilder veranlaßt, die unter
einer z. T. mehrere Zentimeter starken Putz-
schicht verborgen war. Die Arbeiten sind noch
nicht abgeschlossen.
Münchener Chronik
Der Münchener Maler Carl Horn wurde
von der „Royal society of painters“ in Lon-
don eingeladen, sein Bildnis des Reichs-
kanzlers, das den Mittelpunkt der Staatlichen.
Kunstausstellung München 1933 bildete, in
London auszustellen.
Die deutschen Spar- und Girokassen, Pro-
vinzial- und Landesbanken haben in den letz-
ten Monaten über 350 000 M. an eigenen Mit-
teln für das Haus der Deutschen
Kunst aufgebracht. Für die beiden kom-
menden Jahre ist derselbe Betrag zu erwarten.
Die Denkmäler deutscher Kunst
In der Reihe der „Denkmäler deutscher
Kunst“, der großen Veröffentlichung von
Sammelwerken, die der Deutsche Verein
für Kunstwissenschaft nunmehr seit
einem Vierteljahrhundert herausgibt, wird dem-
nächst ein neues umfassendes Werk über
mittelalterliche Malerei erscheinen. Der Wei-
marer Museumsdirektor Prof. Wilhelm Köh-
1 e r setzt darin die Ausgabe der Bilderhand-
schriften der karolingischen Zeit fort. Und
zwar wird er diesmal die Schule von Tours be-
handeln, deren Bildstil und Bilderfolgen er in
ihren Bibeln und Evangeliaren untersucht, um
die treibenden Kräfte festzustellen, die für
diesen Stil bestimmend waren.
Auch die diesjährige Jahresgabe des Ver-
eins wird einem Werk der mittelalterlichen
Kunst gewidmet sein. Dr. Albert B o e c k 1 e r
wird darin zum ersten Male vollständig das
Goldene Evangeliar des Salier-Kaisers Hein-
rich III. veröffentlichen, das ums Jahr 1045 im
Kloster Echternach bei Trier entstanden ist
und jetzt im Escorial aufbewahrt wird.
Personalien
Prof. Christian Hülsen, der hervorragende
Archäologe, der jetzt in Heidelberg lebt, wird
am 29. November 75 Jahre. Der Gelehrte, Schüler
Mommsens, hat jahrzehntelang in Rom gewirkt,
als einer der Leiter des dortigen Deutschen
Archäologischen Institutes, und Rom ist der Mit-
telpunkt seines Forschens geblieben. Sein Haupt-
werk ist die große Veröffentlichung über die
Kirchen Roms, und an sie reiht sich eine reiche
Folge großer und kleiner Studien, die dieser beste
Kenner der römischen Oftsgeschichte über das
antike und mittelalterliche Rom geschrieben hat.
Frau Hermine Feist, die bekannte Berliner
Sammlerin, ist gestorben. Ihr Besitz an alten
Porzellanen gehört zu den bedeutendsten und
einzigartigsten Sammlungen in Privatbesitz.
Berliner Winckelmann-Fest
Die Archäologische Gesellschaft zu Berlin und
die Vereinigung der Freunde antiker Kunst be-
gehen das 93. Winckelmannsfest am 8. Dezember
im Harnack-Hause. Den Festvortrag hält Prof.
Dr. Gerhart Rodenwaldt. Ordinarius für klassische
Archäologie an der Berliner Universität, über die
klassische Epoche der hellenistischen Kunst.
Ausstellungen
Die Galerie Alex Vömel, Düssel-
dorf, eröffnete im Anschluß an ihre Hans-
Thoma-Ausstellung eine Schau von Landschaften,
Figuren und Stilleben von E. R. Weiß, die in
den letzten Jahren auf Reisen in Süddeutschland
entstanden sind. — Der Künstler ist im Rhein-
land früh durch seine Wandbilder im Musiksaal
des Folkwang-Museums in Hagen bekannt gewor-
den, wo er auch das Apsismosaik im Krematorium:
und die Glasfenster in der Johanniskirche schuf.
Der Kunstverein Konstanz feiert sein.
75jähriges Bestehen durch eine Ausstellung von
mehr als 70 Werken seiner Mitbegründerin Marie
Ellenrieder (1791—1863), der einzigen Malerin
der Spätromantikerzeit, deren Namen auf die
Nachwelt übergegangen ist Die Künstlerin ist in
Konstanz geboren und dort auch gestorben. Sie
besuchte die Akademie in München unter Langer,
1822 ging sie nach Rom, wo sie sich Overbeck an-
schloß. 1829 wurde sie badische Hofmalerin, von
1838—1840 weilte sie abermals in Rom. Neben
vielen lebensvollen Bildnissen süddeutscher
Fürstlichkeiten schuf sie eine große Anzahl reli-
giöser Bilder im Stile der Nazarener und Kinder-
darstellungen, die heute noch in vielen Kreisen
der Bodenseebevölkerung ihre Bewunderer haben.
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Sduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s e h. — Red-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich fiir Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. -- Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln mir mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung fiir unverlangt'eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck II. S. Hermann G. m. b. II., Berlin SW 19.