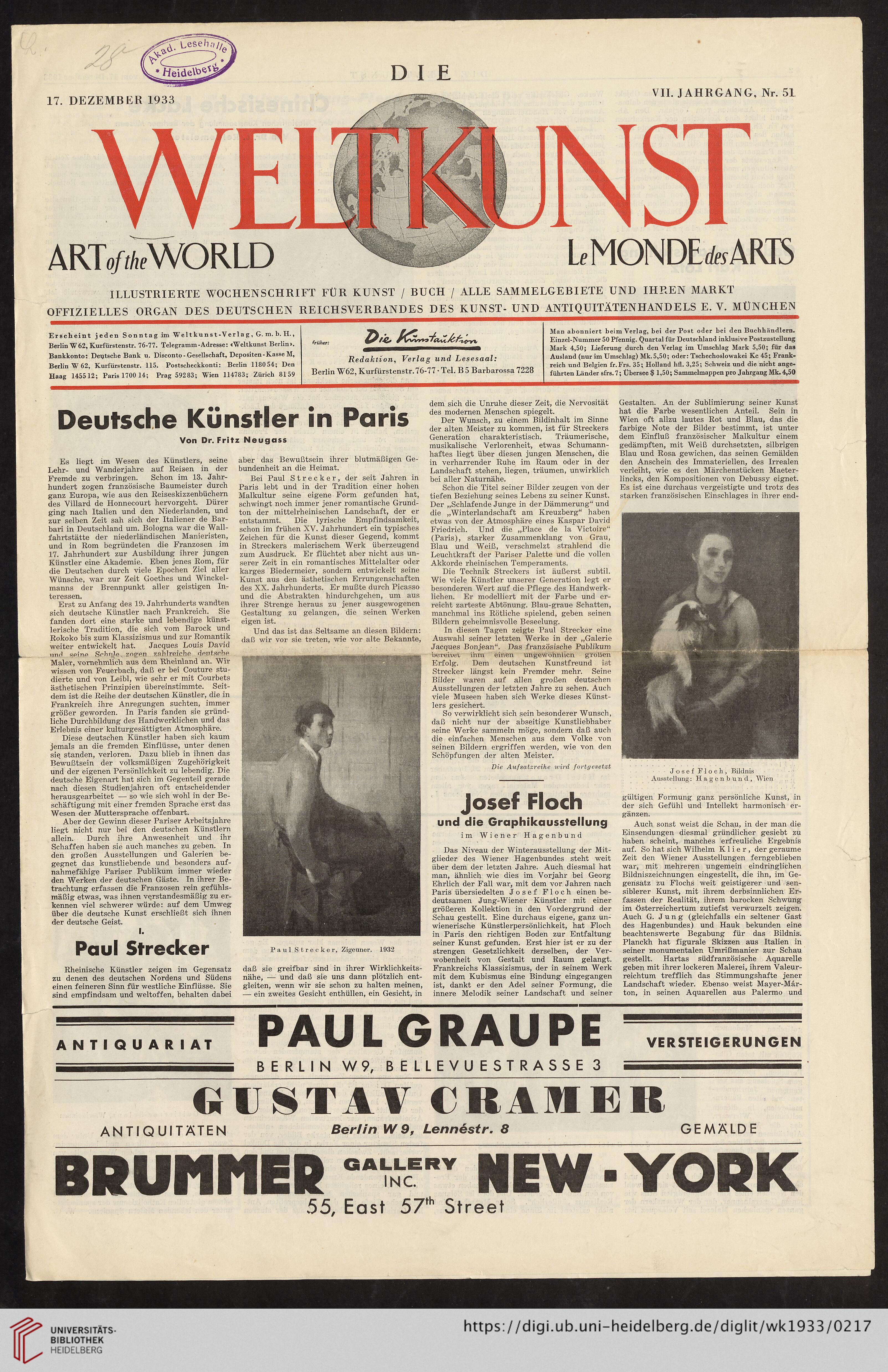17. DEZEMBER 1933
ÄRT^WORLD
VII. JAHRGANG, Nr. 51
N5T
LMONDE*fARTS
ILLUSTRIERTE WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST / BUCH / ALLE SAMMELGEBIETE UND IHREN MARKT
OFFIZIELLES ORGAN DES DEUTSCHEN REICHSVERBANDES DES KUNST- UND ANTIQUITÄTEN HAN DE LS E. V. MÜNCHEN
Erscheint jeden Sonntag im Weltkunst-Verlag, G. m. b. H.,
Berlin W62, Kurfürstenstr. 76-77. Telegramm-Adresse: «Weltkunst Berlin».
Bankkonto: Deijtsche Bank u. Disconto - Gesellschaft, Depositen - Kasse M,
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 115. Postscheckkonti: Berlin 1180 54; Den
Haag 145512; Paris 1700 14; Prag 59283; Wien 114783; Zürich 8159
Redaktion, Verlag und Lesesaal:
Berlin W62, Kurfürstenstr.76-77 • Tel. B 5 Barbarossa 7228
Man abonniert beim Verlag, bei der Post oder bei den Buchhändlern.
Einzel-Nummer 50 Pfennig. Quartal für Deutschland inklusive Postzustellung
Mark 4,50; Lieferung durch den Verlag im Umschlag Mark 5,50; für das
Ausland (nur im Umschlag) Mk.5,50; oder: Tschechoslowakei Kc 45; Frank-
reich und Belgien fr. Frs. 35; Holland hfl. 3,25; Schweiz und die nicht ange-
führten Länder sfrs. 7; Übersee § 1,50; Sammelmappen pro Jahrgang Mk. 4,50
Deutsche Künstler in Paris
Von Dr. Fritz Neugass
Es liegt im Wesen des Künstlers, seine
Lehr- und Wanderjahre auf Reisen in der
Fremde zu verbringen. Schon im 13. Jahr-
hundert zogen französische Baumeister durch
ganz Europa, wie aus den Reiseskizzenbüchern
des Villard de Honnecourt hervorgeht. Dürer
ging nach Italien und den Niederlanden, und
zur selben Zeit sah sich der Italiener de Bar-
bari in Deutschland um. Bologna war die Wall-
fahrtstätte der niederländischen Manieristen,
und in Rom begründeten die Franzosen im
17. Jahrhundert zur Ausbildung ihrer jungen
Künstler eine Akademie. Eben jenes Rom, für
die Deutschen durch viele Epochen Ziel aller
Wünsche, war zur Zeit Goethes und Winckel-
manns der Brennpunkt aller geistigen In-
teressen.
Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts wandten
sich deutsche Künstler nach Frankreich. Sie
fanden dort eine starke und lebendige künst-
lerische Tradition, die sich vom Barock und
Rokoko bis zum Klassizismus und zur Romantik
weiter entwickelt hat. Jacques Louis David
nnö cpin» Schnle zogen zahlreiche deutsche
Maler, vornehmlich aus dem Rheinland an. Wir
wissen von Feuerbach, daß er bei Couture stu-
dierte und von Leibi, wie sehr er mit Courbets
ästhetischen Prinzipien übereinstimmte. Seit-
dem ist die Reihe der deutschen Künstler, die in
Frankreich ihre Anregungen suchten, immer
größer geworden. In Paris fanden sie gründ-
liche Durchbildung des Handwerklichen und das
Erlebnis einer kulturgesättigten Atmosphäre.
Diese deutschen Künstler haben sich kaum
jemals an die fremden Einflüsse, unter denen
sie. standen, verloren. Dazu blieb in ihnen das
Bewußtsein der volksmäßigen Zugehörigkeit
und der eigenen Persönlichkeit zu lebendig. Die
deutsche Eigenart hat sich im Gegenteil gerade
nach diesen Studienjahren oft entscheidender
herausgearbeitet — so wie sich wohl in der Be-
schäftigung mit einer fremden Sprache erst das
Wesen der Muttersprache offenbart.
Aber der Gewinn dieser Pariser Arbeitsjahre
liegt nicht nur bei den deutschen Künstlern
allein. Durch ihre Anwesenheit und ihr
Schaffen haben sie auch manches zu geben. In
den großen Ausstellungen und Galerien be-
gegnet das kunstliebende und besonders auf-
nahmefähige Pariser Publikum immer wieder
den Werken der deutschen Gäste. In ihrer Be-
trachtung erfassen die Franzosen rein gefühls-
mäßig etwas, was ihnen verstandesmäßig zu er-
kennen viel schwerer würde: auf dem Umweg
über die deutsche Kunst erschließt sich ihnen
der deutsche Geist.
I.
Paul Strecker
aber das Bewußtsein ihrer blutmäßigen Ge-
bundenheit an die Heimat.
Bei Paul Strecker, der seit Jahren in
Paris lebt und in der Tradition einer hohen
Malkultur seine eigene Form gefunden hat,
schwingt noch immer jener romantische Grund-
ton der mittelrheinischen Landschaft, der er
entstammt. Die lyrische Empfindsamkeit,
schon im frühen XV. Jahrhundert ein typisches
Zeichen für die Kunst dieser Gegend, kommt
in Streckers malerischem Werk überzeugend
zum Ausdruck. Er flüchtet aber nicht aus un-
serer Zeit in ein romantisches Mittelalter oder
karges Biedermeier, sondern entwickelt seine
Kunst aus den ästhetischen Errungenschaften
des XX. Jahrhunderts. Er mußte durch Picasso
und die Abstrakten hindurchgehen, um aus
ihrer Strenge heraus zu jener ausgewogenen
Gestaltung zu gelangen, die seinen Werken
eigen ist.
Und das ist das Seltsame an diesen Bildern:
daß wir vor sie treten, wie vor alte Bekannte,
Paul Strecker, Zigeuner. 1932
Rheinische Künstler zeigen im Gegensatz
zu denen des deutschen Nordens und Südens
einen feineren Sinn für westliche Einflüsse. Sie
sind empfindsam und weltoffen, behalten dabei
daß sie greifbar sind in ihrer Wirklichkeits-
nähe, — und daß sie uns dann plötzlich ent-
gleiten, wenn wir sie schon zu halten meinen,
— ein zweites Gesicht enthüllen, ein Gesicht, in
dem sich die Unruhe dieser Zeit, die Nervosität
des modernen Menschen spiegelt.
Der Wunsch, zu einem Bildinhalt im Sinne
der alten Meister zu kommen, ist für Streckers
Generation charakteristisch. Träumerische,
musikalische Verlorenheit, etwas Schumann-
haftes liegt über diesen jungen Menschen, die
in verharrender Ruhe im Raum oder in der
Landschaft stehen, liegen, träumen, unwirklich
bei aller Naturnähe.
Schon die Titel seiner Bilder zeugen von der
tiefen Beziehung seines Lebens zu seiner Kunst.
Der „Schlafende Junge in der Dämmerung“ und
die „Winterlandschaft am Kreuzberg“ haben
etwas von der Atmosphäre eines Kaspar David
Friedrich. Und die „Place de la Victoire“
(Paris), starker Zusammenklang von Grau,
Blau und Weiß, verschmelzt strahlend die
Leuchtkraft der Pariser Palette und die vollen
Akkorde rheinischen Temperaments.
Die Technik Streckers ist äußerst subtil.
Wie viele Künstler unserer Generation legt er
besonderen Wert auf die Pflege des Handwerk-
lichen. Er modelliert mit der Farbe und er-
reicht zarteste Abtönung. Blau-graue Schatten,
manchmal ins Rötliche spielend, geben seinen
Bildern geheimnisvolle Beseelung.
In diesen Tagen zeigte Paul Strecker eine
Auswahl seinei’ letzten Werke in der „Galerie
Jacques Bonjean“. Das französische Publikum
bereitet ihm einen ungewohniien großen
Erfolg. Dem deutschen Kunstfreund ist
Strecker längst kein Fremder mehr. Seine
Bilder waren auf allen großen deutschen
Ausstellungen der letzten Jahre zu sehen. Auch
viele Museen haben sich Werke dieses Künst-
lers gesichert.
So verwirklicht sich sein besonderer Wunsch,
daß nicht nur der abseitige Kunstliebhaber
seine Werke sammeln möge, sondern daß auch
die einfachen Menschen aus dem Volke von
seinen Bildern ergriffen werden, wie von den
Schöpfungen der alten Meister.
Die Aufsatzreihe wird fortgesetzt
Josef Floch
und die Graphikausstellung
im Wiener Hagenbund
Das Niveau der Winterausstellung der Mit-
glieder des Wiener Hagenbundes steht weit
über dem der letzten Jahre. Auch diesmal hat
man, ähnlich wie dies im Vorjahr bei Georg
Ehrlich der Fall war, mit dem vor Jahren nach
Paris übersiedelten Josef Floch einen be-
deutsamen Jung-Wienei- Künstler mit einer
größeren Kollektion in den Vordergrund der
Schau gestellt. Eine durchaus eigene, ganz un-
wienerische Künstlerpersönlichkeit, hat Floch
in Paris den richtigen Boden zur Entfaltung
seiner Kunst gefunden. Erst hier ist er zu der
strengen Gesetzlichkeit derselben, der Ver-
wobenheit von Gestalt und Raum gelangt.
Frankreichs Klassizismus, der in seinem Werk
mit dem Kubismus eine Bindung eingegangen
ist, dankt er den Adel seiner Formung, die
innere Melodik seiner Landschaft und seiner
Gestalten. An der Sublimierung seiner Kunst
hat die Farbe wesentlichen Anteil. Sein in
Wien oft allzu lautes Rot und Blau, das die
farbige Note der Bilder bestimmt, ist unter
dem Einfluß französischer Malkultur einem
gedämpften, mit Weiß durchsetzten, silbrigen
Blau und Rosa gewichen, das seinen Gemälden
den Anschein des Immateriellen, des Irrealen
verleiht, wie es den Märchenstücken Maeter-
lincks, den Kompositionen von Debussy eignet.
Es ist eine durchaus vergeistigte und trotz des
starken französischen Einschlages in ihrer end-
Josef Floeh, Bildnis
Ausstellung: Hagenbund, Wien
gültigen Formung ganz persönliche Kunst, in
der sich Gefühl und Intellekt harmonisch er-
gänzen.
Auch sonst weist die Schau, in der man die
Einsendungen diesmal gründlicher gesiebt zu
haben scheint, manches erfreuliche Ergebnis
auf. So hat sich Wilhelm Klier, der geraume
Zeit den Wiener Ausstellungen ferngeblieben
war, mit mehreren ungemein eindringlichen
Bildniszeichnungen eingestellt, die ihn, im Ge-
gensatz zu Flochs weit geistigerer und sen-
siblerer Kunst, mit ihrem derbsinnlichen Er-
fassen der Realität, ihrem barocken Schwung
im Österreichertum zutiefst verwurzelt zeigen.
Auch G. Jung (gleichfalls ein seltener Gast
des Hagenbundes) und Hauk bekunden eine
beachtenswerte Begabung für das Bildnis.
Planckh hat figurale Skizzen aus Italien in
seiner monumentalen Umrißmanier zur Schau
gestellt. Hartas südfranzösische Aquarelle
geben mit ihrer lockeren Malerei, ihrem Valeur-
reichtum trefflich das Stimmungshafte jener
Landschaft wieder. Ebenso weist Mayer-Mär-
ton, in seinen Aquarellen aus Palermo und
ANTIQUARIAT
PAUL GRAUPE
BERLIN W9, BELLEVUESTRASSE 3
VERSTEIGERUNGEN
GUSTAV CRAMER
ANTIQUITÄTEN Berlin W9, Lennestr. 8 GEMÄLDE
BRUMMER NEW-YORK
55, East 57th Street